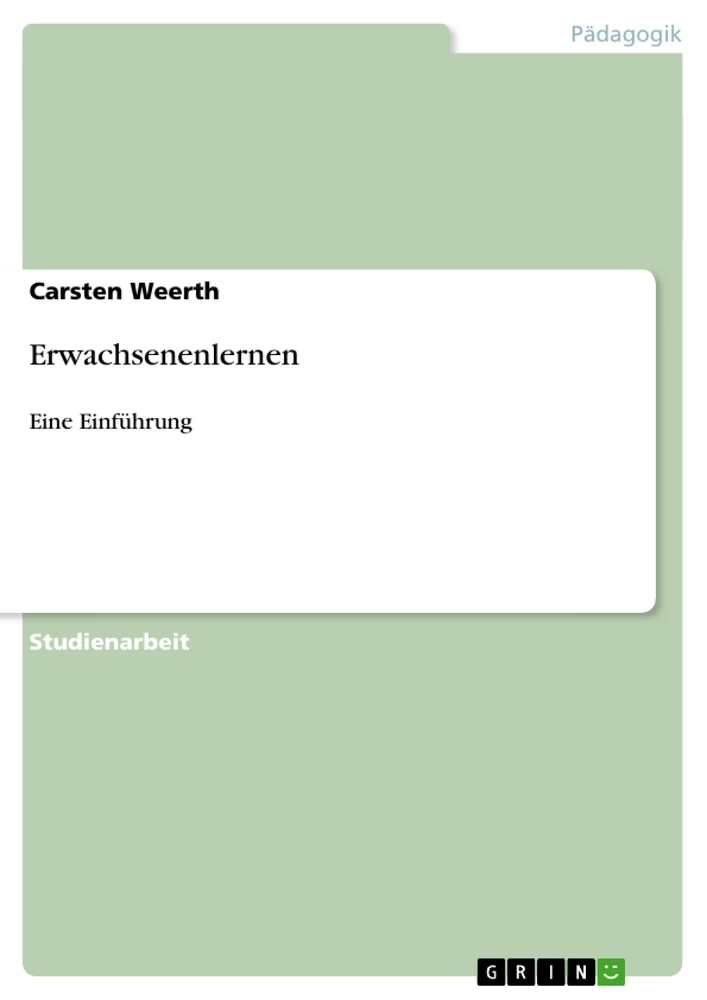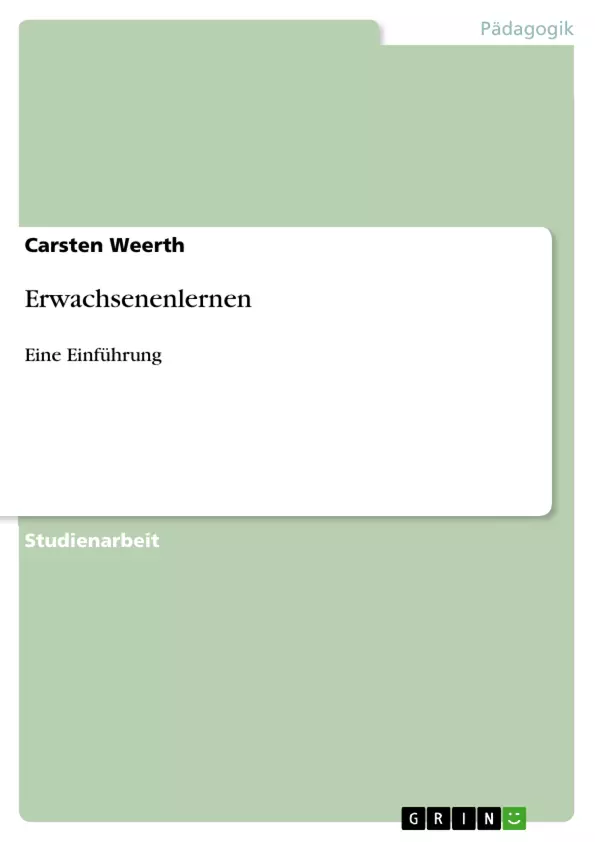Diese Einführung in das Erwachsenenlernen befasst sich mit acht Fragen:
Was ist „Lernen“ und „Bildung“ gemeinsam und wodurch unterscheiden sich Lernen und Bildung?
Welche Bedeutung hat die Millieuforschung für die Bildungspraxis?
Inwieweit kann die Lernmotivation didaktisch-methodisch gefördert werden?
Was besagt die Adoleszenz-Maximum-Kurve? Was spricht dafür, was gegen diese Kurve? Trifft das Sprichwort „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ zu?
Begründen Sie die These, dass das Lernen Erwachsener größtenteils „Anschlusslernen“ ist. Können Sie eigene Beispiele nennen?
Inwiefern ist Lernen im Erwachsenenalter vorwiegend ein „innerer Monolog“?
Inwieweit ist das soziale Lernen in Seminargruppen anregend, inwieweit wird Lernen gestört?
Mit welchen Lernschwierigkeiten muss in der Erwachsenenbildung gerechnet werden?
Inhaltsverzeichnis
Einsendeaufgabe 1 - Lernen/Bildung
Einsendeaufgabe 2 - Millieuforschung
Einsendeaufgabe 3 - Lernmotivation
Einsendeaufgabe 4 - Adoleszenz-Maximum-Kurve
Einsendeaufgabe 5 - Anschlusslernen
Einsendeaufgabe 6 - Innerer Monolog
Einsendeaufgabe 7 - Seminargruppen pro/contra
Einsendeaufgabe 8 - Lernschwierigkeiten
Literaturverzeichnis
Einsendeaufgabe 1 - Lernen/Bildung (zu EB 0410)
Was ist „Lernen“ und „Bildung“ gemeinsam und wodurch unterscheiden sich Lernen und Bildung?
Zunächst mehrere Definitionen:
Das „Lernen“ ist nach Auffassung der Anthropologen für Menschen notwendig, weil sie keine eigenen Instinkte mehr haben - diese Lernfähigkeit ermöglicht die „flexible Anpassung an neue Lebensverhältnisse“ (Siebert, 2011a, S. 21). „Lernen erleichtert nicht nur angemessen 'erfolgreiche' Reaktionen, sondern auch aktive Veränderungen der Umwelt selbst“ (Siebert, 2011a, S. 21).
In einer allgemeinen erziehungswissenschaftlichen Definition stellt „Lernen“ „eine dauerhafteVerhaltensänderung aufgrund von Erfahrungen“ dar (Siebert, 2010a, S. 191). In einer neueren und detaillierteren Definition handelt es sich um die „Erweiterung des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Lebenssituationen“ (Siebert, 2010a, S. 191).
„Der Begriff 'Bildung' gehört [...] zu den Grundbegriffen der Aufklärung und zugleich des Selbstverständnisses der neuen 'gebildeten' (bürgerlichen) Gesellschaft“ (Groothoff, 1978, S. 211). Siebert stellt fest, dass „zwischen Aufklärung und Bildung“ ein Zusammenhang besteht (Siebert, 2011a, S. 30): „Aufklärung - also vernünftiges Denken und Wollen - ist das Ergebnis von Bildungsprozessen“ (Siebert, 2011a, S. 30). Dabei ist „Bildung kein Produkt, sondern ein Prozess“ (Siebert, 2011a, S. 34).
Das gilt auch für das Lernen, da es sich um einen Prozess handelt.
Bildung meinte in „klassischen Bildungstheorien den Prozess und das Ziel der Kräftebildung“ (Schultz, 2010, S. 41). Der Erziehungswissenschaft war dieser Begriff „zu unscharf“, weswegen „operationalisierbare Begriffe“ wie das Lernen eingeführt worden sind (Schultz, 2010, S. 43).
Es lässt sich festhalten, dass das Lernen, also das Aufnehmen, Verarbeiten und Erinnern von neuen Inhalten daher die Voraussetzung von Bildung ist.
Neu ist die Wahrnehmung, dass statt Bildung mehr und mehr der Begriff Lernen benutzt wird: „Der Begriff der Bildung scheint verdrängt zu werden. Lernen, Training, Schulung treten an seine Stelle. Mit Bildung wird eine Suchbewegung angesprochen. Bildung heißt sich im Denken und Handeln zu orientieren, Argumente zu suchen und danach zu handeln, Entscheidungen zu treffen und die Folgen zu reflektieren sowie neue Argumente zu suchen. Bildung ist ein lebensbegleitender und -integrierter Prozess. Bildung ist Arbeit an sich selbst, lässt sich aber schwer von Lernen trennen.“ (Lenz, 2007, S. 10-3). „Wer lernt, nimmt Informationen auf und verarbeitet sie. Mit Bildung werden die Vorgänge umschrieben, in denen der Mensch 'etwas aus sich macht'. Bildung drückt den Prozess und Zustand der Selbstkultivierung des Menschen aus.“ (Lenz, 2007, S. 10-4).
In der öffentlichen Wahrnehmung der Begriff Bildung nach der sog. ,,Göttinger Studie“ nicht unbedingt von Zertifikaten, Kenntnissen oder Kompetenzen abhängig ist, sondern oftmals vom gesellschaftlichen „Stand“ (Neudeutsch: vom „Standing“), von guten Umgangsformen mit Menschen oder des Auftretens einzelner Persönlichkeiten abhängig ist, z.B. von Toleranz, Güte, Hilfsbereitschaft, gutes Verhalten zu Mitmenschen uvm. (Siebert, 2011a, S. 42 f.).
Der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen hat I960 Bildung folgendermaßen definiert: „Gebildet im Sinne der Erwachsenenbildung wird jeder, der in der ständigen Bemühung lebt, sich selbst, die Gesellschaft und die Welt zu verstehen und diesem Verständnis gemäß zu handeln“ (Deutscher Ausschuss, 1960, S. 404 zitiert nach Siebert, 2011a, S. 34).
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Lernen die Voraussetzung von Bildung ist. Lernen im Sinne der Aufklärung und Bildung zielen gemeinsam darauf ab, den „gebildeten Menschen“ besserzu informieren und ihm ein verantwortungsvolles Handeln in derGe- sellschaft und der Welt zuzugestehen. Dieses zielt auf eine Veränderung der Welt zum Besseren ab. Allerdings ist in der öffentlichen Meinung mit Bildung nicht nur Wissen, sondern insbesondere auch das Auftreten und der Umgang von gebildeten Menschen mit anderen Menschen gemeint (sog. Schlüsselqualifikationen).
Einsendeaufgabe 2 - Millieuforschung (zu EB 0410)
Welche Bedeutung hat die Millieuforschung für die Bildungspraxis?
„Die traditionelle schichtspezifische Sozialforschung berücksichtigt vor allem sozialstatistische Faktoren. Die Millieuforschung untersucht außerdem sozialemotionale, alltagsästhetische, ethische Lebensstile und Interessen, u.a. auch Bildungsinteressen.“ (Siebert, 2011a, S. III).
Die Erkenntnisse aus diesen Studien des SINUS-Instituts Heidelberg im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung - „das Millieumodell ist (vermutlich) das bekannteste“ hinsichtlich der „Bildungsmotive und Erwartungen an Bildungseinrichtungen“ (Siebert, 2011a, S. 63) - sind insbesondere für die Zielgruppenorientierung und Planung von Weiterbildungsveranstaltungen von Bedeutung und damit gleichzeitig über den ökonomischen Erfolg von Weiterbildungsträgern (und deren Mitarbeitern) (so sinngemäß Siebert, 2011a, S. 65).
Diese Millieuforschung untersucht „Kommunikationsgewohnheiten, Neigungen und Abneigungen möglicher Teilnehmer, um ihre Alltagsästhetik im ganzen“ (Meyer, 1993, S. 67, zitiert nach Siebert, 2011a, S. 63).
Darüber hinaus sind aus der Millieuforschung Schlussfolgerungen über die Weiterbildungsmotivation möglich, v.a. „welche sozialen Situationen und welche Atmosphäre die Veranstalter ihren Zielgruppen versprechen“ sollten (Siebert, 2011a, S. 63). Entscheidende Kriterien für derartige Millieuforschungen sind u.a. Seminarbewertungen und Befragungen zum Freizeitverhalten der Seminarteilnehmer - die Forschergruppe des SINUS-Instituts bezeichnete „ihr Konzept als 'Marktmodell'“ (Siebert, 2011a, S. 65) - tatsächlich handelt es sich nach Auffassung von Siebert eher um eine „Marketingstudie“ denn um eine wirkliche „Bildungsforschung“ (Siebert, 2011a, S. 65).
In der Praxis deutet sich ein Streit zwischen „Teilnehmerorientierung“ und „Kundenzufriedenheit“ an, die „unterschiedliche didaktische, aber auch förderpolitische Konsequenzen haben“ (Siebert, 2011a, S. 66).
Während staatlich geförderte Bildungsträger eher nach dem sog. „Bildungskonzept“ für alle Menschen arbeiten (in der Tradition der Aufklärung und dessen Bildungsauftrags haben), neigen private Bildungsträger eher dem „Marktkonzept“ und dem Prinzip der „Kundenzufriedenheit“ zu (vgl. ausführlich Modul EB 0220, Müller-Commichau, 2011).
Einsendeaufgabe 3 - Lernmotivation (zu EB 0410)
Inwieweit kann die Lernmotivation didaktisch-methodisch gefördert werden?
Zunächst ein Zitiat zur Klärung der Frage, was Lernmotivation ist: „Lernmotivation ist wesentlich intern begründet, d.h. sie ist Bestandteil der eigenen Identität, des Selbstbildes, derLebensgeschichte“ (Siebert, 2011a, S. 70).
Will man Lernmotivation fördern, muss man den Menschen im Wunsch zu Lernen fördern, z.B. durch Anreize (z.B. Zertifikate, Lockungen auf bessere Bezahlung/bessere Arbeitschancen, mehr Zufriedenheit, Individualisierung). Dabei sind insbesondere erfolgreiche Lernprozesse Motivation zu mehr Lernen (Siebert, 2011a, S. 70). Konkret muss Weiterbildung „nützen, alltagspraktisch, psychohygienisch und beruflich 'zweckmäßig sein'“, sie darf nicht als „Bedrohung wahrgenommen werden, sondern als Bereicherung und Gewinn“ (Siebert, 2011a, S. 70).
Von besonderer Bedeutung ist, dass sich „Lernmotivation [...] sich nicht pädagogisch herstellen [lässt], aber [...] sich motivierende Lernumgebungen gestalten [lassen]“, z.B. „anregende Räume, das Ambiente, dieAtmosphäre“ (Siebert, 2011a, S. 70).
Insbesondere folgende didaktisch-methodische Faktoren sind hilfreich für eine Lernmotivation (nach Siebert, 2011a, S. 70/71):
- die angebotenen Inhalte sollten anwendungsbezogen (praxisgerecht) sein;
- „neues Wissen sollte anschlussfähig sein, d.h. zu vorhandenem Wissen und zu Erfahrungen passen;“
- es sollte eine leichte Überforderung („dosierte Diskrepanz“) angewendet werden;
- Überraschungen im Unterricht (unerwartete Einblicke oder Aufgaben) machen Seminarteilnehmer munter (insbes. wichtig nach der Mittagspause);
- alle „Lernkanäle“ sollten angesprochen werden, da Menschen unterschiedlich lernen („optisch, akustisch, spielerisch, ausprobierend“);
- „soziales Lernen gemeinsam mit anderen motiviert, sofern die 'Chemie' in der Gruppe stimmt“;
- die Lernenden sollten über Lernziele und Inhalte mitbestimmen können;
- humorvolles Auftreten sorgt für gute Stimmung;
- die Zertifizierung der Bildungsmaßnahme ist menschenfreundlich und motiviert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gemeinsame und wodurch unterscheiden sich "Lernen" und "Bildung" laut dem Dokument "Einsendeaufgabe 1 - Lernen/Bildung (zu EB 0410)"?
Laut dem Dokument ist Lernen die Voraussetzung für Bildung. Lernen wird als eine dauerhafte Verhaltensänderung aufgrund von Erfahrungen oder als die Erweiterung von Wissen und Fähigkeiten zur Bewältigung von Lebenssituationen definiert. Bildung wird als ein Prozess der Kräftebildung und der Selbstkultivierung des Menschen beschrieben, der auf vernünftigem Denken und Handeln basiert. In der öffentlichen Wahrnehmung hängt Bildung auch von gesellschaftlichem Stand und Umgangsformen ab. Beide, Lernen und Bildung, zielen darauf ab, informierte und verantwortungsbewusste Individuen zu fördern, die zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen.
Welche Bedeutung hat die Millieuforschung für die Bildungspraxis, wie in "Einsendeaufgabe 2 - Millieuforschung (zu EB 0410)" beschrieben?
Die Millieuforschung untersucht sozialemotionale, alltagsästhetische und ethische Lebensstile, einschließlich Bildungsinteressen, und bietet Einblicke in Kommunikationsgewohnheiten, Neigungen und Abneigungen potenzieller Teilnehmer. Die Erkenntnisse sind besonders wichtig für die Zielgruppenorientierung und Planung von Weiterbildungsveranstaltungen. Sie beeinflussen den ökonomischen Erfolg von Bildungsträgern, indem sie helfen, die Erwartungen und Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen besser zu verstehen. Es gibt eine Spannung zwischen "Teilnehmerorientierung" und "Kundenzufriedenheit", wobei staatlich geförderte Träger eher dem Bildungskonzept folgen, während private Träger dem Marktkonzept der "Kundenzufriedenheit" folgen.
Inwieweit kann die Lernmotivation didaktisch-methodisch gefördert werden, wie in "Einsendeaufgabe 3 - Lernmotivation (zu EB 0410)" dargelegt?
Lernmotivation ist intern begründet und Teil der eigenen Identität. Sie kann durch Anreize, erfolgreiche Lernprozesse und die Gestaltung motivierender Lernumgebungen gefördert werden. Konkret sollten Weiterbildungen nützlich, alltagspraktisch, psychohygienisch und beruflich zweckmäßig sein. Wichtige didaktisch-methodische Faktoren sind Anwendungsbezug, Anschlussfähigkeit an vorhandenes Wissen, dosierte Überforderung, Überraschungen, Ansprechen aller Lernkanäle, soziales Lernen, Mitbestimmung bei Lernzielen und humorvolles Auftreten. Auch die Zertifizierung von Bildungsmaßnahmen kann motivieren. Die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden sowie das Ambiente spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Lernmotivation.
Was sind die Themen der Einsendeaufgaben 4 bis 8, wie im Inhaltsverzeichnis erwähnt?
Die Einsendeaufgaben 4 bis 8 beschäftigen sich mit folgenden Themen: Adoleszenz-Maximum-Kurve, Anschlusslernen, Innerer Monolog, Seminargruppen pro/contra, und Lernschwierigkeiten.
- Quote paper
- Dr. Carsten Weerth (Author), 2011, Erwachsenenlernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191503