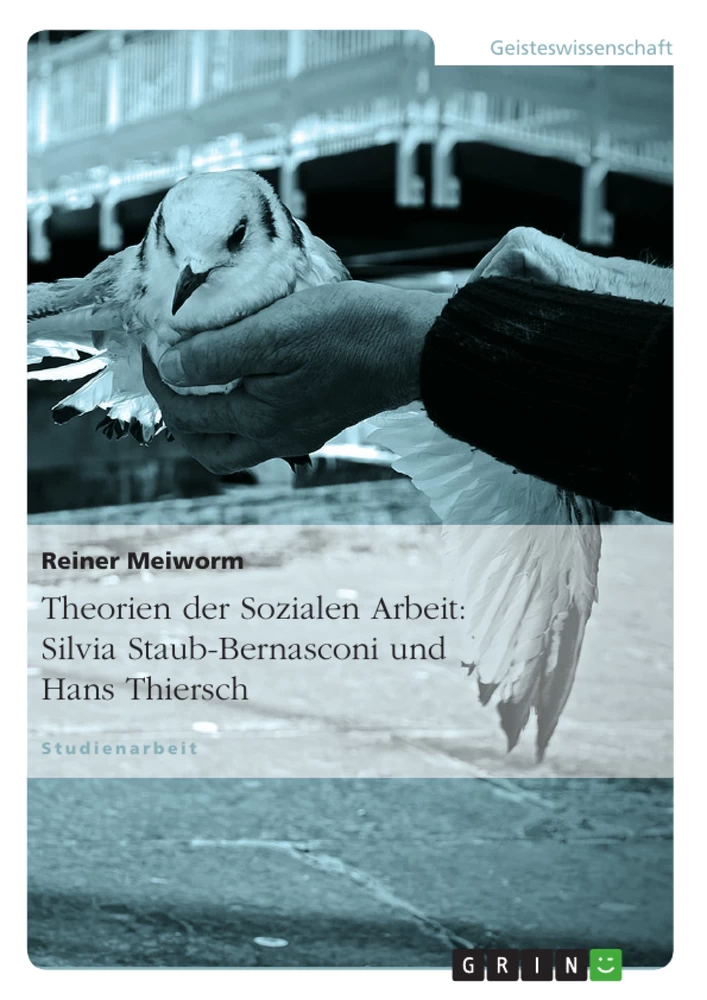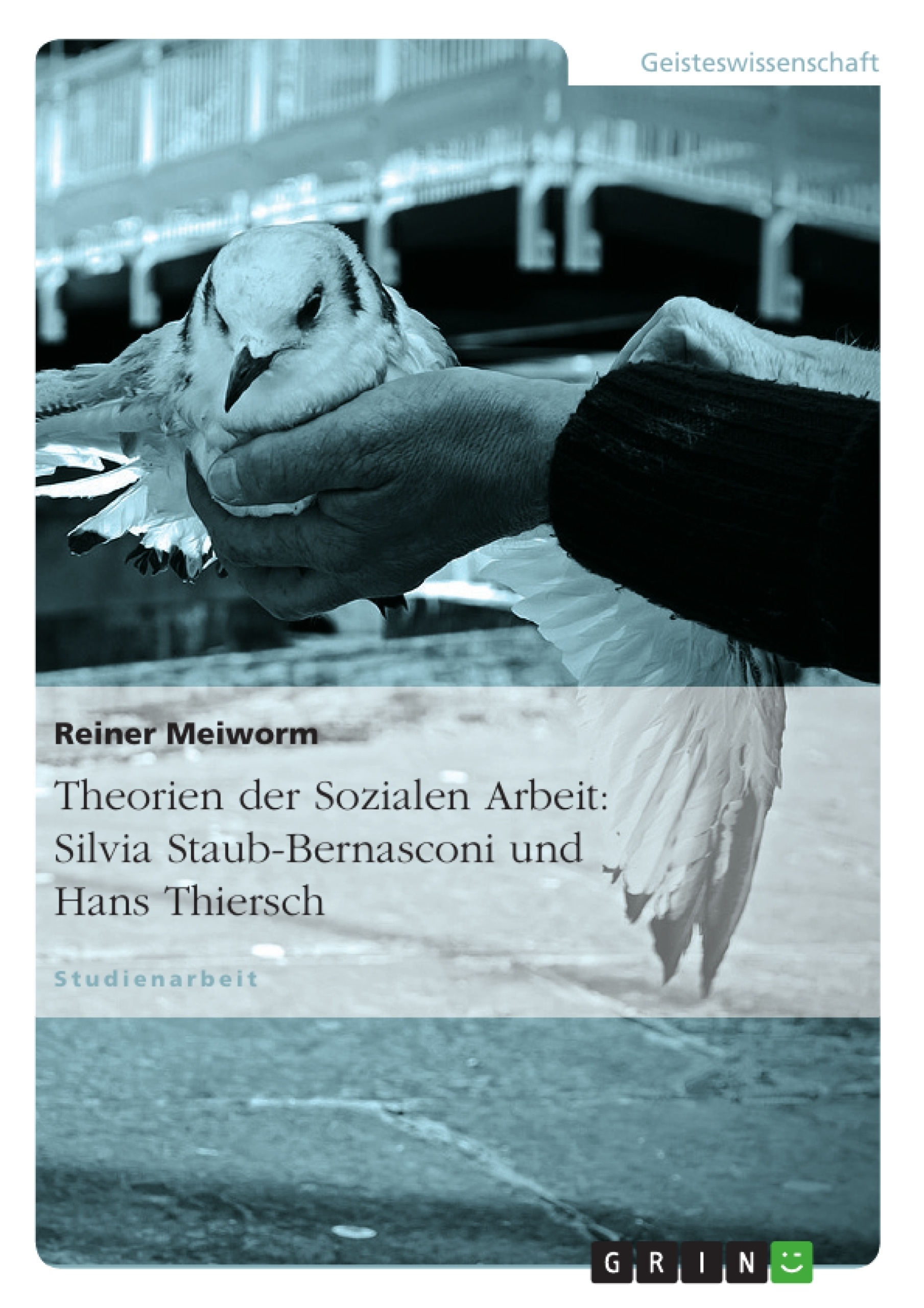Wie der Titel der Arbeit bereits sagt, beschäftige ich mich in den folgenden vier Kapiteln mit zwei der großen Theorien der Sozialen Arbeit. Ich habe mich für die Theorien von Prof. Dr. Silvia Staub-Bernasconi und Prof. Dr. phil. Dr. Dres. h.c. Hans Thiersch entschieden. Silvia Staub-Bernasconi studierte Soziale Arbeit in Zürich und den USA, Soziologie, Sozialpsychologie, Pädagogik und Sozialethik an der Universität Zürich und habilitierte an der Technischen Universität Berlin. Sie war u.a. Dozentin für Soziale Arbeit und Menschenrechte an der Hochschule für Soziale
Arbeit in Zürich und der TU Berlin. Silvia Staub-Bernasconi prägte den Begriff der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession und formte darüber hinaus das Wissenschaftsverständis der Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft. Sie stellte von den anderen Arbeiten der großen Theoretiker wie Thiersch, Dewe/Otto und Bommes/Scherr weitestgehend losgelöste Theorien für die Soziale Arbeit auf.
Hans Thiersch betrachtet u.a. in seiner Theorie über die „Positionsbestimmung der Sozialen Arbeit“, das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit vor dem Hintergrund politischer Zwänge und ökonomischer Interessen. Seine einzelnen Tätigkeiten und Publikationen sind so zahl- und umfangreich, dass eine Aufzählung dieser hier den Rahmen sprengen würde. Er gilt als Begründer der Tübinger Schule. Seine Auffassung der Lebensweltorientierung bei der Sozialen Arbeit nimmt Einfluss auf die Theorien von Dewe/Otto und Bommes/Scherr. Eine klare Abgrenzung der beiden von mir ausgewählten Theorien ist trotz ihrer Eigenständigkeit nicht vollständig möglich.
Im Folgenden werde ich versuchen, gravierende Unterschiede sowie markante Schnittmengen herauszustellen und deren Anwendbarkeit im sozialpädagogischen Arbeitsfeld der stationären und der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit kritisch zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Vorstellung der behandelten Theorien
- Silvia Staub-Bernasconi: Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession und Ursache nichterfüllter legitimer Wünsche und Bedürfnisse
- Hans Thiersch: Lebensweltorientierung
- Schnittmengen und Unterschiede der beiden vorge-nannten Theorien
- Professionelles Handeln
- Soziale Probleme
- Mandate der Sozialen Arbeit
- Ziele Sozialer Arbeit
- Fachlich-kritische Betrachtung
- Thierschs Theorie im Alltag einer stationären Kinder-und Jugendhilfeeinrichtung
- Staub-Bernasconis Theorie im Alltag der Heimer-ziehung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert zwei einflussreiche Theorien der Sozialen Arbeit, die von Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch entwickelt wurden. Das Ziel ist es, die Kernpunkte beider Theorien zu erläutern, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen sowie ihre Anwendbarkeit im sozialpädagogischen Arbeitsfeld zu beleuchten.
- Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
- Lebensweltorientierung
- Soziale Probleme und ihre Ursachen
- Mandate der Sozialen Arbeit
- Anwendungen der Theorien in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch vor und skizziert die zentralen Themen der Arbeit.
- Kurze Vorstellung der behandelten Theorien: Dieses Kapitel präsentiert die Theorien von Staub-Bernasconi und Thiersch. Die Theorie von Staub-Bernasconi fokussiert auf die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, während Thierschs Theorie die Lebensweltorientierung als zentralen Ansatzpunkt der Sozialen Arbeit betont.
- Schnittmengen und Unterschiede der beiden vorge-nannten Theorien: Dieser Abschnitt beleuchtet die Schnittmengen und Unterschiede zwischen den beiden Theorien. Dabei werden Themen wie professionelles Handeln, soziale Probleme, Mandate der Sozialen Arbeit und Ziele Sozialer Arbeit diskutiert.
- Fachlich-kritische Betrachtung: In diesem Kapitel wird die praktische Anwendbarkeit der beiden Theorien in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit beleuchtet. Insbesondere wird die Anwendung von Thierschs Theorie in der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie die Anwendung von Staub-Bernasconis Theorie in der Heimerziehung kritisch analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Theorien der Sozialen Arbeit von Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch. Sie fokussiert auf die Konzepte der Menschenrechtsprofession, der Lebensweltorientierung, der Bearbeitung sozialer Problemlagen, der Mandate der Sozialen Arbeit, sowie auf die praktische Anwendbarkeit der Theorien in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Reiner Meiworm (Author), 2012, Theorien der Sozialen Arbeit: Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191510