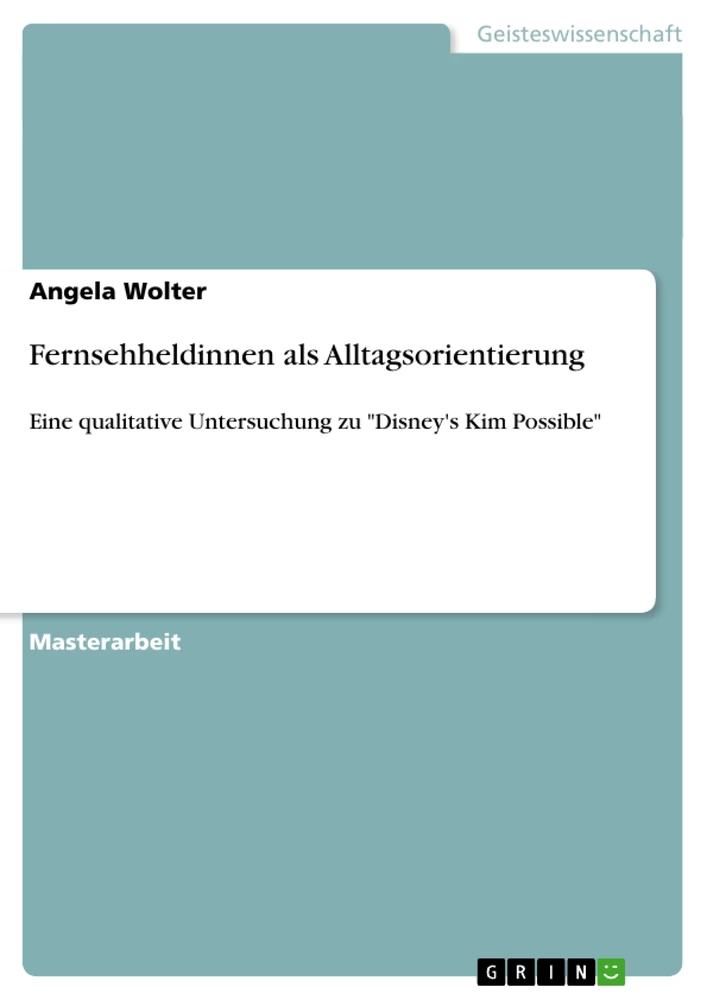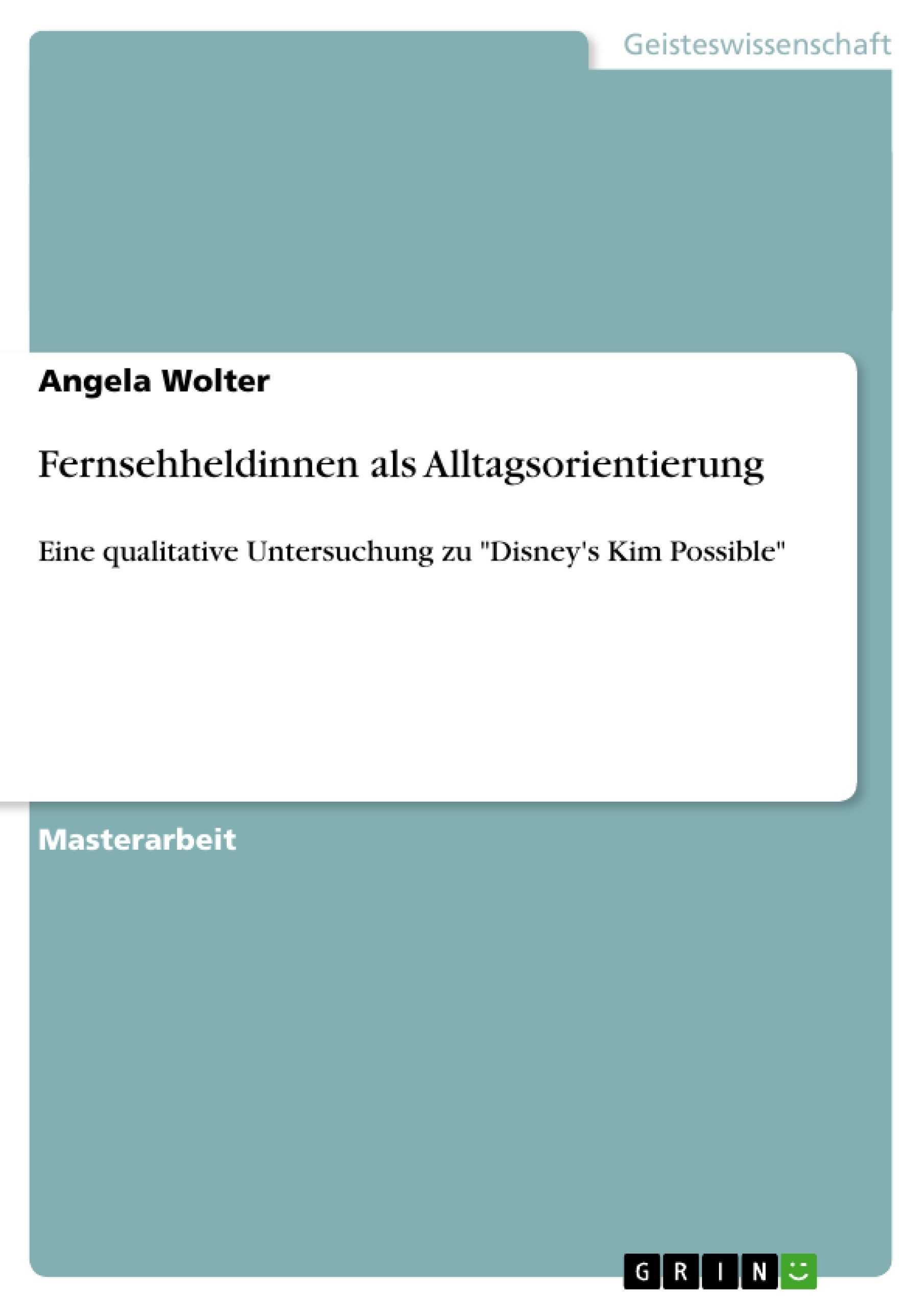„Fernsehen spielt im Alltag der Heranwachsenden, für ihre Entwicklung, Lebensorientierung und Daseinsbewältigung eine maßgebliche Rolle. Kindheit ist heute mediatisierte Kindheit in einer unübersichtlichen Welt“ (Auszug aus der Präambel des „Runde[n] Tisches – Qualitätsfernsehen für Kinder“ vom 4. November 1996, zit. nach Bachmair 2005: 2). – Was sich 1996 bereits zeigte, gilt heute mehr denn je: Nach wie vor stellt das Fernsehen das zentrale Medium für Kinder dar. Laut KIM-Studie 2010 ist das Fernsehen das Medium, auf welches Kinder am wenigsten verzichten könne. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der Idolfindung von Kindern: Fast zwei Drittel der in der eben genannten Studie befragten Kinder (62%) nannten eine Person oder eine Figur, für die sie besonders schwärmten. Wiederum nannte knapp die Hälfte von ihnen hierbei eine Person aus Film und Fernsehen. Gerade von solchen „MedienheldInnen“ lernten Kinder einen angemessenen Umgang mit Emotionen. Jungen und Mädchen brauchen also HeldInnen, welche sich mit ihren persönlichen Alltagserfahrungen auseinandersetzen und ihnen somit eine gewisse Orientierung liefern. Auch Zeichentrickprogramme, welche bei Kindern nach wie vor zu den beliebtesten Fernsehformaten zählen, sind hierbei nah an der kindlichen Alltagserfahrung und liefern so mögliche Orientierungen.
Die vorliegende Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Arts“ im Studiengang Gender Studies beleuchtet daher eben jene Alltagsorientierung, welche Kindern durch das Fernsehen und die in ihm präsentierten HeldInnen geliefert wird. Da eine umfassende Analyse des Gesamtfernsehprogramms oder auch nur des deutschsprachigen Kinderfernsehens schwerlich im Rahmen einer Masterarbeit möglich ist, beschränkt sich die Untersuchung auf die Analyse einer ausgewählten Kindersendung: „Disney's Kim Possible“. Mittels qualitativer Interviews wurden Grundschülerinnen der dritten und vierten Klasse, d.h. auf Mädchen im Alter zwischen neun und zehn Jahren, befragt, um folgende Forschungsfragen zu beantworten: Welche Geschlechterbilder werden in „Disney’s Kim Possible“ gezeichnet? Werden diese Bilder von Kindern wahrgenommen – und, so dem der Fall ist: Wie integrieren die Kinder die erlernten Modelle in ihren Alltag?
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- 1 Einleitung
- 2 Vorbemerkungen: Geschlecht, Geschlechterstereotype und „doing gender“
- 3 Aufarbeitung des Forschungsfeldes
- 3.1 Geschlechterdifferenzen im Fernsehverhalten von GrundschülerInnen
- 3.2 Geschlechterverhältnisse im Kinderfernsehen
- 3.3 Medial geleitete Sozialisation
- 3.3.1 Parasoziale Interaktion und Wissen aus innerer Repräsentation
- 3.3.2 Spieltheoretische Annahmen
- 4 Disneys Kim Possible
- 4.1 Sendungsanalyse
- 4.1.1 Inhalt
- 4.1.2 Repräsentation
- 4.1.3 Figuren und Akteure
- 4.2 „Sie kann alles, er nicht“: Genderkonstruktion in der Serie
- 4.3 Das Phänomen Kim Possible: Erklärungen für das Erfolgsrezept
- 4.3.1 „Oben drüber“ statt „unten durch“?
- 4.3.2 Typisch Zeichentrick oder doch Anime?
- 5 Untersuchungsmethode
- 5.1 Anlage der Untersuchung
- 5.2 Das qualitative Interview als Erhebungsinstrument
- 5.2.1 Wahl und Begründung der Erhebungsmethode
- 5.2.2 Darstellung des Erhebungsinstruments
- 5.3 Durchführung der Erhebung
- 5.4 Auswertung der Daten
- 6 Interpretation der Daten
- 7 Diskussion der Ergebnisse und Evaluation
- 7.1 Einordnung in die Fachdiskussion
- 7.2 Evaluation
- 7.2.1 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung und offene Fragen
- 7.2.2 Ausblick
- Schlussbemerkungen
- Glossar
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Alltagsorientierung, die Kindern durch die Fernsehserie „Disney's Kim Possible“ vermittelt wird. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse der Geschlechterrollen, die in der Serie dargestellt werden, und deren Rezeption durch junge Zuschauer. Die Arbeit will die Frage klären, inwiefern die Darstellung der Protagonistin Kim Possible als unabhängige und starke Heldin Einfluss auf die Geschlechteridentität von Kindern hat.
- Geschlechterrollen und -stereotype im Kinderfernsehen
- Die Bedeutung von Fernsehheldinnen für die kindliche Sozialisation
- Die Rolle von „Disney's Kim Possible“ als Beispiel für mediale Geschlechterkonstruktion
- Parasoziale Interaktion und Identifikation mit Fernsehfiguren
- Die Rezeption von „Disney's Kim Possible“ durch GrundschülerInnen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Fernsehen und Kinder“ dar und erläutert die zunehmende Bedeutung des Fernsehens als Medium für die Sozialisation von Kindern. Zudem wird die Forschungsfrage formuliert und die Forschungsmethodik kurz skizziert.
- Kapitel 2: Vorbemerkungen: Geschlecht, Geschlechterstereotype und „doing gender“ - In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe „Geschlecht“, „Geschlechterstereotype“ und „doing gender“ definiert und in den Kontext der Medienforschung gesetzt.
- Kapitel 3: Aufarbeitung des Forschungsfeldes - Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung zu den Themen „Geschlechterdifferenzen im Fernsehverhalten von GrundschülerInnen“, „Geschlechterverhältnisse im Kinderfernsehen“ und „Medial geleitete Sozialisation“. Es werden wichtige Studien und Theorien vorgestellt, die für die Untersuchung relevant sind.
- Kapitel 4: Disneys Kim Possible - Dieses Kapitel analysiert die Fernsehserie „Disney's Kim Possible“ im Hinblick auf ihre Inhalte, die Repräsentation von Geschlechterrollen und die Charakterisierung der Figuren. Es wird untersucht, wie die Serie Geschlechterbilder konstruiert und welche Botschaften sie an junge Zuschauer vermittelt.
- Kapitel 5: Untersuchungsmethode - In diesem Kapitel werden die Methoden der Datenerhebung und -auswertung vorgestellt. Es wird erläutert, warum ein qualitatives Interview als Erhebungsinstrument gewählt wurde und wie dieses im Detail aufgebaut ist.
- Kapitel 6: Interpretation der Daten - Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews mit GrundschülerInnen. Es wird untersucht, wie die Kinder die Serie „Disney's Kim Possible“ wahrnehmen und welche Bedeutung die Figuren für sie haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Kinderfernsehen, Geschlechterrollen, Mediensozialisation, parasoziale Interaktion, Identifikation, Qualitative Forschung, Interviewforschung, „Disney's Kim Possible“ und Geschlechterbilder. Sie analysiert die Serie als Beispiel für die Konstruktion von Geschlechterrollen in Medienproduktionen und untersucht die Rezeption dieser Rollen durch junge Zuschauer.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat "Kim Possible" auf das Geschlechterbild von Kindern?
Die Serie zeichnet ein Bild einer starken, kompetenten Heldin, das traditionelle Stereotype infrage stellt und Mädchen neue Identifikationsmöglichkeiten bietet.
Was bedeutet "Doing Gender" im Kinderfernsehen?
Es beschreibt, wie durch mediale Darstellungen Geschlechterrollen aktiv konstruiert und von Kindern im Alltag nachgeahmt oder verhandelt werden.
Warum identifizieren sich Kinder mit Medienhelden?
Durch parasoziale Interaktion bauen Kinder eine emotionale Bindung zu Figuren auf, die ihnen helfen, mit eigenen Emotionen und Alltagssituationen umzugehen.
Was sind die Ergebnisse der Interviews mit Grundschülerinnen?
Die Interviews zeigen, dass Mädchen die Stärke von Kim Possible wahrnehmen und diese Modelle teilweise in ihr eigenes Spiel und Selbstbild integrieren.
Wie wichtig ist das Fernsehen für die kindliche Idolfindung?
Laut Studien nennen fast die Hälfte der Kinder Personen aus Film und Fernsehen als ihre Idole, was die enorme Bedeutung medialer Vorbilder unterstreicht.
- Quote paper
- Geschlechterforscherin (M.A.), Sozialarbeiterin, -pädagogin (B.A.) Angela Wolter (Author), 2011, Fernsehheldinnen als Alltagsorientierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191534