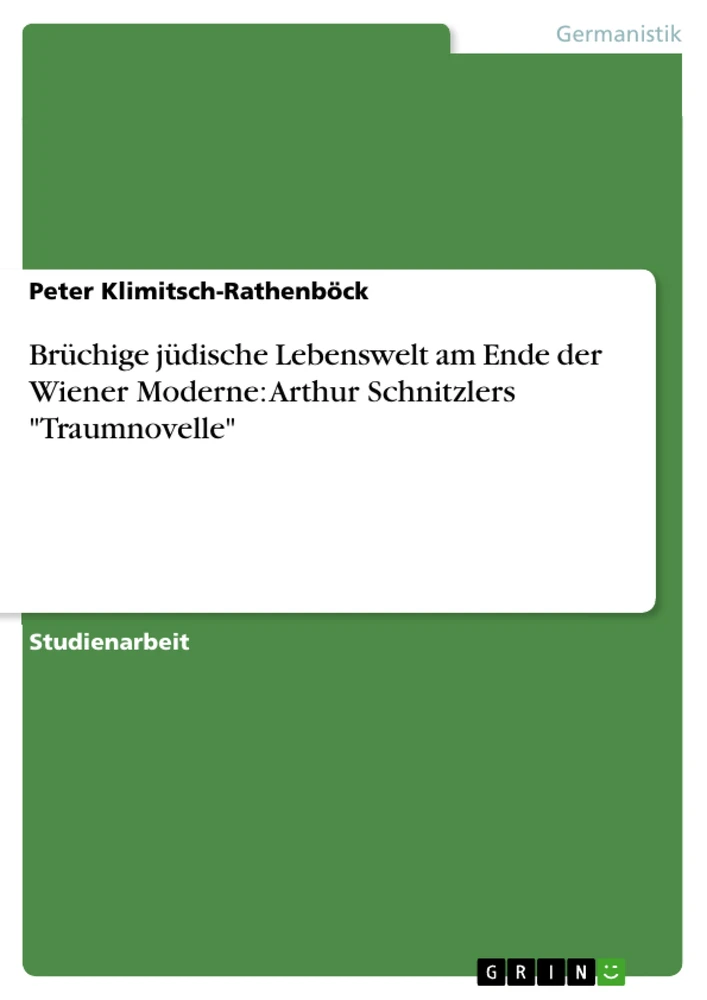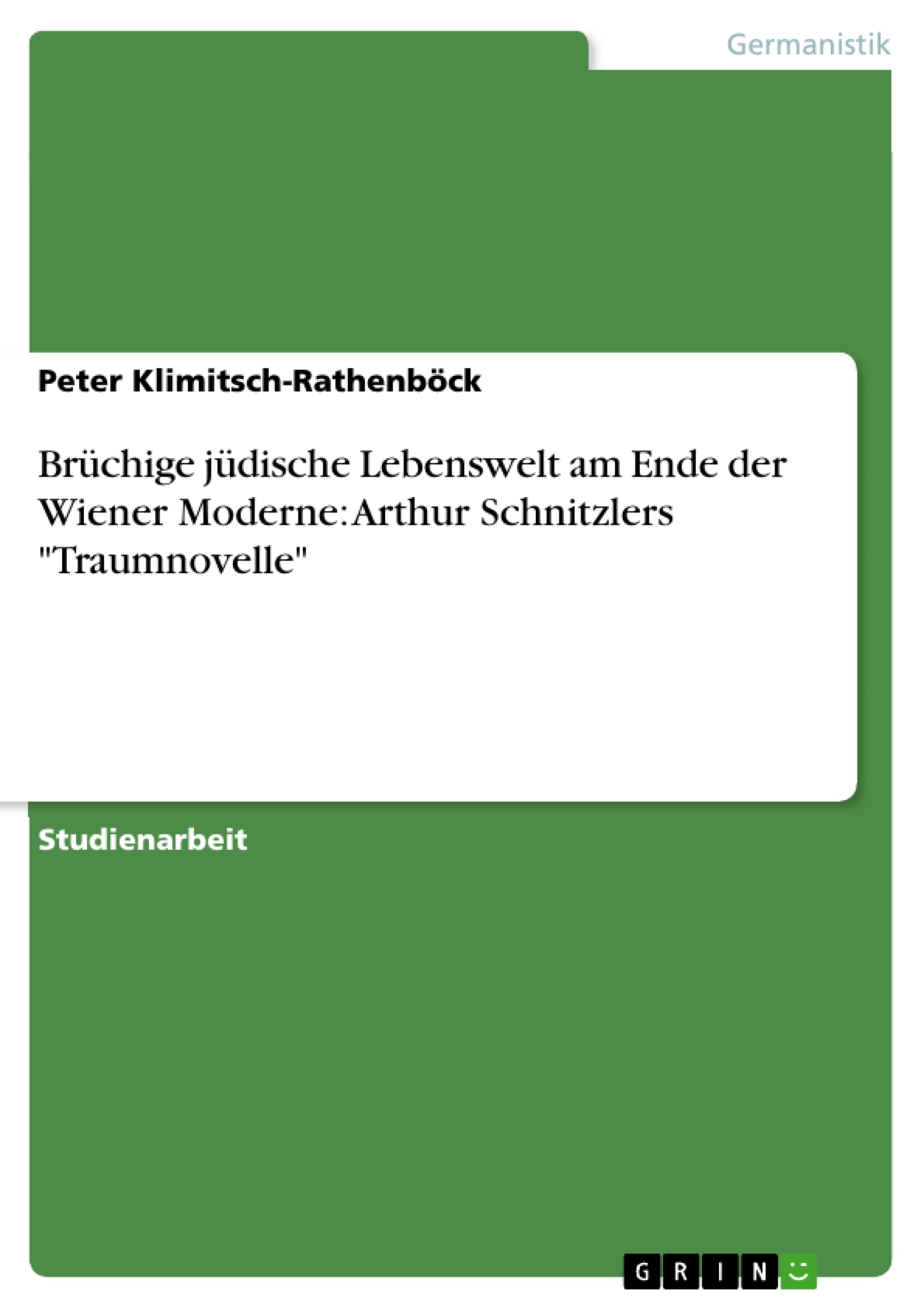In Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ wird die Ehe der beiden Protagonisten, Albertine und Fridolin, einer Prüfung unterzogen. Zentral sind dabei Fridolins Erlebnisse in der ersten Nacht und ihre Verarbeitung danach, in einer erzählten Zeit von knapp zwei Tagen sowie die Traumerzählung seiner Gattin.
Die Forschung weist vielfach darauf hin, dass zwischen den Zeitgenossen Sigmund Freud und Arthur Schnitzler eine „Doppelgängersituation“ besteht. Damit ist gemeint, dass Sigmund Freuds Entwicklungen und Forschungen im Werk von Arthur Schnitzler literarisch gespiegelt werden. Diese Verschränkung von Wissenschaft, konkret der Psychoanalyse, und Literatur wird in der Sekundärliteratur kritisch abgrenzend betrachtet und selten an konkreten Werken und ihrer Analyse bearbeitet. (...)
Die Thesen, die dieser Arbeit den roten Faden geben, lauten darum:
1.) Arthur Schnitzler schafft durch sein Erzählen an den Hauptfiguren der Novelle, dem Arzt Fridolin und seiner Gattin Albertine, eine Allegorese der Theorie von Sigmund Freud über den psychischen Apparat (Es, Ich und Über-Ich), wie sich dies in Freuds Schriften „Jenseits vom Lustprinzip“ (1920) und „Das Ich und das Es“ (1923) ausgeführt findet. Schnitzler „maskiert“ mit der Sprache seines Erzählens Freuds Instanzenmodell der Persönlichkeit und die Theorie der zwei Haupttriebe, Eros (Lebenstrieb) und Thanatos (Destruktionstrieb). Anhand einer Textstruktur- und Motivanalyse wird gezeigt, welchen Einfluss Freuds Denken auf die erzählerische Gestaltung der beiden Protagonisten hat.
2.) Der auktoriale Erzähler der Novelle tritt als „Therapeut“ auf, das Erzählverhalten zeigt Parallelen zum Handeln eines Analytikers. Schnitzler macht sich für sein Erzählen nutzbar, was Freud in seiner psychoanalytischen Praxis zugeschrieben wird: diese zeige Verwandtschaft zum Auslegen des Talmuds.
3.) Die Gestaltung der Hauptfiguren und des Erzählverhaltens verweisen auf ein jüdisches Verständnis von Ehe: Die rasch mögliche Brüchigkeit der Ehe, und wie Schnitzler von ihr erzählt, steht in der „Traumnovelle“ als Symbol für eine jüdische Lebenswelt, die unter Druck gerät. Dies wird in einzelne Motive eingebettet, die die wachsende Isolierung jüdischen Bürgertums und das Aufflackern einer deutschnationalen Haltung im Ausklang der Wiener Moderne darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“
- 2.1. Entstehung
- 2.2. Textvarianten und -ausgaben
- 2.3. Der Inhalt von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“
- 2.4. Arthur Schnitzler
- 3. Sigmund Freud und Arthur Schnitzler
- 3.1. Sigmund Freud und die Psychoanalyse
- 3.1.1. Das Persönlichkeitsmodell von Sigmund Freud
- 3.1.2. Der Traum, Traumbildung und Traumdeutung
- 3.2. Zwei Zeitgenossen in einer „Art von Doppelgängerscheu“
- 4. Das poetische Sein der Psychoanalyse: Motive und Erzählverhalten in der „Traumnovelle“
- 4.1. Verführbarkeit in Sprache und Erzählstruktur: Die Darstellung der Ehe
- 4.2. Der Tod und das Mädchen: Fridolin am Beginn seiner Reise
- 4.3. Fridolins Reise durch die erste Nacht
- 4.4. Die geheime Gesellschaft am Galitzinberg
- 4.5. Albertines Traum
- 5. Der Erzähler als „Therapeut“
- 6. Das jüdische Leben in Wien um die Jahrhundertwende
- 6.1. Die jüdische Ehe als Symbol
- 6.2. Das andere jüdische Leben: Nachtigall
- 6.3. Das Aufflackern des Deutschnationalen in der „Traumnovelle“
- 7. Standpunkte: Psychoanalyse und ihr Einfluss auf die „Traumnovelle“
- 8. Innerlichkeit erzeugt eine Diagnose der Lebenswelt: Eine Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ in Bezug auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Sie untersucht, inwiefern Freuds Theorien über den psychischen Apparat, den Traum und die Triebe im Werk Schnitzlers literarisch umgesetzt werden.
- Der Einfluss von Freuds Instanzenmodell (Es, Ich und Über-Ich) auf die Gestaltung der Hauptfiguren
- Die Rolle des auktorialen Erzählers als „Therapeut“ und Parallelen zum Handeln eines Analytikers
- Das jüdische Verständnis von Ehe als Symbol für eine brüchige Lebenswelt in Wien um die Jahrhundertwende
- Die wachsende Isolierung des jüdischen Bürgertums und das Aufflackern deutschnationaler Tendenzen
- Die Verbindung von Psychoanalyse und Literatur in Schnitzlers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Entstehungsgeschichte der „Traumnovelle“ und skizziert verschiedene Textvarianten und Ausgaben. Der Inhalt der Novelle wird kurz zusammengefasst.
Kapitel 3 thematisiert die Beziehung zwischen Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Freuds Psychoanalyse und seine Theorien, insbesondere das Persönlichkeitsmodell und die Traumdeutung, werden vorgestellt.
Kapitel 4 analysiert, wie Schnitzler Freuds Psychoanalyse in der „Traumnovelle“ literarisch verarbeitet. Es werden Motive und das Erzählverhalten der Novelle im Hinblick auf Freuds Ideen untersucht.
Kapitel 5 zeigt die Funktion des Erzählers als „Therapeut“ in der „Traumnovelle“ auf.
Kapitel 6 beleuchtet das jüdische Leben in Wien um die Jahrhundertwende und analysiert die Bedeutung der Ehe in diesem Kontext.
Kapitel 7 diskutiert die Beziehung zwischen Psychoanalyse und Literatur in der „Traumnovelle“.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, „Traumnovelle“, Sigmund Freud, Psychoanalyse, Instanzenmodell, Traumdeutung, Es, Ich, Über-Ich, Triebe, Eros, Thanatos, Ehe, jüdisches Leben, Wien, Jahrhundertwende, deutschnationale Tendenzen, Isolierung, Erzählverhalten, Therapeut.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat Sigmund Freud auf Schnitzlers "Traumnovelle"?
Die Novelle spiegelt Freuds Instanzenmodell (Es, Ich, Über-Ich) und seine Theorien zu Trieben (Eros und Thanatos) sowie zur Traumdeutung literarisch wider.
Inwiefern tritt der Erzähler als "Therapeut" auf?
Das Erzählverhalten zeigt Parallelen zur psychoanalytischen Praxis, indem es die inneren Vorgänge und Träume der Protagonisten wie in einer Analyse freilegt.
Was symbolisiert die Ehe von Fridolin und Albertine?
Die Brüchigkeit ihrer Ehe steht symbolisch für die bedrohte jüdische Lebenswelt im Wien der Jahrhundertwende.
Welche gesellschaftlichen Strömungen werden in der Novelle thematisiert?
Schnitzler thematisiert die wachsende Isolierung des jüdischen Bürgertums und das Aufkommen deutschnationaler Haltungen am Ende der Wiener Moderne.
Was ist mit der "Doppelgängersituation" zwischen Schnitzler und Freud gemeint?
Es beschreibt das Phänomen, dass Schnitzler zeitgleich zu Freuds wissenschaftlichen Entdeckungen dieselben psychologischen Tiefen literarisch erforschte.
- Citar trabajo
- Peter Klimitsch-Rathenböck (Autor), 2010, Brüchige jüdische Lebenswelt am Ende der Wiener Moderne: Arthur Schnitzlers "Traumnovelle", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191655