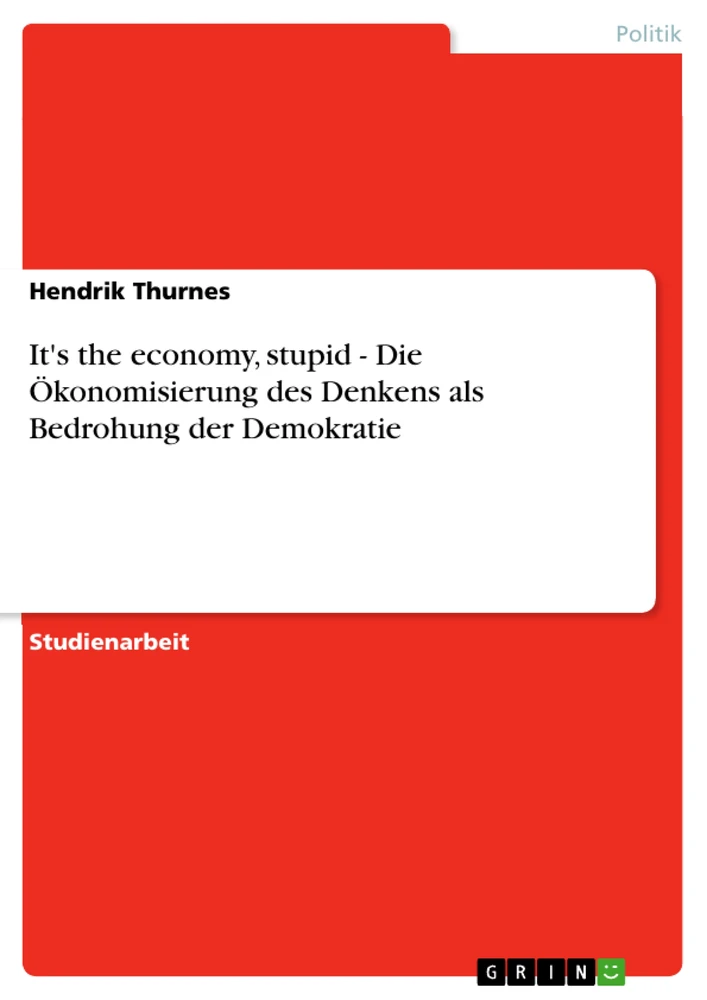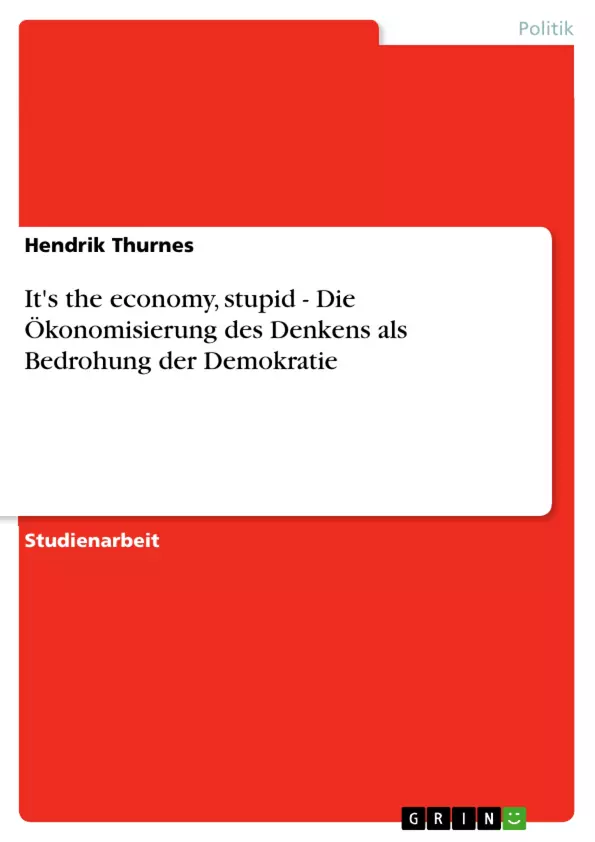Die Demokratie wird bedroht. Sie wird bedroht von ihren Feinden in Form von Organisierter Kriminalität und extremistischen, undemokratischen Gruppierungen, sowie den freiheitseinschränkenden Gesetzen, die als Reaktion darauf erlassen werden. Sie wird bedroht durch dysfunktionale demographische Entwicklungen, manipulative Medien, Populismus, Politikverdrossenheit, Lobbyismus und grotesk gestiegene gesellschaftliche Komplexität. Sie wird weiter bedroht durch Auswirkungen von Inter-, Trans- und Supranationalisierung, die zunehmend die demokratische Grundidee der Übereinstimmung von Regierten und Regierenden nicht nur hinterfragen, sondern ad absurdum führen. Vor allem aber wird die Demokratie bedroht, wie sich in der wirtschaftlichen Krisenlastigkeit der letzten Jahre scheinbar schonungslos offenbarte, durch einen entfesselten Kapitalismus, der vermeintlich unaufhaltsam die Lebensgrundlagen eines Großteils der Bevölkerung und damit die materielle Basis für ihre demokratische Betätigung vernichtet.
Der Ökonomisierung des Denkens soll im Folgenden das Hauptaugenmerk gewidmet werden, denn „[g]anz offenbar nehmen sich westliche Demokratien so dominant über ökonomische Indikatoren wahr, dass diese zur Veränderung politischer Präferenzen privilegiert beachtet werden. Sie geben sich selbst vor allem anhand ökonomischer Indikatoren Rechenschaft über das eigene Wohlbefinden (well-being) und verkürzen dieses auf „Wohlstand“ (wealth)“. Bleibt nun der
wahrgenommene, gewohnte Zuwachs an Wohlstand aus oder kommt es sogar zu einer Reduktion desselben, werden gleichzeitig die Grundwerte des politischen Systems in Frage gestellt, so die These dieser Arbeit. Hierbei geht es also nicht um eine tatsächliche Veränderung des Wohlstands oder der Wirtschaftskraft einer Gesellschaft, sondern vielmehr um die Perzeption derselben.
Katalysiert wird diese Bedrohung der Demokratie, so die zweite These, durch ein Aufstreben nicht-demokratischer Staaten wie China und Russland, das in der Wahrnehmung westlicher Demokratien verbunden ist mit einem weiteren, zumindest relativen Wohlstandsverlust und dadurch mit dem Infragestellen der Demokratie als bester Herrschaftsform. Damit stellt sich automatisch die Frage, ob die westlich-liberalen Demokratien die jetzige Phase einer Umverteilung von Wohlstand zum eigenen Nachteil als Demokratien überstehen können und ob „nicht vielmehr einer wie auch immer autoritär regulierten Gesellschaft die Zukunft“ gehört.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Übergang zur Legitimation durch Wohlstand
- 3. Die Ökonomisierung des Denkens
- 3.1 Begriff und Möglichkeit
- 3.2 Ausmaß und Effekte
- 3.3 Das BIP als universeller Maßstab von Gesellschaften
- 4. (Un-)Zufriedenheit mit dem demokratischen System
- 5. Die Renaissance der Autokratie?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, dass die Ökonomisierung des Denkens eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Sie analysiert den Wandel der Legitimation demokratischer Systeme hin zu einer starken Fokussierung auf wirtschaftlichen Wohlstand und die damit verbundenen Risiken. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre und den Wettbewerb zwischen demokratischen und autokratischen Systemen.
- Der Übergang von der Legitimation durch Partizipation zur Legitimation durch Wohlstand
- Die Ökonomisierung des Denkens: Begriff, Ausmaß und Effekte
- Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als dominierender Maßstab gesellschaftlichen Erfolgs
- Die Auswirkungen von Wohlstandsveränderungen auf die Zufriedenheit mit dem demokratischen System
- Der Systemwettbewerb zwischen westlichen Demokratien und aufstrebenden autokratischen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bedrohung der Demokratie ein, wobei insbesondere der Einfluss des Kapitalismus und die Ökonomisierung des Denkens hervorgehoben werden. Die Arbeit stellt die These auf, dass nicht der Kapitalismus an sich, sondern die Wahrnehmung und Reaktion darauf die Demokratie gefährdet. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Wahrnehmung von Wohlstand und dessen Einfluss auf die Legitimation des demokratischen Systems. Die Bedeutung der Perzeption von Wohlstand und nicht des tatsächlichen Wohlstands wird als zentraler Punkt der Argumentation herausgestellt. Der Wettbewerb mit nicht-demokratischen Staaten wie China und Russland wird als katalysierender Faktor für die Infragestellung der Demokratie identifiziert.
2. Der Übergang zur Legitimation durch Wohlstand: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Legitimation demokratischer Systeme. Es unterscheidet zwischen republikanischer und liberaler Legitimität und verortet den Bedeutungswandel im Kontext der Aufklärung und der Entwicklung des Kapitalismus. Die zunehmende Verknüpfung von Fortschritt mit wirtschaftlichem Wachstum und die damit verbundene Betonung der Output-Dimension (Wohlstand) im Vergleich zur Input-Dimension (Partizipation) werden detailliert beschrieben. Die Arbeit zeigt auf, wie die Steigerung gesellschaftlicher Wohlfahrt zur Aufgabe des Staates wurde und wie diese im Kontext des Kalten Krieges zunehmend auf Wohlstand reduziert wurde, was zu einer Legitimation durch Wohlstand führte.
Schlüsselwörter
Demokratie, Ökonomisierung des Denkens, Legitimation, Wohlstand, Kapitalismus, Systemkonkurrenz, BIP, Autokratie, Partizipation, Krisen, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die These, dass die Ökonomisierung des Denkens eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Im Mittelpunkt steht der Wandel der Legitimation demokratischer Systeme hin zu einer starken Fokussierung auf wirtschaftlichen Wohlstand und die damit verbundenen Risiken. Dabei wird der Einfluss wirtschaftlicher Krisen und der Wettbewerb zwischen demokratischen und autokratischen Systemen analysiert.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These vor. Kapitel 2 analysiert den Übergang von der Legitimation durch Partizipation zur Legitimation durch Wohlstand. Kapitel 3 befasst sich mit der Ökonomisierung des Denkens – Begriff, Ausmaß und Effekte, inklusive der Rolle des BIP. Kapitel 4 untersucht die (Un-)Zufriedenheit mit dem demokratischen System im Kontext von Wohlstand. Kapitel 5 thematisiert die Renaissance der Autokratie im Systemwettbewerb. Kapitel 6 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Was versteht der Text unter „Ökonomisierung des Denkens“?
Der Text untersucht die Ökonomisierung des Denkens als einen Prozess, bei dem ökonomische Kategorien und Denkweisen dominierend werden und andere gesellschaftliche Bereiche beeinflussen. Es wird analysiert, wie sich dies auf die Bewertung und Legitimation von politischen Systemen auswirkt.
Welche Rolle spielt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Text?
Das BIP wird als dominierender Maßstab gesellschaftlichen Erfolgs dargestellt und kritisch hinterfragt. Der Text analysiert, wie die Fixierung auf das BIP die Wahrnehmung von Wohlstand und damit die Legitimation demokratischer Systeme beeinflusst.
Wie wird die Legitimation demokratischer Systeme im Text betrachtet?
Der Text unterscheidet zwischen republikanischer und liberaler Legitimität und analysiert den Bedeutungswandel im Kontext der Aufklärung und der Entwicklung des Kapitalismus. Es wird aufgezeigt, wie die Legitimation zunehmend an wirtschaftlichen Wohlstand gekoppelt wurde und die Bedeutung von Partizipation zurücktrat.
Welchen Einfluss haben wirtschaftliche Krisen auf die Demokratie?
Der Text untersucht die Auswirkungen wirtschaftlicher Krisen auf die Zufriedenheit mit dem demokratischen System und die damit verbundenen Herausforderungen für die demokratische Legitimität. Diese Krisen werden als Katalysatoren für die Infragestellung der Demokratie dargestellt.
Wie wird der Systemwettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien dargestellt?
Der Text beleuchtet den Systemwettbewerb zwischen westlichen Demokratien und aufstrebenden autokratischen Staaten, insbesondere China und Russland, als einen wichtigen Faktor, der die Infragestellung der Demokratie in westlichen Ländern verstärkt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Demokratie, Ökonomisierung des Denkens, Legitimation, Wohlstand, Kapitalismus, Systemkonkurrenz, BIP, Autokratie, Partizipation, Krisen und Wahrnehmung.
Was ist die zentrale These des Autors?
Die zentrale These des Autors ist, dass die Ökonomisierung des Denkens, nicht der Kapitalismus an sich, eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Die Fokussierung auf wirtschaftlichen Wohlstand als Maßstab für Legitimität gefährdet die demokratischen Systeme.
- Citation du texte
- B.A. Politikwissenschaft Hendrik Thurnes (Auteur), 2012, It's the economy, stupid - Die Ökonomisierung des Denkens als Bedrohung der Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191677