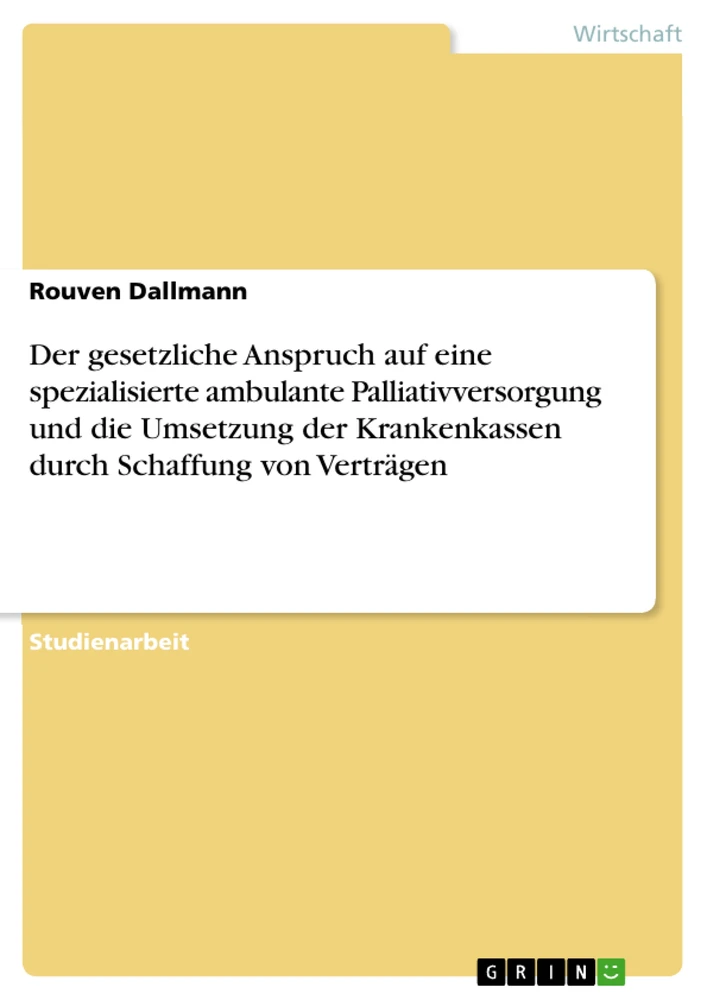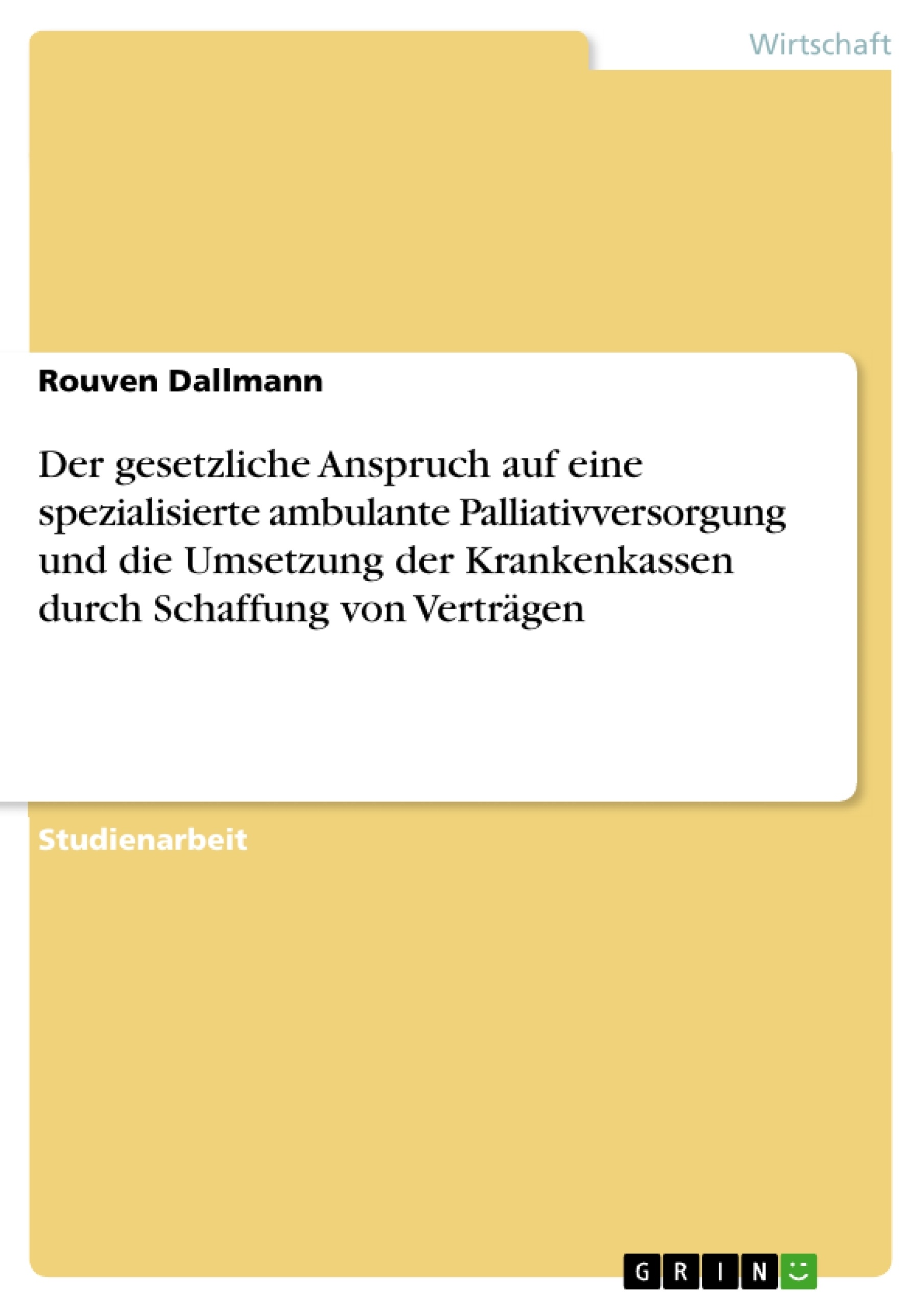Motivation: Aufgrund erheblicher Defizite in der ambulanten palliativmedizinischen Versorgung, die im letzten Jahrzehnt durch verschiedene Kommissionen des Bundes und der Länder festgestellt wurde, beschloss die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD, den Anspruch auf eine ambulante Versorgung von unheilbar kranken Menschen gesetzlich festzuhalten. Fragestellung: Die Arbeit stellt die spezialisierte ambulante Palliativversorgung vor und zeigt deren Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird untersucht, ob eine flächendeckende Versorgung mit SAPV nach derzeitigem Stand vorhanden ist. Methodik: Die in dieser Arbeit verwendete Literatur wurde durch eine Literaturrecherche mithilfe der WISO-Fachdatenbank beschafft. Ergebnisse: Nach eingehender Betrachtung wird festgestellt, dass die SAPV ein geeignetes Instrument ist, um Menschen einen würdigen Tod in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. Die Umsetzung der SAPV erfolgt durch Schaffung freiwilliger Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, den sogenannten Palliative Care Teams. Die Arbeit stellt den Stand der Umsetzung in den Bundesländern dar und zeigt dabei teils erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Auf das gesamte Bundesgebiet bezogen, sind bis heute nicht genug Verträge abgeschlossen worden, um eine flächendeckende Erbringung von SAPV gewährleisten zu können. Die primären Ursachen dafür sind das mangelnden Engagement vieler Krankenkassen sowie die hohen Teilnahmeanforderungen der SAPV. Trotz der derzeit noch unvollständigen Umsetzung, lässt sich anhand verschiedener Kennzahlen allerdings ein Aufwärtstrend erkennen. Implikationen: Wie von Vertretern der Leistungserbringer gefordert, könnte das jetzige System auf Basis freiwilliger Verträge durch einen verpflichtenden Kollektivvertrag ersetzt werden. Auch eine Neuregelung der Teilnahmeanforderungen könnte die Schaffung von SAPV-Verträgen fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Methodik
- Ambulante Palliativversorgung in Deutschland
- Allgemeine ambulante Palliativversorgung
- Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
- Rechtsgrundlage und Anspruch auf SAPV
- Erbringung der SAPV
- Leistungen der SAPV
- Vergütung und Abrechnung
- Umsetzung der SAPV durch die Krankenkassen
- Übersicht
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Nordrhein
- Westfalen-Lippe
- Rheinland-Pfalz und Saarland
- Sachsen und Thüringen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Kritische Würdigung der SAPV-Umsetzung
- Zurückhaltung der Krankenkassen
- Kritik an den Qualitätsanforderungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den gesetzlich verankerten Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) am Lebensende und dessen Umsetzung durch die Krankenkassen. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der SAPV und analysiert, wie die Krankenkassen in den verschiedenen Bundesländern die Umsetzung des Anspruchs gestalten.
- Rechtsgrundlage und Anspruch auf SAPV
- Umsetzung der SAPV durch die Krankenkassen
- Kritische Würdigung der SAPV-Umsetzung
- Modelle der SAPV-Versorgung in den Bundesländern
- Herausforderungen und Perspektiven der SAPV
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der ambulanten Palliativversorgung in Deutschland ein und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der SAPV. Kapitel 2 befasst sich mit der Methodik der Arbeit. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Modelle der SAPV-Versorgung in den Bundesländern untersucht. Kapitel 4 widmet sich einer kritischen Würdigung der SAPV-Umsetzung und analysiert die Herausforderungen und Perspektiven der SAPV. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), Palliativmedizin, Lebensende, Krankenkassen, Verträge, Qualitätsanforderungen, Rechtliche Grundlagen, Bundesländer, Versorgung, Herausforderungen, Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet SAPV?
SAPV steht für Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung. Sie dient dazu, unheilbar kranken Menschen am Lebensende eine medizinische und pflegerische Betreuung in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.
Wer hat einen gesetzlichen Anspruch auf SAPV?
Menschen mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigen, haben einen gesetzlich verankerten Anspruch gegenüber ihrer Krankenkasse.
Wie wird die SAPV in Deutschland umgesetzt?
Die Umsetzung erfolgt durch den Abschluss von Verträgen zwischen den Krankenkassen und spezialisierten Leistungserbringern, den sogenannten Palliative Care Teams (PCT).
Ist eine flächendeckende Versorgung mit SAPV in Deutschland gewährleistet?
Nein, derzeit gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. In vielen Regionen fehlen noch ausreichend Verträge, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen.
Was sind die Hauptgründe für die lückenhafte Umsetzung der SAPV?
Kritisiert werden vor allem das mangelnde Engagement einiger Krankenkassen sowie die sehr hohen personellen und qualitativen Anforderungen an die Palliative Care Teams.
- Quote paper
- Rouven Dallmann (Author), 2011, Der gesetzliche Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung und die Umsetzung der Krankenkassen durch Schaffung von Verträgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191681