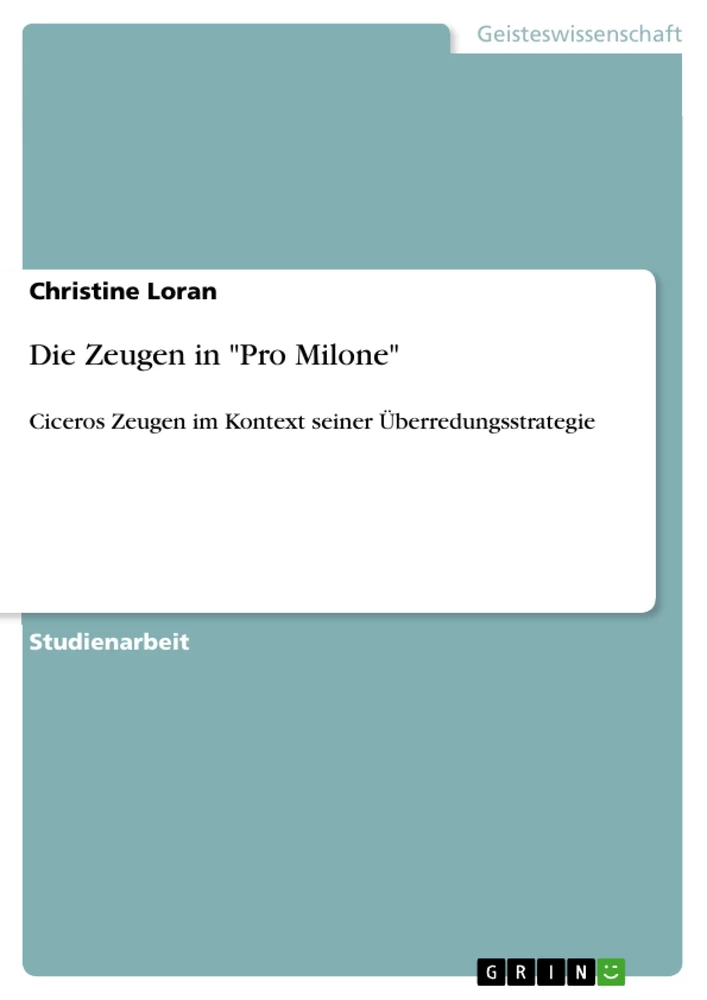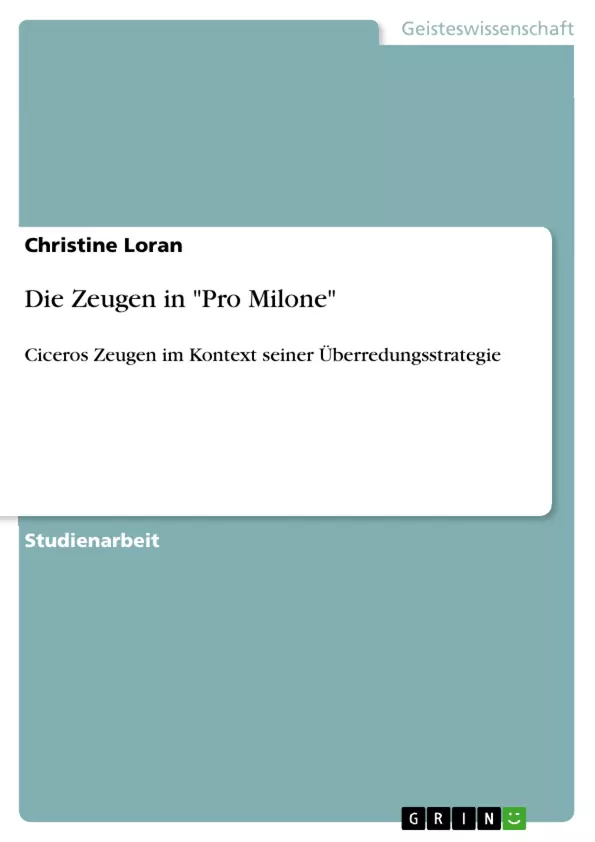I. Einleitung
„Manet autem illa quoque excepta eius oratio: scripsit vero hanc quam legimus ita perfecte ut iure prima haberi possit.“
Zu diesem Urteil kam Asconius bei seinem Kommentar der ciceronischen Rede Pro Milone. Verwunderlich ist allerdings, dass Marcus Tullius Cicero mit dieser, seiner vermeintlich besten Rede den Prozess nicht gewinnen konnte und sein Klient Titus Annius Milo in die Verbannung geschickt wurde. Bei Asconius lassen sich zwei erklärende Umstände finden. Zum einen sei Cicero, da er durch das Geschrei des Mobs irritiert und durch die pompeianischen Truppen eingeschüchtert war, nicht mit seiner üblichen constantia aufgetreten und konnte daher nicht, wie gewöhnlich, mit seinem Verteidigungsplädoyer brillieren. Zum anderen deutet Asconius an, dass es zwei Versionen von Pro Milone gegeben habe – die tatsächlich gehaltene sowie eine überarbeitete und veröffentlichte, die uns vorzuliegen scheint. Die These von den zwei Versionen wird bis heute kontrovers diskutiert. Neumeister, der von einer Aus-, aber nicht Umarbeitung der Rede ausgeht, stellt allerdings treffend fest, dass bei einer rhetorischen Untersuchungen diese Frage von sekundärer Bedeutung sei und die überlieferte Fassung wie eine tatsächlich gehaltene Rede zu betrachten sei. Bei seiner sehr facettenreichen Interpretation der Miloniana geht Neumeister von der Rede als einem planvollen Überredungsprozess aus, dessen „verborgene Ordnung [und] taktische[r] Plan ans Tageslicht“ gebracht werden muss. Dabei habe „jeder Teil, jeder Satz, jede Darstellungsform eine bestimmte Funktion“. Die rhetorische Gesamtstrategie wurde von mehreren Autoren, am prominentesten wohl von Neumeister, behandelt. Besonders
konzentrierte man sich auf die rhetorische Gesamtkonzeption der Rede. Bei Schmitz findet sich die Fokussierung auf ein entscheidendes Detail der Prozessreden, nämlich die Darstellung der
gegnerischen Zeugen. Diese seien entsprechend der rhetorischen Theorie charakterisiert und fügten sich in Ciceros allgemeine Strategie ein. Die vorliegende Arbeit möchte nun die Zeugen der Verteidigung, also die Ciceros, unter diesen beiden Gesichtspunkten der Theorie und der Strategie betrachten. In Asconius‘ Bericht und Kommentar zu Pro Milone findet sich keine Nennung von Zeugen der Verteidigung. Offenbar hatten sich die Anwälte Milos mit Kreuzverhören der gegnerischen Zeugen begnügt. Doch dies hielt Cicero in seiner Rede nicht davon ab, Zeugen für seine Argumente zu benennen oder gar aufzurufen...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Theoretische Grundlagen: Zeugen in der rhetorischen Theorie
- III. Die causa der Miloniana und ihre Hintergründe
- IV. Ciceros Zeugen in den einzelnen Teilen der Rede
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle von Zeugen in Ciceros Gerichtsrede Pro Milone. Ziel ist es, die Verwendung von Zeugen im Kontext der rhetorischen Theorie sowie Ciceros Überredungsstrategie zu untersuchen.
- Die theoretischen Grundlagen zur Verwendung von Zeugen in der römischen Rhetorik
- Die Hintergründe des Prozesses gegen Milo und die Umstände der Tat
- Die Verwendung von Zeugen durch Cicero in den verschiedenen Teilen der Rede
- Die Relevanz der Zeugen für Ciceros Überredungsstrategie
- Die Einordnung von Zeugen in die Gesamtkonzeption der Rede
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung
Die Einleitung stellt die Rede Pro Milone als vermeintlich beste Rede Ciceros vor, die jedoch zu Milos Verbannung führte. Asconius' Kommentar zur Rede wird als Ausgangspunkt für die Analyse der Rede genommen und die Frage nach zwei Versionen der Rede wird aufgeworfen. Die Arbeit konzentriert sich auf die überlieferte Fassung der Rede und betrachtet sie als planvollen Überredungsprozess.
II. Theoretische Grundlagen: Zeugen in der rhetorischen Theorie
Dieser Abschnitt erläutert die fünf Abschnitte der Redeproduktion und fokussiert auf die Inventio, den Schritt der Argumentfindung. Dabei werden die verschiedenen Arten von Argumentationsmitteln, die topoi oder loci, vorgestellt. Die Unterscheidung zwischen unkünstlichen und künstlichen Beweisen, wobei die Zeugenaussagen zu den unkünstlichen Beweisen gehören, wird behandelt.
III. Die causa der Miloniana und ihre Hintergründe
Dieser Abschnitt schildert den Hintergrund des Prozesses gegen Milo. Er beleuchtet die Auseinandersetzung zwischen Milo und Clodius, die zum Mord an Clodius führte. Die Unruhen in Rom nach dem Mord und die damit verbundenen politischen Hintergründe werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rhetorik, Gerichtsrede, Zeugen, Pro Milone, Cicero, Überredungsstrategie, Testimonia, Inventio, loci, unkünstliche Beweise, künstliche Beweise, causa, Miloniana, Clodius, Milo, Prozess, Rom, Republik, Anwalt, Verteidigung, Anklage.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ciceros Rede „Pro Milone“?
Es handelt sich um eine Verteidigungsrede für Titus Annius Milo, der beschuldigt wurde, seinen politischen Gegner Publius Clodius Pulcher ermordet zu haben.
Warum verlor Cicero den Prozess trotz einer „perfekten“ Rede?
Laut Asconius war Cicero durch den Mob und pompeianische Truppen eingeschüchtert. Zudem weicht die uns vorliegende schriftliche Fassung vermutlich von der tatsächlich gehaltenen Rede ab.
Welche Rolle spielen Zeugen in der rhetorischen Theorie?
Zeugenaussagen gehören zu den „unkünstlichen Beweisen“ (atechnoi pisteis), die der Redner in seiner Inventio (Argumentfindung) nutzt.
Hatte Milo tatsächlich eigene Zeugen aufgerufen?
In den Berichten findet sich keine Nennung von Verteidigungszeugen; Cicero benutzte in seiner Rede jedoch rhetorische Strategien, um auf Zeugen Bezug zu nehmen.
Was ist der Unterschied zwischen künstlichen und unkünstlichen Beweisen?
Künstliche Beweise werden durch die Logik des Redners erschaffen, unkünstliche Beweise sind vorgegebene Fakten wie Gesetze, Verträge oder eben Zeugenaussagen.
Wer war Publius Clodius Pulcher?
Er war ein einflussreicher plebejischer Politiker und der Erzfeind Ciceros und Milos, dessen Tod zu massiven Unruhen in Rom führte.
- Citation du texte
- Christine Loran (Auteur), 2009, Die Zeugen in "Pro Milone", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191786