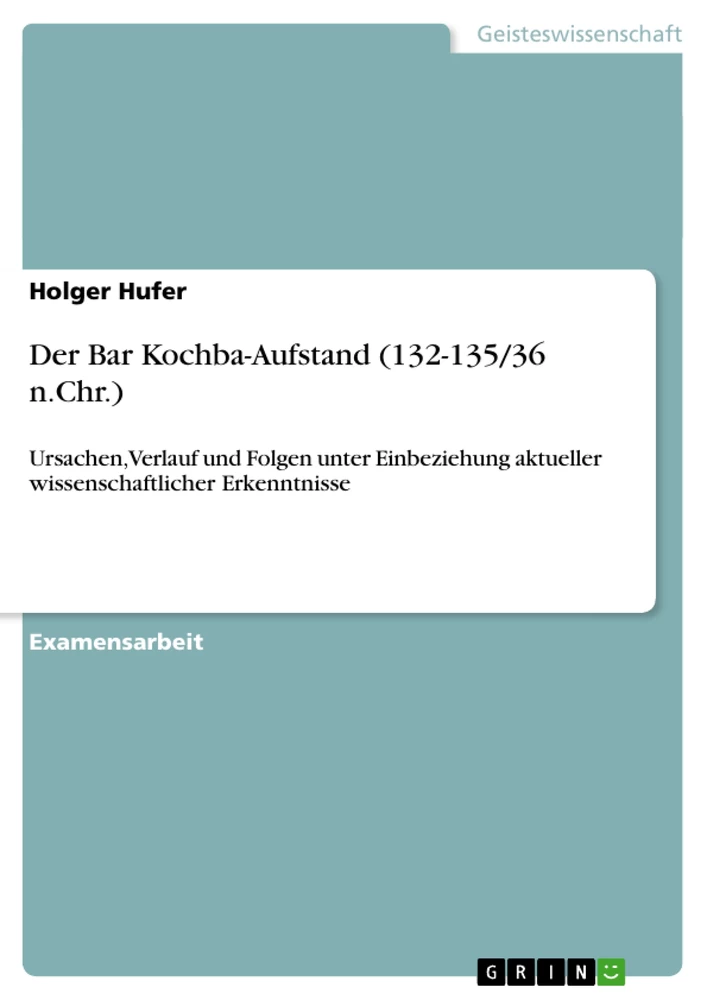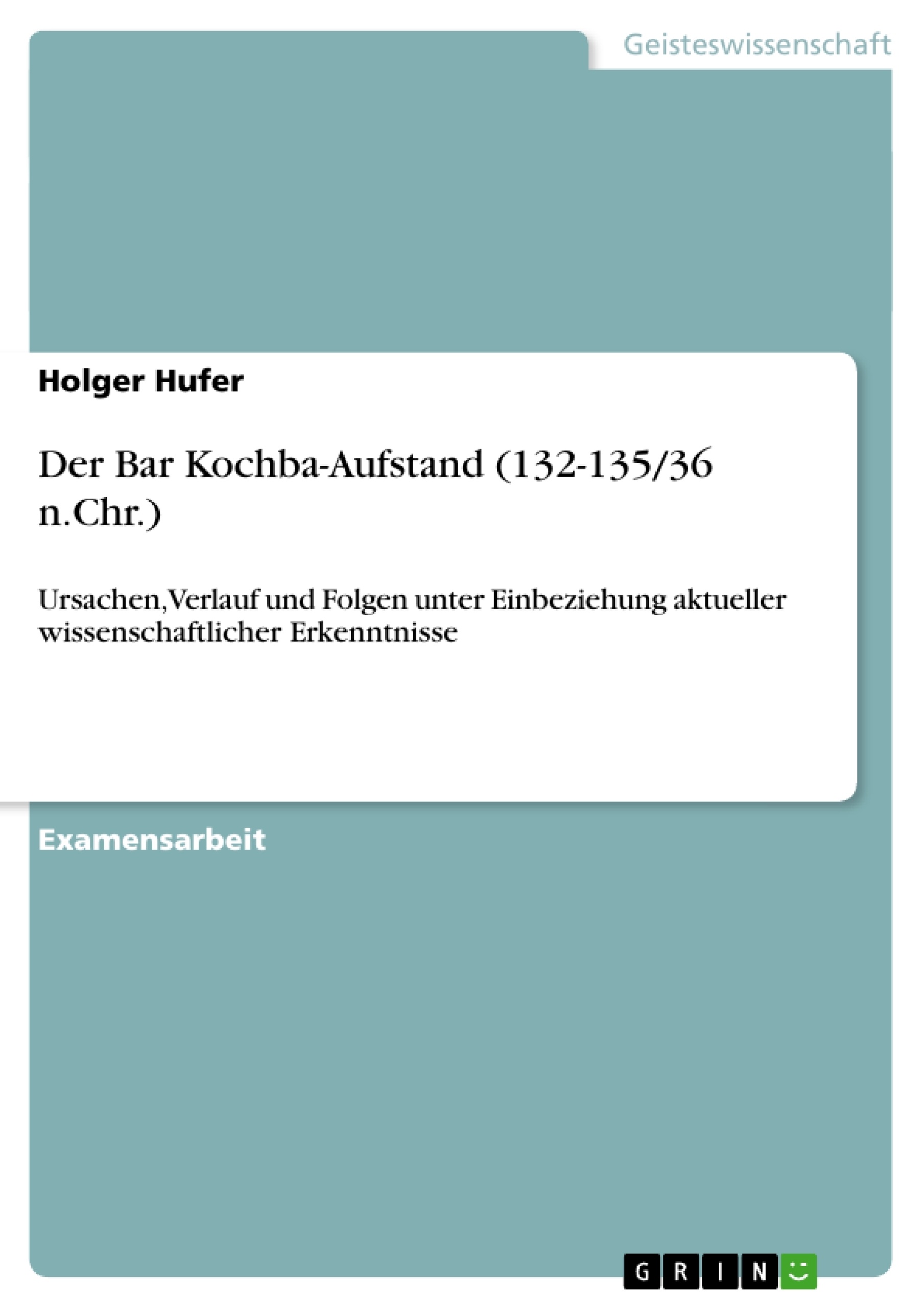„Bar Kochba war ein Held, der keine Niederlage kennen wollte. Als der Sieg ihn verließ, wusste er zu sterben. Bar Kochba ist die letzte weltgeschichtliche Verkörperung des kriegsharten waffenfrohen Judentums. Sich unter Bar Kochbas Anrufung zu stellen, verrät Ehrgeiz.“
(Max Nordau, 1909)
Dieses Zitat entstammt Max Nordaus Zionistischen Schriften aus dem Jahr 1909 und wurde seinerseits, der er, Mitbegründer der Zionistischen Weltorganisation, Schriftsteller und Politiker, gleichermaßen als Vertreter des sogenannten Muskeljudentums des beginnenden 20. Jahrhunderts galt, anlässlich der Gründungsfeier eines jüdischen Turnvereins in Berlin, welcher den Namen „Bar Kochba(r)“ trug, erstmalig verwendet. Neben den obligatorischen Segenswünschen, der Verein möge in Zukunft „blühen und gedeihen und zu einem an allen Mittelpunkten jüdischen Lebens eifrig nachgeahmten Vorbilde werden“, impliziert dieses Zitat eine Bezugnahme auf die Person Bar Kochbas, welcher in seiner historischen Einordnung noch immer im Zwiespalt betrachtet wird. In der Namensgebung des Turnvereins wurde ein Rückgriff vollzogen auf eine als ruhmreich verklärte jüdische Vergangenheit, für die Bar Kochba als Mann der Stärke zur damaligen Zeit stand und welche als mentale Akquirierung die Geschicke der Vereinsmitglieder stärken sollte. Der zeitgenössische deutsch-jüdische Historiker für Neuere Geschichte und Politologe an der Bundeswehruniversität München, Michael Wolffsohn, betont, dass in der jüdisch-israelischen Geschichtsschreibung bzw. in den offiziellen israelischen Schulbüchern die Person Bar Kochba noch heute als eine Art „Held“ dargestellt wird. Die römischen bzw. frühchristlichen Historiographen hingegen stellen seine Person, seine Strenge gegenüber seinen Anhängern, seine Skrupellosigkeit und Grausamkeit heraus und zeichnen ein entgegengesetztes, von messianischem Fanatismus geprägtes Bild dieser bislang eher in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stiefmütterlich behandelten historischen Persönlichkeit. Unter anderem der Persönlichkeitsaspekt und die messianische Intention Bar Kochbas sollen in dieser Arbeit ebenfalls in kritischen Kontext thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Vorgeschichte: Judäa und die Diasporajuden seit dem Fall Jerusalems 70 n. Chr.
- 1.1 Die Provinz Judaea nach der Katastrophe – Die Folgen des Ersten Jüdischen Krieges (66-73 n. Chr.)
- 1.2 Der Aufstand der Diasporajuden (115-117 n. Chr.)
- 2. Kritische Reflexion möglicher Ursachen der Bar Kochba-Erhebung
- 2.1 Die Neugründung Jerusalems als römische Garnisonsstadt Aelia Capitolina
- 2.2 Das Beschneidungsverbot Hadrians
- 3. Der Messianismus in der Person Bar Kochbas als auslösendes Moment?
- 3.1 Die historische Persönlichkeit Bar Kochba
- 3.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem messianischen Anspruch Bar Kochbas
- 3.3 Bar Kochbas Beziehung zu den Rabbinen
- 4. Der Bar Kochba-Aufstand – Die für das römische Heer verlustreichen Anfänge
- 4.1 Römische Verluste anhand der Auswertung von Militärdiplomen
- 4.1.1 Militärdiplome für Auxiliarverbände
- 4.1.2 Flottendiplome der classis Misenensis
- 4.2 Der Ausbruch des Aufstands - Historische Einordnung und Quellenlage
- 4.3 Hinweise zum Aufstandsablauf aus historiographischen Quellen
- 4.4 Außergewöhnliche Notmaßnahmen der römischen Administration
- 4.4.1 Zwangsaushebungen im italischen Kernland
- 4.4.2 Atypische Versetzungsmaßnahmen innerhalb des römischen Militärapparats und die Akklamation Hadrians
- 4.5 Indizien für die Vernichtung einer gesamten Legion
- 4.1 Römische Verluste anhand der Auswertung von Militärdiplomen
- 5. Das Ende des Aufstand bis zum Fall von Bethar und die Folgen für die Provinz Judaea und die Juden
- 5.1 Wiederaufbaumaßnahmen am Tempel als Streitpunkt der Wissenschaft und die Bedeutung der Beteiligung von Fremdvölkern am Aufstand
- 5.2 Das Aufstandsgebiet aus geographisch-territorialen Gesichtspunkten und anhand von Münzzeugnissen
- 5.3 Die unmittelbaren Folgen für Judaea und seine Bewohner
- 1. Die Vorgeschichte: Judäa und die Diasporajuden seit dem Fall Jerusalems 70 n. Chr.
- III. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Bar Kochba-Aufstand (132-135/36 n. Chr.) und analysiert dessen Ursachen, Verlauf und Folgen unter Einbezug aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse. Der Fokus liegt dabei auf der Betrachtung des Aufstands aus römischer Perspektive, insbesondere auf der Rolle des römischen Militärs und den Auswirkungen des Aufstands auf die Provinz Judaea und die jüdische Bevölkerung.
- Die Vorgeschichte des Aufstands und die Situation der Juden nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr.
- Die möglichen Ursachen des Aufstands, wie z.B. die Neugründung Jerusalems als römische Stadt und das Beschneidungsverbot Hadrians.
- Die Rolle des Messianismus in der Person Bar Kochbas und die kritische Auseinandersetzung mit seinem messianischen Anspruch.
- Der Verlauf des Aufstands aus römischer Sicht, insbesondere die hohen Verluste, die das römische Heer erlitt, und die außergewöhnlichen Notmaßnahmen, die die römische Administration ergreifen musste.
- Die Folgen des Aufstands für die Provinz Judaea und die jüdische Bevölkerung, einschließlich der Wiederaufbaumaßnahmen am Tempel und der unmittelbaren Auswirkungen auf das Alltagsleben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Fokus auf die Person Bar Kochba und dessen historische Einordnung, wobei der Autor insbesondere auf die unterschiedliche Wahrnehmung Bar Kochbas in der jüdischen und der römischen Geschichtsschreibung hinweist.
Das erste Kapitel behandelt die Vorgeschichte des Bar Kochba-Aufstands und analysiert die Situation der Juden nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. Es werden die Folgen des Ersten Jüdischen Krieges (66-73 n. Chr.) und der Aufstand der Diasporajuden (115-117 n. Chr.) behandelt.
Das zweite Kapitel analysiert die möglichen Ursachen des Bar Kochba-Aufstands, wobei die Neugründung Jerusalems als römische Stadt Aelia Capitolina und das Beschneidungsverbot Hadrians im Mittelpunkt stehen.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Messianismus in der Person Bar Kochbas und analysiert dessen historischen Hintergrund und die kritische Auseinandersetzung mit seinem messianischen Anspruch.
Das vierte Kapitel behandelt den Verlauf des Bar Kochba-Aufstands aus römischer Sicht. Es werden die hohen Verluste des römischen Heeres analysiert und die außergewöhnlichen Notmaßnahmen der römischen Administration, wie z.B. Zwangsaushebungen im italischen Kernland und atipysche Versetzungsmaßnahmen innerhalb des römischen Militärapparats, beleuchtet.
Das fünfte Kapitel behandelt die Folgen des Aufstands für die Provinz Judaea und die jüdische Bevölkerung. Es werden die Wiederaufbaumaßnahmen am Tempel, die Bedeutung der Beteiligung von Fremdvölkern am Aufstand und die geographisch-territorialen Aspekte des Aufstandsgebiets betrachtet.
Schlüsselwörter
Bar Kochba-Aufstand, Judäa, Römisches Heer, Provinz Judaea, Messianismus, Hadrians Beschneidungsverbot, Aelia Capitolina, Militärdiplome, Quellenlage, Epigraphik, Archäologie, Historiographie, Historische Einordnung, Folgen des Aufstands.
- Citation du texte
- Holger Hufer (Auteur), 2008, Der Bar Kochba-Aufstand (132-135/36 n.Chr.), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191793