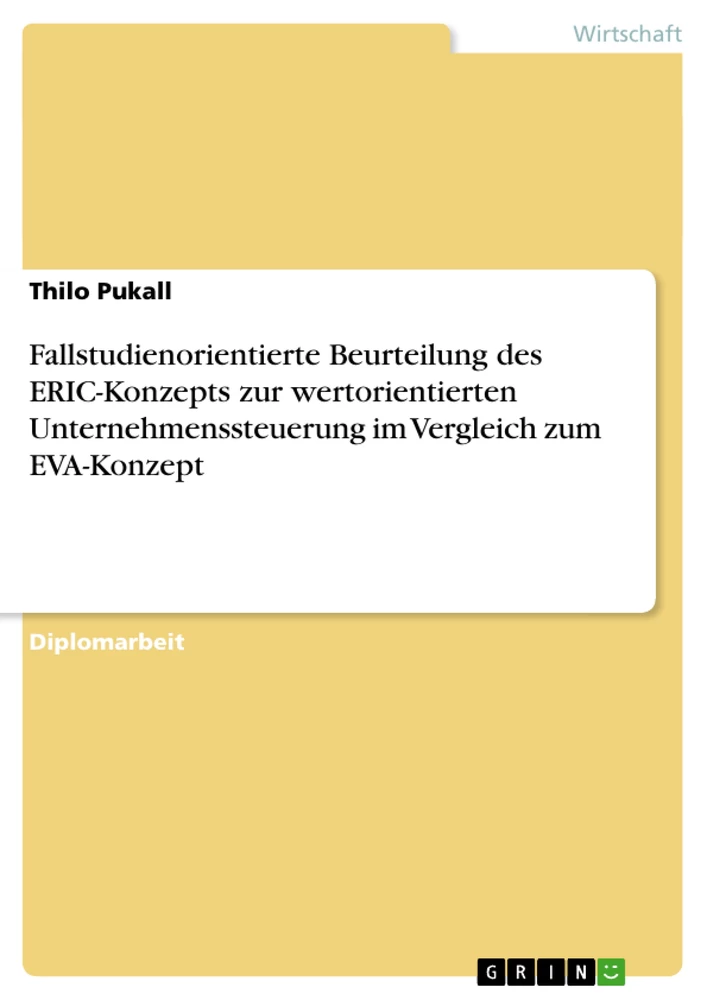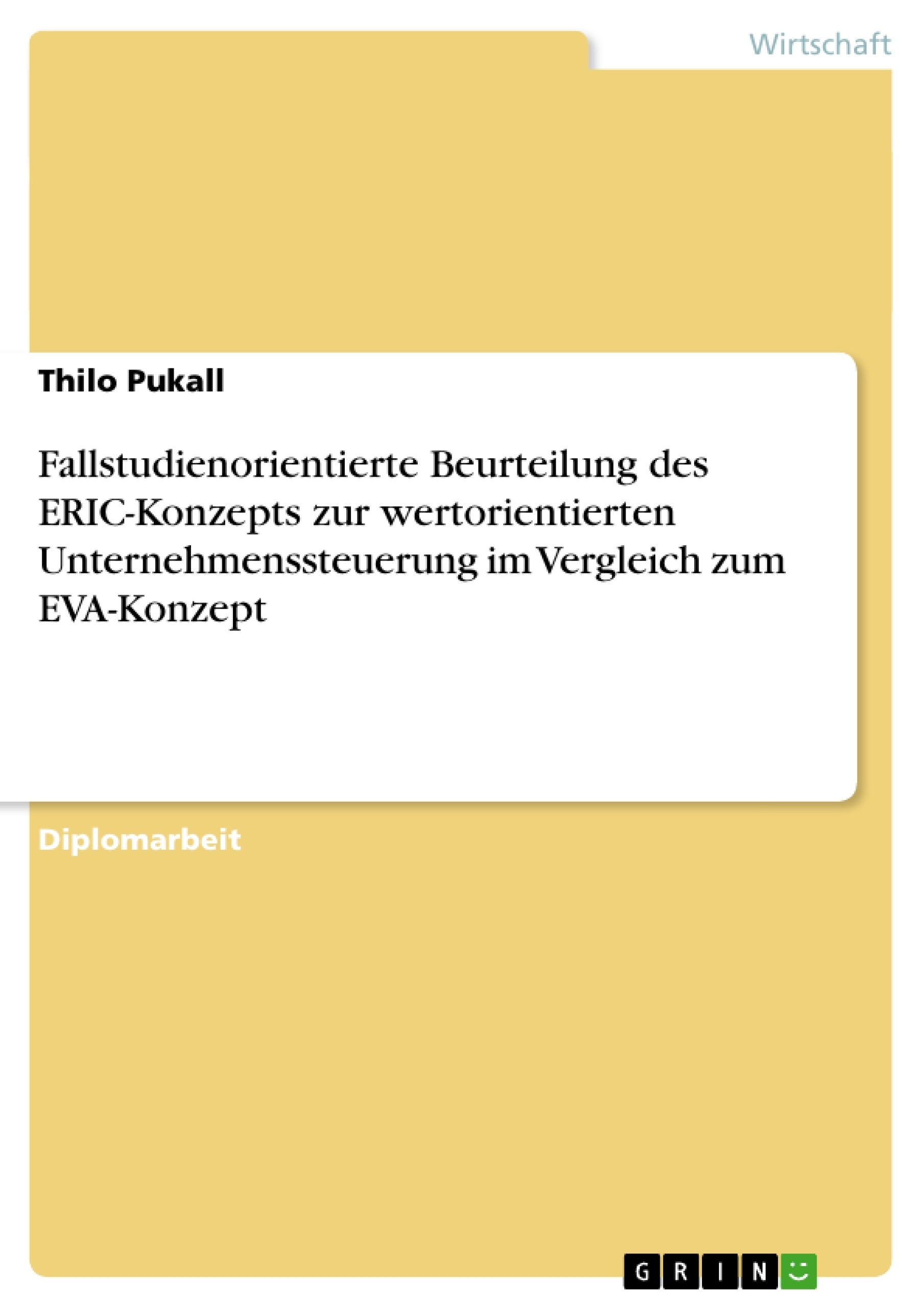Der über die letzten Dekaden stetig gewachsene Druck auf Unternehmen, sich mehr und mehr an die Forderungen des Kapitalmarktes anzupassen, führte zu ei-ner immer stärkeren Ausrichtung unternehmerischen Handelns an dem Sharehol-der Value. Die Shareholder Value-Orientierung, also die kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswertes im Sinne der Eigentümer, wird bereits seit langem in der Literatur und Presse kontrovers diskutiert.
Wertorientierung wurde bereits in den 1980er Jahren u.a. von Alfred Rappaport propagiert, dessen Shareholder Value-Ansatz (SHV-Ansatz) die Wertmaximierung der Investition der Eigenkapitalgeber als oberste Maxime der Unternehmung darstellt. Die Leitidee der wertorientierten Unternehmensführung findet prakti-sche Umsetzung in verschiedenen Konzepten. Zu den bekanntesten gehören das erwähnte Shareholder Value-Konzept von Rappaport, das Konzept des Economic Value Added (EVA®), der Discounted Cash Flow (DCF)-Ansatz sowie das Cash Flow Return on Investment-Schema und der Cash Value Added (CVA®). Viele Unternehmen haben die Steigerung des Shareholder Value zu ihren zentralen Grundsätzen erklärt, u.a. Daimler, Henkel und Siemens.
Die Notwendigkeit der Wertorientierung für die Unternehmenssteuerung gilt heutzutage per se als unstrittig, allerdings werden die Methoden zur Realisierung selbiger in Theorie und Praxis zunehmend kritisch hinterfragt. Aufgrund der massiven Kritik an Konzepten wie dem EVA und dem CVA® entwickelte Louis Velthuis die Kennzahl „Earnings less Riskfree Interest Charge“ (ERIC®), mit dem dazugehörigen ERIC®-Management- und Incentive-Konzept. Propagiert wird die Kennzahl von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG. Von den Schöpfern des ERIC-Konzepts werden die ERIC im Vergleich zu herkömmli-chen Wertbeitragskonzepten als überlegen gesehen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Informations- und Verhaltenssteuerungsfunktion des ERIC-Konzepts für die wertorientierte Unternehmensführung aus Sicht eines Un-ternehmens zu untersuchen. Besonderer Fokus wird dabei auf einen Vergleich mit dem EVA-Konzept gelegt. Zur Durchführung der Analyse wird ein fiktives Un-ternehmensmodell kreiert, welches möglichst realitätsnah ausgestaltet ist, gleich-zeitig aber nur die für den ERIC-EVA-Vergleich relevanten Sachverhalte vertieft. Schwerpunkt der Unternehmensbetrachtung ist die wertorientierte Performance-planung, -kontrolle und -analyse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Wertorientierte Unternehmenssteuerung und wertorientiertes Controlling
- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Wertorientierte Unternehmensführung
- 2.3 Wertorientiertes Controlling
- 3. Theoretische Grundlagen wertorientierter Kennzahlen
- 3.1 Grundlagen und Definition von Anforderungskriterien
- 3.2 Das EVA-Konzept
- 3.2.1 Grundlagen
- 3.2.2 Berechnung des investierten Kapitals und des NOPAT
- 3.2.3 Berechnung der Kapitalkosten
- 3.2.3.1 Grundlagen
- 3.2.3.2 Berechnung der Fremdkapitalkosten
- 3.2.3.3 Berechnung der Eigenkapitalkosten
- 3.2.4 Beurteilung des EVA-Konzept in der Literatur
- 3.3 Das ERIC-Konzept
- 3.3.1 Grundlagen des ERIC-Konzepts
- 3.3.2 Planung mit ERIC
- 3.3.2.1 Ermittlung der EBIAT und des investierten Kapitals
- 3.3.2.2 Ermittlung des Sicherheitsäquivalents der EBIAT
- 3.3.2.3 Ermittlung der risikofreien Verzinsung
- 3.3.3 Performancemessung mit den ERIC
- 3.3.4 Managemententlohnung mit den ERIC
- 3.3.5 Beurteilung des ERIC-Konzepts in der Literatur
- 3.4 Konzeptionelle Gegenüberstellung ERIC vs. EVA
- 4. Fallstudie: Risiko AG
- 4.1 Prämissen des Modells
- 4.2 Ausgangsdaten
- 4.3 Ex post-Performancemessung
- 4.3.1 Ex post-Performancemessung mit dem EVA
- 4.3.1.1 Berechnung der Fremdkapitalkosten
- 4.3.1.2 Berechnung der Eigenkapitalkosten
- 4.3.1.3 Berechnung des EVA von 2004 bis 2008
- 4.3.2 Ex post-Performancemessung mit den ERIC
- 4.3.3 Vergleich der Ergebnisse
- 4.3.1 Ex post-Performancemessung mit dem EVA
- 4.4 Ex ante-Performancemessung
- 4.4.1 Planung mit dem EVA
- 4.4.2 Planung mit den ERIC
- 4.4.3 Vergleich der Ergebnisse
- 4.5 Beurteilung des ERIC-Konzept auf Basis der Fallstudie
- 4.5.1 Beurteilung der ex post-Performancemessung
- 4.5.2 Beurteilung der ex ante-Unternehmenswertberechnung
- 4.5.3 Abschließende Gesamtbeurteilung
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das ERIC-Konzept zur wertorientierten Unternehmenssteuerung im Vergleich zum EVA-Konzept. Ziel ist es, die beiden Konzepte hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, ihrer praktischen Anwendung und ihrer Stärken und Schwächen zu analysieren.
- Wertorientierte Unternehmenssteuerung
- EVA-Konzept
- ERIC-Konzept
- Performancemessung
- Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert den Gang der Untersuchung.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen der wertorientierten Unternehmenssteuerung und des wertorientierten Controllings.
- Kapitel 3: Das Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen wertorientierter Kennzahlen, insbesondere des EVA- und ERIC-Konzepts. Die Berechnung der Kennzahlen wird erläutert und eine konzeptionelle Gegenüberstellung der beiden Konzepte erfolgt.
- Kapitel 4: In einer Fallstudie wird das ERIC-Konzept anhand der Risiko AG im Vergleich zum EVA-Konzept untersucht. Die ex post- und ex ante-Performancemessung wird durchgeführt und eine Beurteilung des ERIC-Konzepts auf Basis der Fallstudie erfolgt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind wertorientierte Unternehmenssteuerung, EVA-Konzept, ERIC-Konzept, Performancemessung, Fallstudie, Risiko AG.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das EVA-Konzept?
Economic Value Added (EVA) ist eine Kennzahl zur Messung des Übergewinns eines Unternehmens, berechnet als Differenz zwischen dem operativen Gewinn (NOPAT) und den Kapitalkosten auf das investierte Kapital.
Was ist das ERIC-Konzept?
ERIC steht für „Earnings less Riskfree Interest Charge“. Es ist ein neueres Konzept zur wertorientierten Steuerung, das die risikofreie Verzinsung nutzt und Risiken über Sicherheitsäquivalente abbildet.
Warum gilt ERIC gegenüber EVA oft als überlegen?
ERIC wird eine bessere Informations- und Verhaltenssteuerungsfunktion zugeschrieben, da es bestimmte Schwächen des EVA-Konzepts bei der Berücksichtigung von Risiken und der Anreizgestaltung für das Management vermeidet.
Was bedeutet Shareholder Value-Orientierung?
Es ist die Ausrichtung des unternehmerischen Handelns an der kontinuierlichen Steigerung des Unternehmenswertes im Sinne der Eigentümer (Aktionäre).
Welche Rolle spielen Kapitalkosten bei wertorientierten Kennzahlen?
Kapitalkosten stellen die Mindestrendite dar, die Investoren für ihr Risiko erwarten. Nur wenn ein Unternehmen mehr verdient als diese Kosten, schafft es echten Wert.
- Quote paper
- Thilo Pukall (Author), 2009, Fallstudienorientierte Beurteilung des ERIC-Konzepts zur wertorientierten Unternehmenssteuerung im Vergleich zum EVA-Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191806