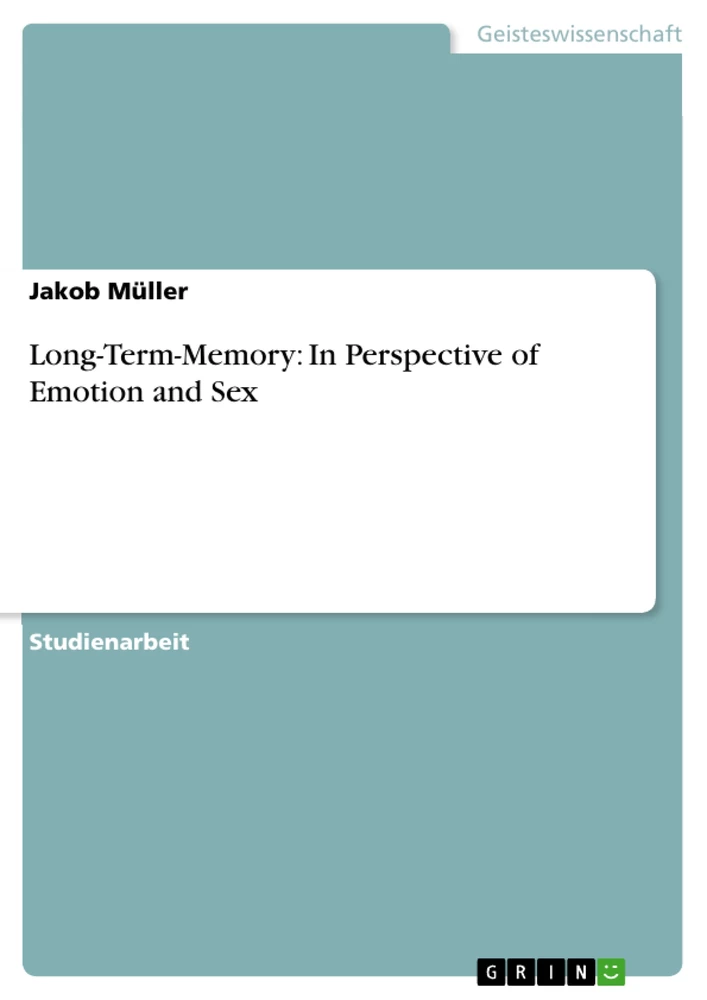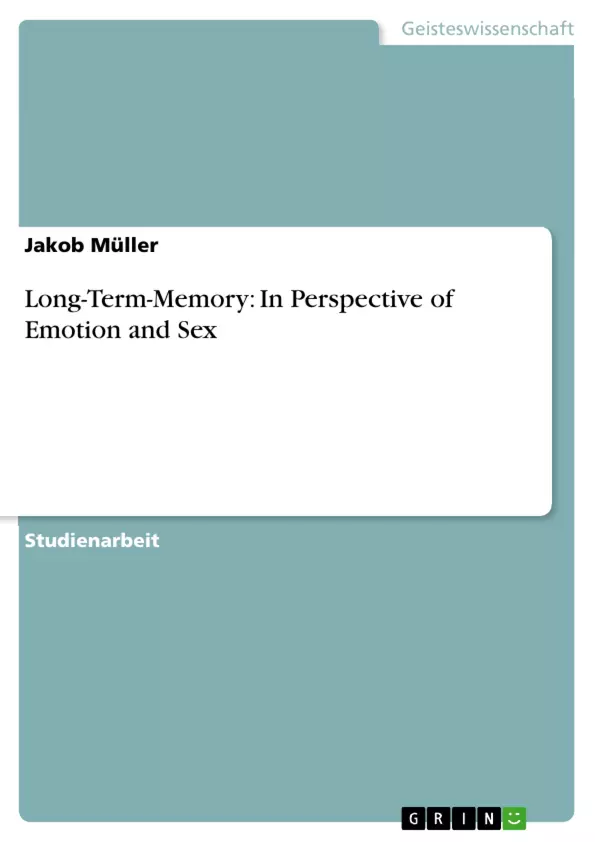Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Forschungsartikel (Cahill et al., 2004a) in seinen wesentlichen Elementen und seinem Aufbau darzustellen.
Die Studie befasst sich mit der Frage, ob und wie Geschlechterunterschiede die Lang-Zeit-Erinnerung an emotionale Elemente einer Geschichte beeinflussen. Des Weiteren, ob eine Differenzierung nach geschlechterbezogenen Charaktereigenschaften unterschiedliche Erinnerungsleistungen erkennbar werden lässt.
Versuchsdurchführung und Forschungsergebnisse der Studie werden kritisch hinterfragt.
Zudem werden unter Bezugnahme auf weitere Forschungsarbeiten zwei Dimensionen der Gedächtnisforschung, „Emotion“ und „Sex“, im Hinblick auf die zuvor dargestellte Studie erörtert.
Ziel ist auch hier eine kritische Betrachtung von Versuchsanordnung, Ergebnisinterpretation und den verwendeten Termini.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Forschungshintergrund
- Forschungsgegenstand
- Hypothesen
- Darstellung der Studie
- Definition der Keyterms
- Sex related traits & Bem Sex
- Zentral versus Peripher
- Emotion
- Versuchsdurchführung
- Ergebnisse
- Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- Definition der Keyterms
- Kritische Diskussion der Befunde
- Methodische und inhaltliche Kritik
- Statistische Auswertung
- Repräsentativität der Versuchsteilnehmer
- Validität des Bem-Tests
- Emotionsinduktion / Emotionsbegriff
- Bildergeschichte
- Emotionsbegriff / Emotional Arousal
- Lateralisierung der Amygdala-Funktion: Sex differences in emotionally influenced memory
- Methodische und inhaltliche Kritik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der kritischen Überprüfung einer Forschungsstudie, die den Einfluss von Geschlecht und geschlechtsbezogenen Eigenschaften auf die Langzeit-Erinnerung an emotionale Inhalte einer Geschichte untersucht. Ziel ist es, die Studie in ihrem Aufbau und ihren wesentlichen Elementen darzustellen, die Versuchsdurchführung und Forschungsergebnisse kritisch zu hinterfragen und den Einfluss von Emotion und Geschlecht auf die Gedächtnisleistung unter Einbezug weiterer Forschungsarbeiten zu erörtern.
- Einfluss von Emotionen auf das Langzeitgedächtnis
- Geschlechterunterschiede (sex differences) in Bezug auf das Gedächtnis
- Reliabilität des Ausbleibens einer verbesserten Erinnerung an zentrale Informationen einer emotionalen Geschichte bei Frauen
- Rolle von geschlechtsbezogenen Charaktereigenschaften (sex-related traits) für die Erinnerungsleistung
- Kritische Betrachtung von Versuchsanordnung, Ergebnisinterpretation und verwendeter Terminologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungshintergrund, den Forschungsgegenstand und die Hypothesen der Studie erläutert. Im Anschluss werden die Keyterms der Studie definiert, die Versuchsdurchführung und Ergebnisse dargestellt sowie eine Interpretation und Diskussion der Ergebnisse präsentiert. Die kritische Diskussion der Befunde analysiert methodische und inhaltliche Kritikpunkte der Studie, betrachtet die Emotionsinduktion und den Emotionsbegriff, sowie die Lateralisierung der Amygdala-Funktion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themengebiete Langzeitgedächtnis, Emotion, Geschlecht, geschlechtsbezogene Charaktereigenschaften, sex differences, emotional arousing events, Gedächtnisforschung, Versuchsanordnung, Ergebnisinterpretation, methodische und inhaltliche Kritik, Emotionsinduktion, Emotionsbegriff, Amygdala-Funktion, und den Bem-Sex-Role-Inventory.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Studie von Cahill et al. (2004a)?
Die Studie untersucht, ob und wie Geschlechterunterschiede die Langzeit-Erinnerung an emotionale Elemente einer Geschichte beeinflussen.
Welche Rolle spielen geschlechterbezogene Charaktereigenschaften?
Die Arbeit analysiert, ob eine Differenzierung nach geschlechterbezogenen Eigenschaften (sex-related traits) unterschiedliche Erinnerungsleistungen bei emotionalen Inhalten erkennbar macht.
Was wird an der Versuchsdurchführung kritisiert?
Kritisch hinterfragt werden unter anderem die statistische Auswertung, die Repräsentativität der Teilnehmer sowie die Validität des verwendeten Bem-Tests.
Was bedeutet die Lateralisierung der Amygdala-Funktion in diesem Kontext?
Es geht um geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Verarbeitung emotional beeinflusster Gedächtnisinhalte durch die Amygdala.
Welche Bedeutung haben "zentrale" versus "periphere" Informationen?
Die Arbeit untersucht die Reliabilität des Befundes, dass bei Frauen eine verbesserte Erinnerung an zentrale Informationen einer emotionalen Geschichte ausbleiben kann.
- Quote paper
- Jakob Müller (Author), 2007, Long-Term-Memory: In Perspective of Emotion and Sex, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191866