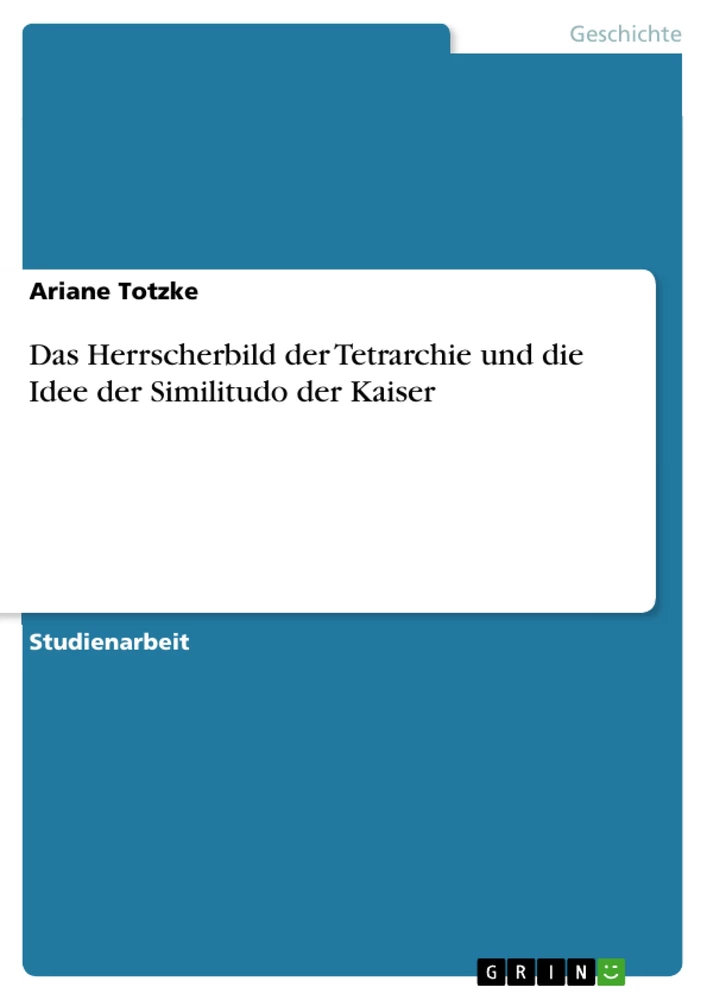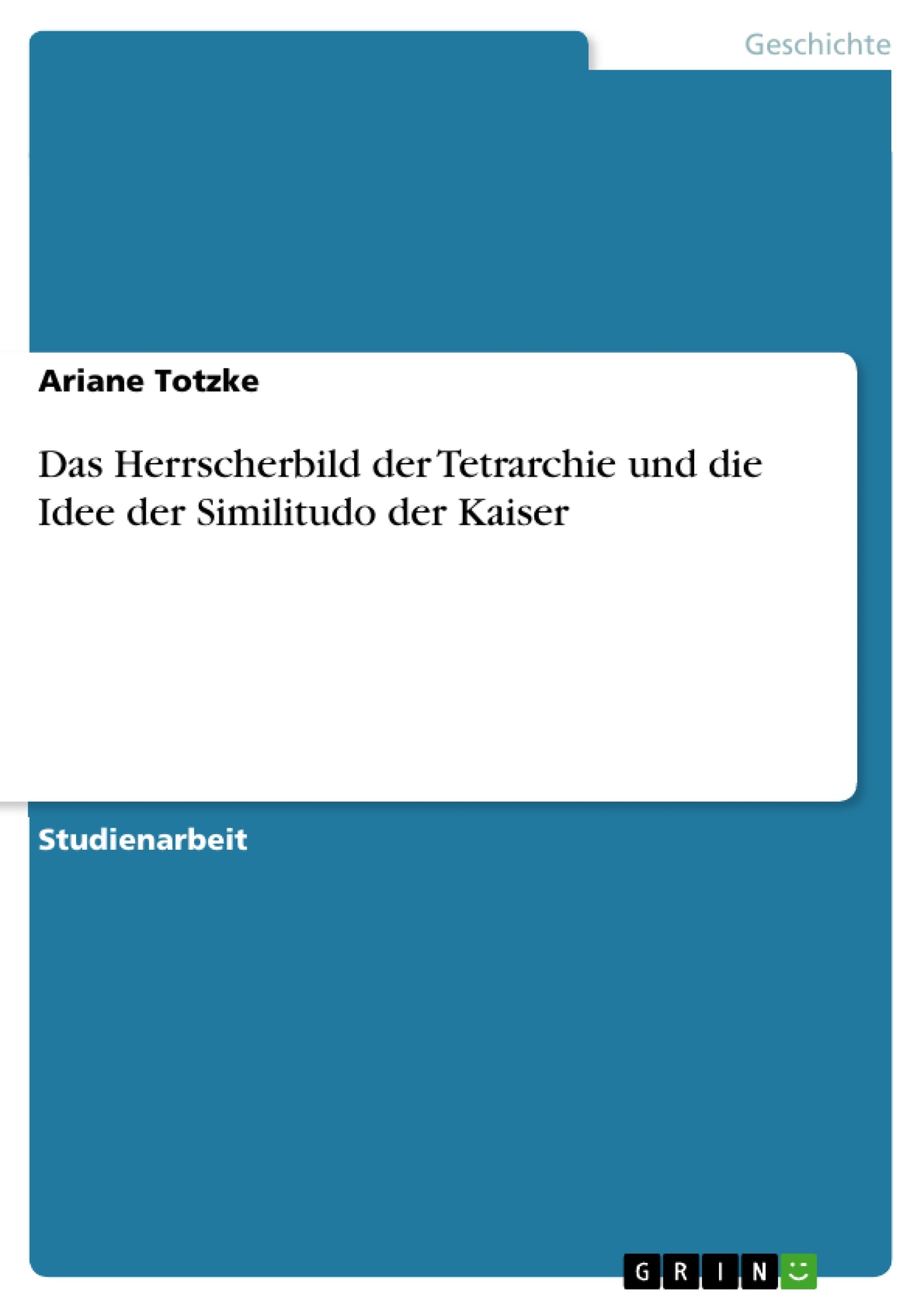Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Tetrarchentypus zu charakterisieren. Hierzu werden mehrere Bildmaterialien untersucht und ausgewertet. Das Hauptaugenmerk liegt auf der These, dass sich Diokletians Maßnahmen zur Stabilisierung des römischen Reiches, die Machtaufteilung auf mehrere Regenten und die neuen Reformen, auch in der bildhaften Darstellung der Tetrarchen wieder finden lässt. Hier ist ein Wandel vom Soldatentypus hin zu etwas Neuem zu beobachten, obwohl man festhalten muss, dass sich gewisse Einflüsse des Soldatentypus finden lassen. Individuelle Züge treten dennoch in Darstellungen zurück und weichen einer Motivik der Gleichheit und Angepasstheit. Die Idee der Similitudo der Kaiser in der bildhaften Wiedergabe der Tetrarchen soll als Symbol verstanden werden für Macht, Stärke, Standhaftigkeit und Zusammenhalt des neuen Herrschaftssystems.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HISTORISCHE VORUNTERSUCHUNG
- Das historisch-politische Umfeld
- Diokletian (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus)
- Maximianus (Marcus Aurelius Maximianus Herculis)
- Galerius (Gaius Galerius Valerius Maximianus)
- Constantius Chlorus (Gaius Flavius Valerius Constantius)
- DAS HERRSCHERBILD DER TETRARCHIE
- Die Idee der Similitudo der Kaiser
- Die Gruppenbildnisse
- Die vatikanischen und venezianischen Porphyrgruppen
- Die Gruppe von zwei Doppelhermen aus Spalto
- Die Münzbildnisse
- SCHLUSSWORT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, den Tetrarchentypus im Detail zu charakterisieren. Dazu werden verschiedene bildliche Darstellungen analysiert und ausgewertet. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die These, dass sich Diokletians Maßnahmen zur Stabilisierung des Römischen Reiches, die Machtteilung auf mehrere Regenten und die neuen Reformen auch in der bildlichen Darstellung der Tetrarchen wiederfinden lassen. Dies beinhaltet eine Entwicklung vom Soldatentypus hin zu einer neuen Form der Repräsentation, wobei allerdings gewisse Einflüsse des Soldatentypus weiterhin erkennbar bleiben. Trotz dieser Tendenz zur Gleichheit und Angepasstheit zeichnen sich in den Darstellungen auch individuelle Züge ab. Die Idee der Similitudo der Kaiser in der bildlichen Wiedergabe der Tetrarchen soll als Symbol für Macht, Stärke, Standhaftigkeit und Zusammenhalt des neuen Herrschaftssystems interpretiert werden.
- Die politische und soziale Situation des Römischen Reiches vor Diokletians Herrschaft
- Die Reformen Diokletians und die Einführung der Tetrarchie
- Die bildliche Darstellung der Tetrarchen und deren Symbolik
- Die Bedeutung der Similitudo der Kaiser im Kontext der Tetrarchie
- Die Verbindung von Macht und Göttlichkeit in der Darstellung der Tetrarchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert das Ziel der Arbeit, den Tetrarchentypus zu charakterisieren, und stellt die These vor, dass sich Diokletians Reformen auch in der bildlichen Darstellung der Tetrarchen widerspiegeln. Anschließend wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.
Das Kapitel „Historische Voruntersuchung“ beleuchtet das historisch-politische Umfeld vor Diokletians Herrschaft und beschreibt die Instabilität des Römischen Reiches, die durch interne Machtkämpfe und äußere Bedrohungen geprägt war. Es wird die Rolle Diokletians bei der Stabilisierung des Reiches und die Einführung der Tetrarchie sowie die Reformen in den Bereichen der Reichsorganisation, der Währung und der Preispolitik erörtert. Anschließend werden die vier Tetrarchen, Diokletian, Maximianus, Galerius und Constantius Chlorus, in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Rollen innerhalb der Tetrarchie und ihre wichtigsten Leistungen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der bildlichen Darstellung der Tetrarchen. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher: Tetrarchie, Similitudo, Concordia, Herrschaftsideologie, Bildnis, Monumentalskulptur, Münzbildnis, Soldatentypus, Göttlichkeit, Macht, Stärke, Standhaftigkeit, Zusammenhalt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Similitudo“ der Kaiser in der Tetrarchie?
Es ist das Prinzip der bildhaften Gleichheit der Herrscher, das Einigkeit, Zusammenhalt und die Unteilbarkeit der kaiserlichen Macht symbolisieren sollte.
Wie veränderte sich das Herrscherbild unter Diokletian?
Es fand ein Wandel vom individuellen Soldatentypus hin zu einer stilisierten, angepassten Darstellung statt, in der individuelle Züge zugunsten des kollektiven Herrschaftssystems zurücktraten.
Welche Kunstwerke sind typisch für das Herrscherbild der Tetrarchie?
Bekannte Beispiele sind die vatikanischen und venezianischen Porphyrgruppen, die die Kaiser in brüderlicher Umarmung zeigen.
Welches politische Ziel verfolgte Diokletian mit der Tetrarchie?
Ziel war die Stabilisierung des Römischen Reiches durch die Aufteilung der Macht auf zwei Oberkaiser (Augusti) und zwei Unterkaiser (Caesares).
Wie spiegeln Münzbildnisse die Ideologie der Tetrarchie wider?
Auf den Münzen wurden die Kaiser oft mit identischen Gesichtszügen dargestellt, um die „Concordia“ (Eintracht) und die Gleichwertigkeit der Regenten zu betonen.
- Citar trabajo
- Ariane Totzke (Autor), 2006, Das Herrscherbild der Tetrarchie und die Idee der Similitudo der Kaiser, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191874