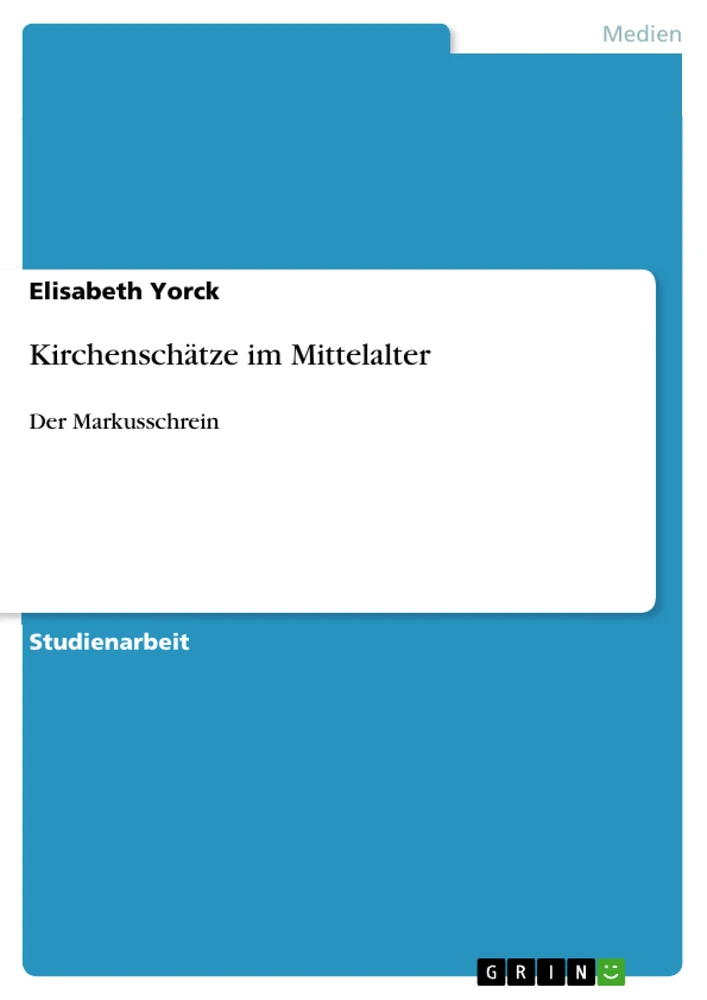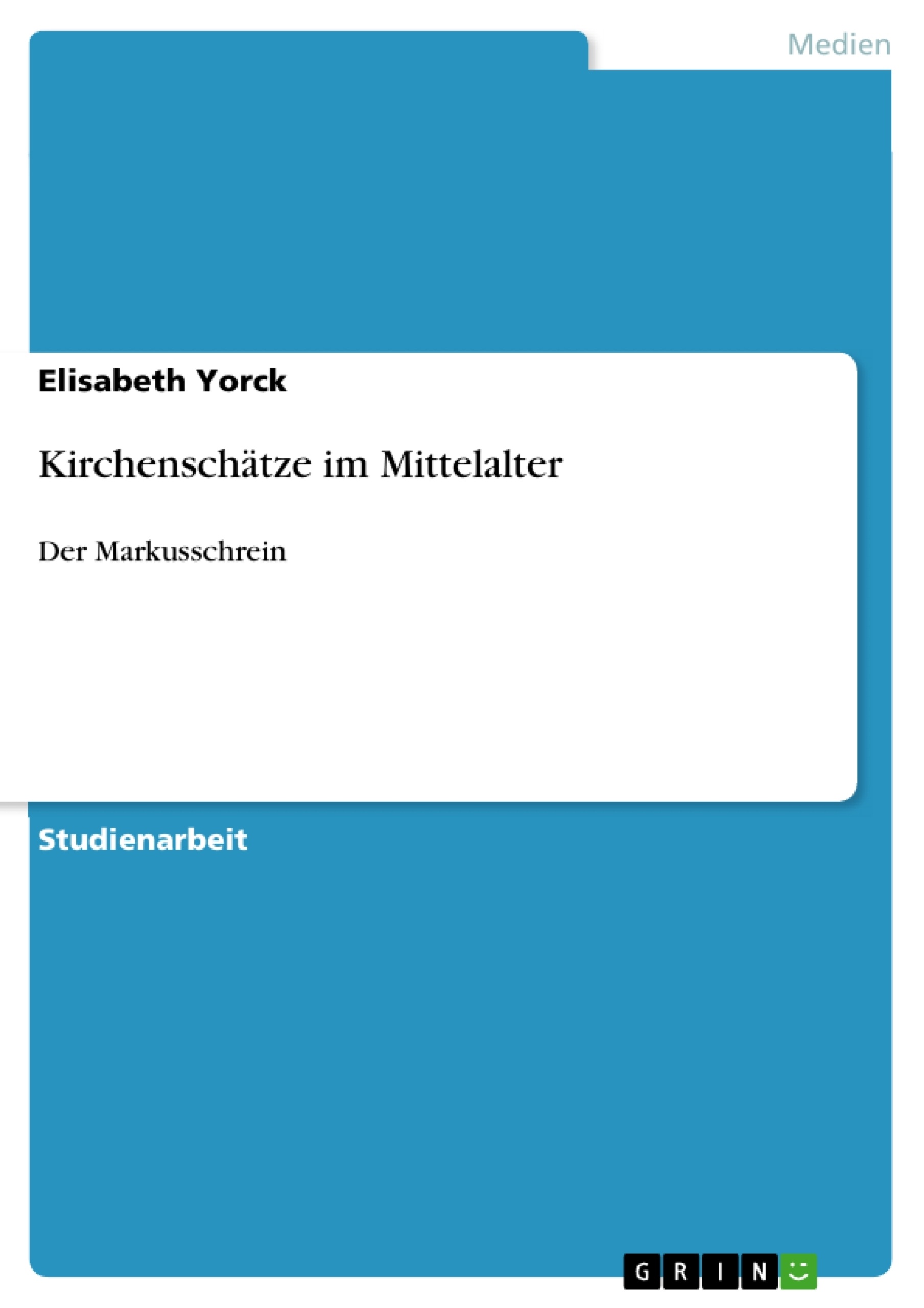Seit dem frühen Mittelalter bis heute nehmen Christen weite Reisen auf sich, um berühmte körperliche Überreste von Heiligen zu verehren. Sie sprechen den Reliquien heilende Kräfte zu und glauben an diesen teilhaben zu können, wenn sie sich in ihrer Nähe aufhalten.
Im Laufe des Mittelalters entwickelte sich ein wahrer Kult um die Reliquien und die Nachfrage stieg beständig. So wurden nicht nur heilige Gebeine oder Gegenstände in Altären, in Krypten oder als Teil von Kirchenschätzen aufbewahrt, sondern auch kleine Knochenteile oder Stofffetzen von Gläubigen in Amuletten getragen. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, entstand ein reger Handel in Europa, sodass die Authentizität vieler Reliquien mehr als fragwürdig wurde. Die Faszination an heiligen Überresten ist dennoch nicht verloren gegangen. Inwieweit spielt also die Echtheit von Reliquien bei der Verehrung überhaupt eine Rolle? Was haben heilige Gebeine oder Gegenstände Besonderes an sich, dass man ihnen vor allem im Mittelalter Wunderwirkungen zuschrieb?
Mit Beginn zunehmender Anbetung erfuhren die Aufbewahrungsorte der Reliquien eine prachtvolle Ausgestaltung, um den spirituellen Wert ihres Inhalts durch irdische Kostbarkeiten sichtbar zu machen. Es entstanden unterschiedliche Formen und Größen je nach Art der Reliquie, wobei der kastenförmige Schrein sehr häufig als Präsentationsmittel gewählt wurde. So auch bei den körperlichen Überresten des heiligen Evangelisten Markus, die sich heute in der Schatzkammer des Reichenauer Münsters befinden. Anhand einer Beschreibung und Analyse des gotischen Schreins aus dem 14. Jahrhundert soll seine Aussage und die Botschaft der Markusreliquien in seinem Inneren für den (gläubigen) Betrachter ermittelt werden. Diese werden vor allem durch die dargestellte Bildthematik kommuniziert.
Inhaltsverzeichnis
- (I) Einleitung
- (II) Bedeutung von Reliquien und Verwendung von Reliquiaren
- (III) Der Evangelist Markus und seine sterblichen Überreste
- III.1. Zur Person des heiligen Evangelisten Markus
- III.2. Die Übertragung der Markusreliquien auf die Reichenau
- (IV) Beschreibung und Analyse des Schreins
- IV.1 Maße, Materialien und Techniken
- IV.2. Struktur des Schreins und inhaltliche Darstellungen
- IV.3. Verzierungen und bildkünstlerische Elemente
- (V) Schluss: Wirkung und Aussage des Markusschreins auf den Betrachter
- (VI) Abbildung: Der schematische Aufbau des Markusschreins
- (VII) Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Markusschrein, ein gotisches Reliquiar aus dem 14. Jahrhundert, das sich in der Schatzkammer des Reichenauer Münsters befindet. Das Ziel der Arbeit ist es, die Aussage und die Botschaft der Markusreliquien innerhalb des Schreins für den Betrachter zu ermitteln, indem die bildliche Darstellung analysiert wird. Dabei sollen auch die Bedeutung von Reliquien im Mittelalter sowie die Entwicklung der Reliquiarformen beleuchtet werden.
- Die Bedeutung von Reliquien im Mittelalter und die Entwicklung des Reliquiarkults
- Die Person des Evangelisten Markus und die Übertragung seiner Reliquien auf die Reichenau
- Die Beschreibung und Analyse des Markusschreins: Materialien, Struktur, Darstellungen und Verzierungen
- Die Wirkung und Aussage des Schreins für den Betrachter
- Die Relevanz der bildlichen Darstellungen für die Vermittlung der Botschaft der Reliquien
Zusammenfassung der Kapitel
(I) Einleitung: Der Text führt in das Thema Reliquienverehrung im Mittelalter ein und stellt die besondere Bedeutung von Reliquien als Gegenstände, die den Gläubigen Nähe zur himmlischen Ewigkeit vermittelten, heraus. Anschließend wird der Markusschrein als Gegenstand der Untersuchung vorgestellt und die Ziele der Arbeit umrissen.
(II) Bedeutung von Reliquien und Verwendung von Reliquiaren: Dieses Kapitel erläutert den Begriff "Reliquie" und die verschiedenen Formen von Reliquien, von primären Reliquien (wie Blut, Knochen) bis hin zu Sekundär- oder Kontaktreliquien (wie Kleidungsstücke oder Gebrauchsgegenstände). Es beleuchtet auch die Bedeutung von Reliquien für den Glauben und die Wunderwirkungen, die ihnen zugeschrieben wurden.
(III) Der Evangelist Markus und seine sterblichen Überreste: Dieses Kapitel befasst sich mit der Person des heiligen Evangelisten Markus und der Übertragung seiner Reliquien auf die Reichenau. Es beleuchtet die historischen Hintergründe und die Bedeutung dieser Übertragung für das Reichenauer Kloster.
(IV) Beschreibung und Analyse des Schreins: Dieses Kapitel widmet sich der genauen Beschreibung und Analyse des Markusschreins. Es beschreibt Maße, Materialien und Techniken, die bei der Herstellung des Schreins verwendet wurden, sowie die Struktur des Schreins und die dargestellten Inhalte. Auch die Verzierungen und bildkünstlerischen Elemente werden in diesem Kapitel behandelt.
(V) Schluss: Wirkung und Aussage des Markusschreins auf den Betrachter: Dieses Kapitel befasst sich mit der Wirkung und Aussage des Markusschreins auf den Betrachter. Es analysiert, wie die bildliche Darstellung der Reliquien und der Schrein selbst die Botschaft des Evangelisten Markus vermitteln und den Betrachter zum Nachdenken über den Glauben und die Bedeutung der Reliquien anregen.
Schlüsselwörter
Reliquien, Reliquiar, Markusschrein, Markus Evangelium, Reichenau, Mittelalter, Kunstgeschichte, Kirchenkunst, Bildanalyse, Glaubensgeschichte, Wunderwirkung, Verehrung, Heiligkeit, Botschaft, Betrachter, Glaube, Liturgie
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatten Reliquien im Mittelalter?
Reliquien galten als Gegenstände, die Gläubigen Nähe zur himmlischen Ewigkeit vermittelten und denen oft heilende Kräfte oder Wunderwirkungen zugeschrieben wurden.
Was ist der Markusschrein?
Der Markusschrein ist ein gotisches Reliquiar aus dem 14. Jahrhundert, das sich heute in der Schatzkammer des Reichenauer Münsters befindet.
Wie kamen die Markusreliquien auf die Insel Reichenau?
Die Arbeit befasst sich im dritten Kapitel detailliert mit der historischen Übertragung der sterblichen Überreste des Evangelisten Markus auf die Reichenau.
Was wird bei der Analyse des Schreins untersucht?
Es werden die Maße, Materialien (wie Gold oder Edelsteine), Techniken, die Struktur sowie die bildlichen Darstellungen und Verzierungen analysiert.
Welche Rolle spielt die Bildthematik des Schreins?
Die Bildthematik dient dazu, die Botschaft der Reliquien und die christliche Lehre an den (gläubigen) Betrachter zu kommunizieren.
Was ist der Unterschied zwischen primären und sekundären Reliquien?
Primäre Reliquien sind Körperteile (Knochen, Blut), während Sekundär- oder Kontaktreliquien Gegenstände sind, die der Heilige berührt hat (Kleidung, Gebrauchsgegenstände).
- Quote paper
- Elisabeth Yorck (Author), 2009, Kirchenschätze im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191983