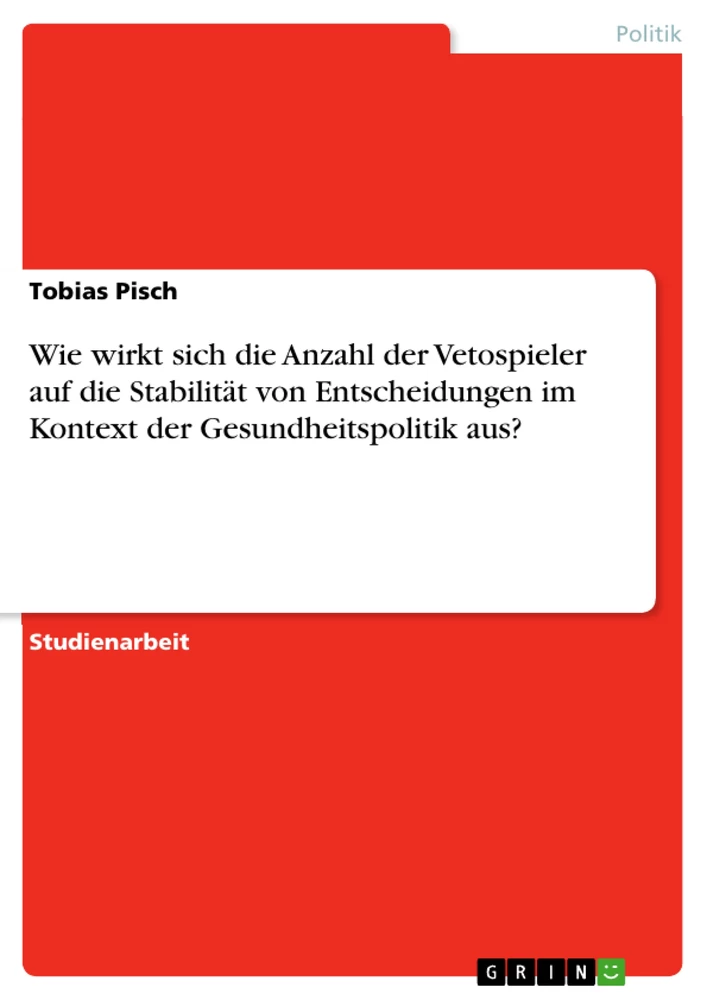Die Vetospielertheorie ist eine Theorie der vergleichenden Politikwissenschaft, die statt politische Systeme dichotom einzuteilen, beispielsweise in präsidentiell oder parlamentarisch, versucht, politische Systeme anhand ihrer Vetospieler zu klassifizieren (vgl. Tsebelis 2002, 1f.).
Nach George Tsebelis lässt sich ein Zusammenhang zwischen bestimmten Eigenschaften der Vetospieler eines politischen Systems und der Veränderbarkeit des Status quos auf der Policy-Ebene feststellen. In dieser Arbeit soll vor allem die Anzahl der Vetospieler und deren Zusammenhang mit der Veränderbarkeit des Status quo im Politikfeld der Gesundheitspolitik betrachtet werden. Aus den Theoremen von George Tsebelis lässt sich die These herleiten, dass je größer die Anzahl der Vetospieler in einem politischen System ist, desto höher ist die Policy-Stabilität in diesem System.
Diese These soll anhand der Gesundheitspolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland untersucht werden. Die Fallauswahl begründet sich durch die unterschiedlichen politischen Systeme sowie durch die unterschiedlichen Gesundheitssyteme in beiden Staaten. Die Gesundheitspolitik taucht in beiden Staaten häufig auf der Agenda der Politik auf. Besonders die stetig ansteigenden Kosten in beiden Gesundheitssystemen tragen hierzu bei. In den Vereinigten Staaten gab es unter Obama 2010 nach langer Diskussion und Problematiken der Mehrheitsgewinnung eine weitreichende Gesundheitsreform. In der Bundesrepublik Deutschland gab es im letzten Jahrzehnt gleich mehrere Reformen im Gesundheitssystem. Die Unterschiede in den politischen Systemen sind relativ groß. Dem präsidentiellen System der Vereinigten Staaten steht in Deutschland ein parlamentarisches gegenüber. Anhand der Vetospielertheorie lassen sich diese beiden Systeme im Politikfeld der Gesundheit vergleichen und die These lässt sich anhand dieses Vergleiches überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vetospielertheorie
- Stabilität im Politikfeld „Gesundheit“
- Gesundheitsreformen in der BRD
- Gesundheitsreformen in den USA
- Vetospieler in der BRD und den USA
- Vetospieler in der BRD
- Vetospieler in den USA
- Vergleich im Politikfeld Gesundheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Anzahl von Vetospielern auf die Stabilität von Entscheidungen im Kontext der Gesundheitspolitik. Dabei untersucht sie die These, dass eine höhere Anzahl von Vetospielern zu einer größeren Stabilität von politischen Entscheidungen führt.
- Vetospielertheorie als theoretisches Fundament
- Analyse der Gesundheitspolitik in der BRD und den USA
- Identifizierung von Vetospielern in beiden Ländern
- Vergleich der Policy-Stabilität im Kontext der Gesundheitspolitik
- Überprüfung der These anhand empirischer Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die These der Arbeit vor, die den Zusammenhang zwischen der Anzahl von Vetospielern und der Policy-Stabilität im Bereich der Gesundheitspolitik untersucht. Kapitel 2 gibt eine detaillierte Einführung in die Vetospielertheorie von George Tsebelis. Es werden die zentralen Annahmen, Konzepte und Theoreme der Theorie dargestellt, die die Grundlage für die Analyse bilden.
Kapitel 3 fokussiert auf die Stabilität der Gesundheitspolitik in der BRD und den USA. Es werden die wichtigsten Gesundheitsreformen in beiden Ländern im Zeitraum von 1945 bis 2010 beleuchtet.
Kapitel 4 identifiziert die Vetospieler im Politikfeld Gesundheit in der BRD und den USA. Dabei wird die Rolle von institutionellen und parteipolitischen Akteuren im Gesetzgebungsprozess betrachtet.
Schlüsselwörter
Vetospielertheorie, Policy-Stabilität, Gesundheitspolitik, BRD, USA, Gesundheitsreformen, institutionelle Vetospieler, parteipolitische Vetospieler.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Vetospielertheorie von George Tsebelis?
Die Theorie besagt, dass die Stabilität politischer Entscheidungen (Policy-Stabilität) von der Anzahl, der ideologischen Distanz und der Kohäsion der Vetospieler in einem System abhängt.
Wer gilt als Vetospieler?
Vetospieler sind Akteure, deren Zustimmung für eine Änderung des Status quo notwendig ist. Man unterscheidet institutionelle (z. B. Bundesrat) und parteipolitische Vetospieler.
Wie beeinflusst die Anzahl der Vetospieler Gesundheitsreformen?
Je mehr Vetospieler zustimmen müssen, desto schwieriger ist es, weitreichende Reformen durchzusetzen. Dies führt oft zu einer hohen Stabilität des bestehenden Systems, aber auch zu Reformstau.
Warum sind die USA und Deutschland gute Vergleichsbeispiele?
Sie haben unterschiedliche politische Systeme (präsidentiell vs. parlamentarisch) und Gesundheitssysteme, was die Überprüfung der Vetospielertheorie bei großen Reformen wie „Obamacare“ ermöglicht.
Was ist Policy-Stabilität?
Policy-Stabilität beschreibt die Schwierigkeit, bestehende politische Regelungen (den Status quo) zu verändern. Hohe Stabilität bedeutet, dass Reformen selten oder nur in kleinen Schritten erfolgen.
- Quote paper
- Dipl. Math. Tobias Pisch (Author), 2012, Wie wirkt sich die Anzahl der Vetospieler auf die Stabilität von Entscheidungen im Kontext der Gesundheitspolitik aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192012