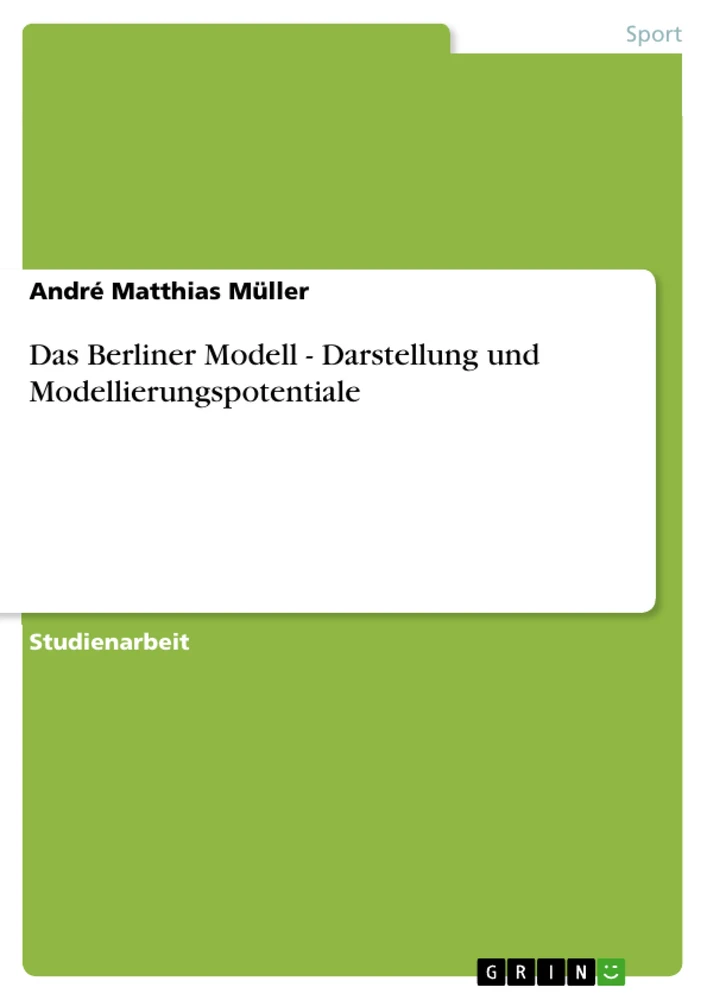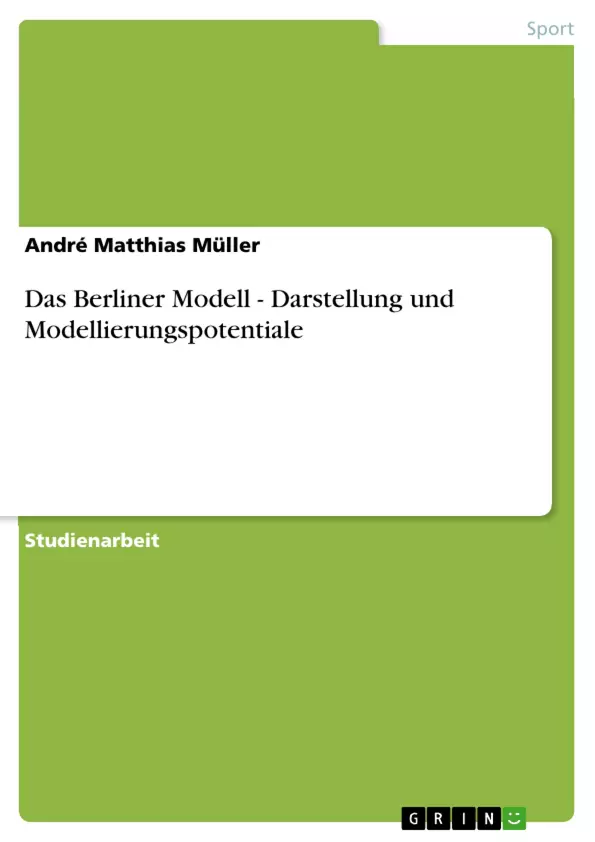Acht Stunden pro Tag, fünf Tage in der Woche und, wenn die sich herauskristallisierenden Forderungen nach einem höheren Rentenalter wahr werden, verbringt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer bis zu 50 Jahre des Lebens an seinem Arbeitsplatz. Es ist kein Geheimnis, dass diese Zeit erwartungsgemäß nicht spurlos an den Werktätigen vorbeigeht. Sowohl körperliche als auch psychische Beeinträchtigungen setzen nahezu automatisch ein. Smith et al. halten treffend fest: „There are important physiological, biochemical, somatic and psychological indicators of stress related to work activities“ (S.157). Die vorliegende Literaturarbeit hat allerdings nicht die Aufgabe die Arbeitsplatzpathologie und ihre Auswirkungen detailliert zu beschreiben. Vielmehr soll anhand von verschiedenen Instrumentarien aufgezeigt werden, wie es möglich ist wirkungsvoll in den Teufelskreis von Arbeitsbeschwerden einzugreifen. Im Zentrum der Betrachtungen wird sich der Gesundheitszirkel nach dem Berliner Modell von Franz Friczewski wiederfinden. Dieser „kommunikativ ausgerichtete“ (Friczewski, 1994, S. 15) Ansatz, der physiologische Interventionen erst in zweiter Instanz für sinnvoll erachtet, soll zunächst in seinem Wesen darstellend erklärt und eingeordnet werden, um im Anschluss synergetische Modellierungspotentiale aufzuzeigen. Die Hauptuntersuchungsfrage soll demnach lauten: Wie lässt sich der Berliner Ansatz in seiner Effektivität und Akzepttanz noch aufwerten? Die Relevanz dieser Fragestellung lässt sich gleich aus mehreren Perspektiven begründen. Erstens können wirksame „Kostensenkungsprogramme“ (Wilke, 2007, S. 24) von Seiten der Unternehmensleitung nur begrüßt werden. Zweitens birgt die gesundheitsfördernde Organisation positive Imagegewinne, die der Marketingstrategie zuträglich sein können. Drittens zeigt der bedürfnisadäquate Umgang mit der „Ressource Mensch“ (Friczewski, 1996, S. 3) dem einzelnen Mitarbeiter, wie bedeutsam er für das Gesamtunternehmen ist und veranlasst ihn so zu intrinsischer Motivation und einer Art Betriebssolidarität. Letztendlich stellt jedoch das alleinige Wohlergehen jedes Beschäftigten den größten Nutzen innerhalb gesundheitsförderlicher Unternehmensphilosophie dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Arbeitskreis Gesundheit
- Der Gesundheitsbericht
- Der betriebliche Gesundheitszirkel
- Das Berliner Modell
- Ein ganz normaler Arbeitstag
- Mitarbeiterperspektive
- Meister- und Planerperspektive
- Unternehmensperspektive
- Ansatzpunkte des Berliner Modells
- konkretes Vorgehen
- Basisphase
- Umsetzungs-Phase
- Ein ganz normaler Arbeitstag
- Modellierungspotentiale
- Rhythmisieren moderner Arbeit
- Perspektivwechsel
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Berliner Modell der betrieblichen Gesundheitsförderung und untersucht dessen Anwendung und Modellierungspotentiale. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Modells und der Aufzeigung von Möglichkeiten, dessen Effektivität und Akzeptanz zu verbessern.
- Das Berliner Modell als Ansatz zur betrieblichen Gesundheitsförderung
- Die verschiedenen Perspektiven auf einen Arbeitstag im Kontext des Berliner Modells
- Die konkrete Umsetzung des Modells in der Praxis
- Modellierungspotentiale des Berliner Modells im Hinblick auf die Rhythmisierung moderner Arbeit und Perspektivwechsel
- Die Relevanz des Berliner Modells für Unternehmen und Mitarbeiter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von betrieblicher Gesundheitsförderung im Kontext der steigenden Belastung am Arbeitsplatz. Der Fokus liegt auf dem Berliner Modell von Franz Friczewski, das als "kommunikativ ausgerichteter" Ansatz den Schwerpunkt auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen legt.
Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung und die wichtigsten Elemente der betrieblichen Gesundheitsförderung, darunter der Arbeitskreis Gesundheit, der Gesundheitsbericht und der Gesundheitszirkel. Dabei werden die verschiedenen Perspektiven und Handlungsfelder der beteiligten Akteure beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Berliner Modell. Es beschreibt die verschiedenen Perspektiven auf einen "normalen" Arbeitstag, die Ansatzpunkte des Modells und die konkrete Vorgehensweise in den Phasen der Basisphase und der Umsetzungsphase.
Kapitel 4 untersucht die Modellierungspotentiale des Berliner Modells. Es fokussiert auf die Rhythmisierung moderner Arbeit und den Perspektivwechsel als zentrale Aspekte für die Optimierung des Modells.
Schlüsselwörter
Betriebliche Gesundheitsförderung, Berliner Modell, Gesundheitszirkel, Arbeitskreis Gesundheit, Gesundheitssport, Franz Friczewski, Rhythmisieren moderner Arbeit, Perspektivwechsel, Mitarbeitermotivation, Unternehmenskultur, Kostensenkungsprogramme
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Berliner Modell der Gesundheitsförderung?
Es ist ein von Franz Friczewski entwickelter kommunikativer Ansatz für betriebliche Gesundheitszirkel, bei dem die Analyse der Arbeitsbedingungen durch die betroffenen Mitarbeiter im Zentrum steht.
Wie funktioniert ein Gesundheitszirkel nach diesem Modell?
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen kommen zusammen, um in einer Basisphase Belastungen zu identifizieren und in einer Umsetzungsphase konkrete Verbesserungsvorschläge für den Arbeitsalltag zu entwickeln.
Welchen Nutzen haben Unternehmen von diesem Modell?
Neben der Senkung von Krankheitskosten führt die Beteiligung der Mitarbeiter zu höherer intrinsischer Motivation, besserer Betriebssolidarität und einem positiven Imagegewinn.
Was bedeutet „Rhythmisieren moderner Arbeit“?
Es ist ein Modellierungspotenzial des Berliner Modells, das darauf abzielt, Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass sie den menschlichen Bedürfnissen und physiologischen Rhythmen besser entsprechen.
Warum ist der Perspektivwechsel im Berliner Modell wichtig?
Der Austausch zwischen Mitarbeitern, Meistern und Planern ermöglicht ein ganzheitliches Verständnis der Belastungen und fördert akzeptierte Lösungen für gesundheitliche Probleme am Arbeitsplatz.
- Citation du texte
- Master of Arts André Matthias Müller (Auteur), 2008, Das Berliner Modell - Darstellung und Modellierungspotentiale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192081