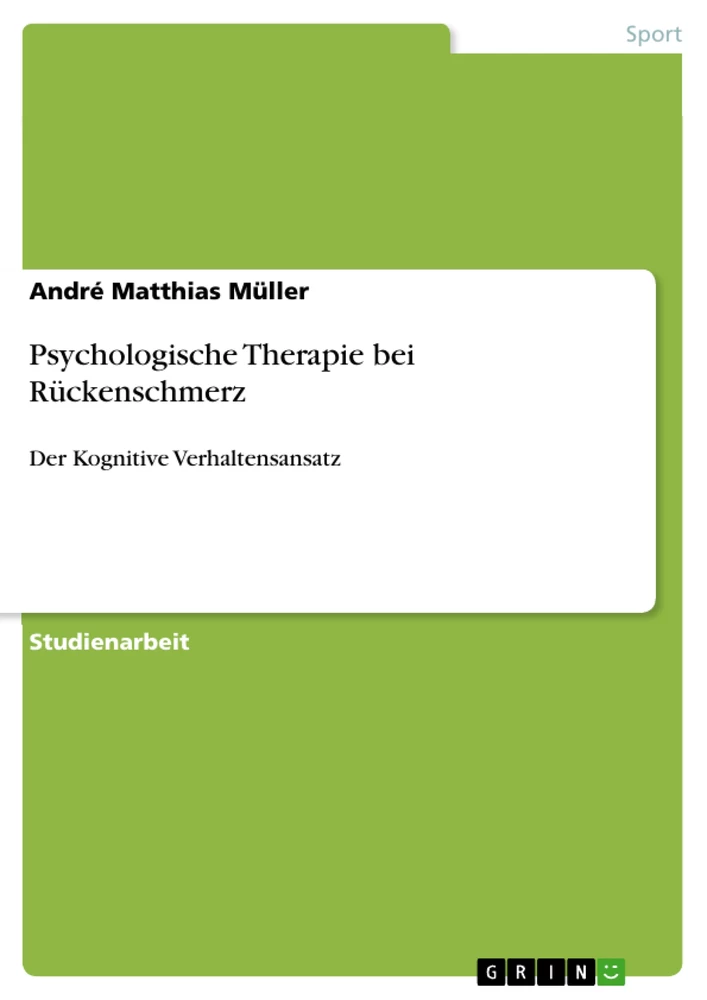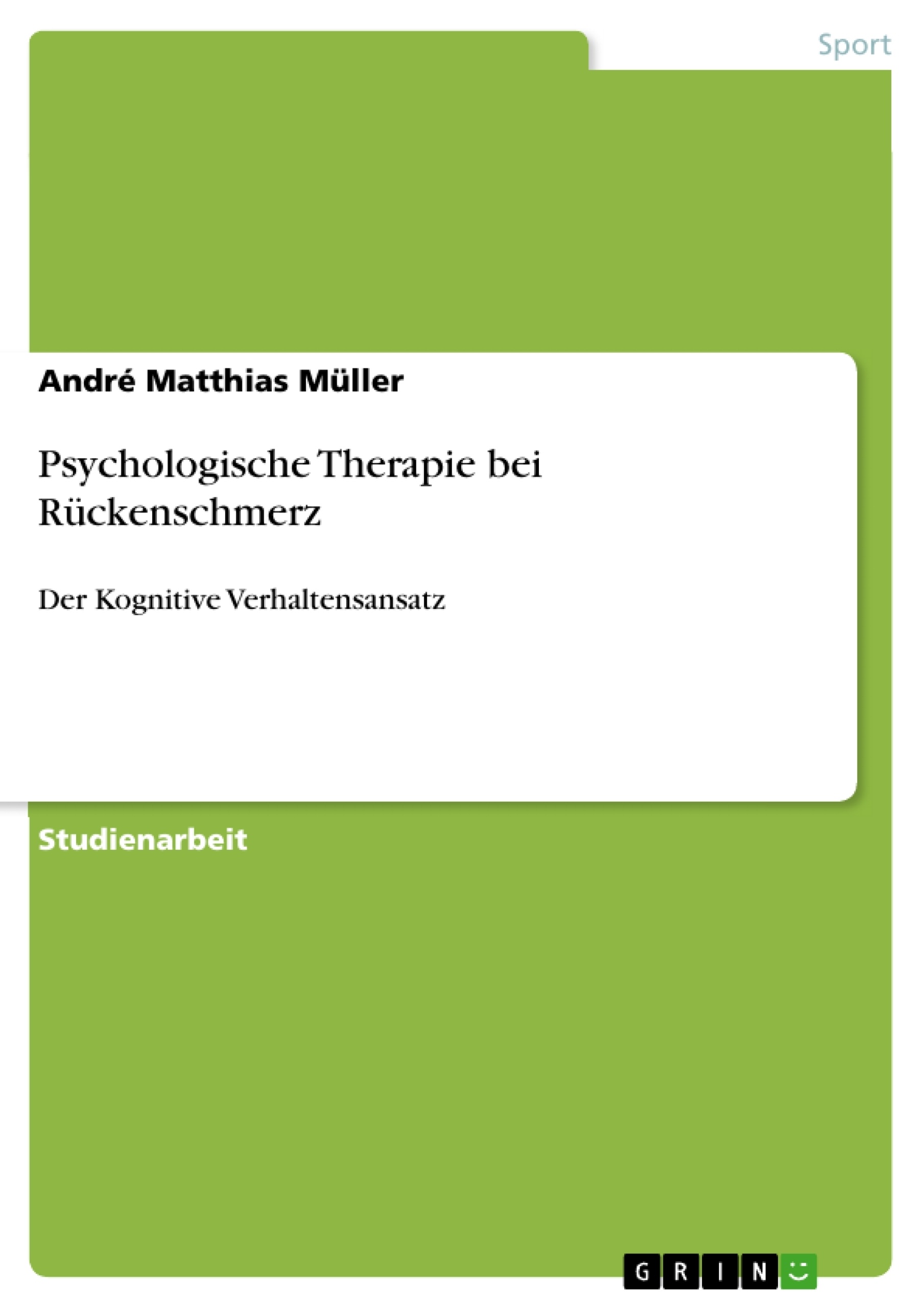Wenn in früherer Zeit der Ausdruck Epidemie gebraucht wurde, verbargen sich dahinter Erkrankungen wie Cholera oder die Pest. Krankheiten, welche heute keine bedeutende Prävalenz mehr besitzen, aber durch ein anderes Phänomen ersetzt wurden.
Der Rückenschmerz, besonders in seiner chronischen Ausformung, ist zu einem ausufernden, sozioökonomischen Problem der hoch entwickelten Nationen geworden (vgl. Göbel, 2001, S. 93). Grönemeyer (2006, S. 15) zeigt einige wichtige Fakten auf, welche die Brisanz der Situation verdeutlichen:
• 71,5 Millionen Arbeitstage fallen wegen Rückenschmerzen jährlich in Deutschland aus
• 35 Prozent der jüngeren Bevölkerung haben vorgefallene oder degenerierte Bandscheiben
• In Deutschland werden jährlich 60.000 Bandscheiben operiert
Rückenleiden bedeuten folglich nicht nur für das Individuum eine Bedrohung, sondern fordern explizit das Gesundheitssystem und seine Partner heraus. Sowohl Ärzte, Therapeuten und medizinisches Personal, als auch die Kostenträger stehen den wachsenden Inzidenzraten bisher nahezu machtlos gegenüber. Treffend äußert sich Waddell (zitiert nach Grönemeyer, 2006, S. 19), dass „[…] Rückenschmerzen die medizinische Niederlage des 20. Jahrhunderts seien“.
Eine Ursache jener unbefriedigenden Lage kann in einem vorherrschenden, kausalen Denkmodell gesehen werden. Der Glaube eines „[…] linearen Zusammenhanges zwischen körperlicher Schädigung und empfundenem Schmerz bzw. einhergehender Funktionseinschränkung […]“ (Kröner-Herwig, 1999, S. 68) ist weitestgehend in den Köpfen aller Beteiligten verankert.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, das gerade erwähnte, medizinisch geprägte Modell zu hinterfragen, um im Anschluss die Partizipationsmöglichkeiten eines kognitiv-behavioralen Ansatzes zu beleuchten. Hypothetisch lässt sich fixieren, dass der „mehrdimensional“ (Kröner-Herwig, 1999, S. 68) ausgerichtete Ansatz das Problem Rückenschmerz wirkungsvoller behandeln kann, als dies herkömmliche Methoden vermögen. Ob es sogar möglich ist, mithilfe kognitiv-verhaltenstherapeutischer Maßnahmen eine vollständige Remission zu erwirken, soll im Laufe der Arbeit erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Terminologie
- Psychologische Therapie
- Was bedeutet Schmerz?
- Die Medizin auf dem Prüfstand
- Vorstellungen des Arztes
- Vorstellungen des Patienten
- Schlussfolgerungen
- Grundideen der kognitiven Verhaltenstherapie
- Mehrdimensionalität
- Physiologisch-somatische Komponente
- Psychologische Komponente
- Behaviorale Komponente
- Soziale Komponente
- Selbstkontrollüberzeugung
- Mobilitätsförderung
- Mehrdimensionalität
- Praktische Umsetzung des kognitiven Verhaltensansatzes
- Diagnostische Phase
- Aufbau eines neuen kognitiven Modells
- Aneignung von Bewältigungsfertigkeiten
- Entspannungstraining
- Vermittlung von kognitiv-behavioralen Bewältigungsstrategien
- Medikamentenreduktion
- Aktivitätsmodifikation
- Integration von Bezugspersonen
- Anwendung und Transfer
- Aufrechterhaltung und Rückfallprävention
- Fazit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychologischen Therapie von Rückenschmerzen unter Anwendung des kognitiven Verhaltensansatzes. Sie hinterfragt das gängige medizinische Modell, das einen linearen Zusammenhang zwischen körperlicher Schädigung und Schmerz annimmt, und untersucht die Möglichkeiten einer multidimensionalen Interventionsstrategie. Das Ziel ist es, die Wirksamkeit des kognitiv-behavioralen Ansatzes bei der Behandlung von chronischen Rückenschmerzen aufzuzeigen und zu erörtern, ob eine vollständige Remission durch diese Therapieform erreicht werden kann.
- Kritisches Hinterfragen des medizinischen Modells zur Behandlung von Rückenschmerzen
- Einführung des kognitiv-behavioralen Ansatzes als multidimensionale Therapieform
- Analyse der Komponenten des kognitiv-behavioralen Ansatzes und ihrer Anwendung in der Praxis
- Bewertung des Potenzials des kognitiv-behavioralen Ansatzes bei der Bewältigung chronischer Rückenschmerzen
- Untersuchung der Möglichkeiten zur Erreichung einer vollständigen Remission durch den Einsatz kognitiv-behavioraler Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Rückenschmerzes als sozioökonomisches Problem ein und stellt die Notwendigkeit eines neuen Behandlungsansatzes in Frage. Das Kapitel „Terminologie“ definiert zentrale Begriffe wie „Psychologische Therapie“ und „Schmerz“ und schafft somit eine gemeinsame Basis für die weiteren Ausführungen.
Der Abschnitt „Die Medizin auf dem Prüfstand“ befasst sich mit den unterschiedlichen Perspektiven von Ärzten und Patienten auf Rückenschmerzen und kritisiert das vorherrschende kausale Denkmodell. Die „Grundideen der kognitiven Verhaltenstherapie“ stellen den multidimensionalen Ansatz vor, der physiologische, psychologische, behaviorale und soziale Komponenten umfasst.
Das Kapitel „Praktische Umsetzung des kognitiven Verhaltensansatzes“ erläutert die verschiedenen Phasen der Therapie, die von der Diagnostik über den Aufbau eines neuen kognitiven Modells bis hin zur Aneignung von Bewältigungsfertigkeiten reichen. Die Ausführungen fokussieren auf die Entwicklung von Entspannungstechniken, kognitiv-behavioralen Strategien sowie Maßnahmen zur Medikamentenreduktion und Aktivitätsmodifikation. Zudem wird die Bedeutung der Einbindung von Bezugspersonen in den Therapieprozess betont.
Schlüsselwörter
Chronische Rückenschmerzen, kognitiv-behavioraler Ansatz, multidimensionale Therapie, psychologische Komponenten, behaviorale Komponenten, Selbstkontrollüberzeugung, Mobilitätsförderung, Bewältigungsfertigkeiten, Entspannungstraining, Medikamentenreduktion, Aktivitätsmodifikation, Remission, integrativer Therapieansatz.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Rückenschmerz ein sozioökonomisches Problem?
Aufgrund von Millionen ausgefallener Arbeitstage, hohen Operationszahlen (60.000 jährlich in DE) und massiven Kosten für das Gesundheitssystem.
Was kritisiert der Autor am herkömmlichen medizinischen Modell?
Kritisiert wird das lineare Denken, das Schmerz allein auf körperliche Schäden zurückführt und psychologische sowie soziale Faktoren vernachlässigt.
Wie hilft kognitive Verhaltenstherapie (KVT) bei Rückenschmerzen?
KVT setzt auf Mehrdimensionalität: Sie bearbeitet negative Gedanken, fördert die Mobilität, schult Bewältigungsstrategien und integriert Entspannungstraining.
Was ist die „Selbstkontrollüberzeugung“?
Es ist der Glaube des Patienten, durch eigenes Handeln und Strategien Einfluss auf das Schmerzgeschehen nehmen zu können, statt passiv auf Heilung zu warten.
Ist eine vollständige Remission durch Psychotherapie möglich?
Die Arbeit erörtert, dass verhaltenstherapeutische Maßnahmen die Lebensqualität massiv steigern und Schmerzzustände deutlich reduzieren können, was einer Remission nahekommt.
- Citation du texte
- Master of Arts André Matthias Müller (Auteur), 2009, Psychologische Therapie bei Rückenschmerz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192082