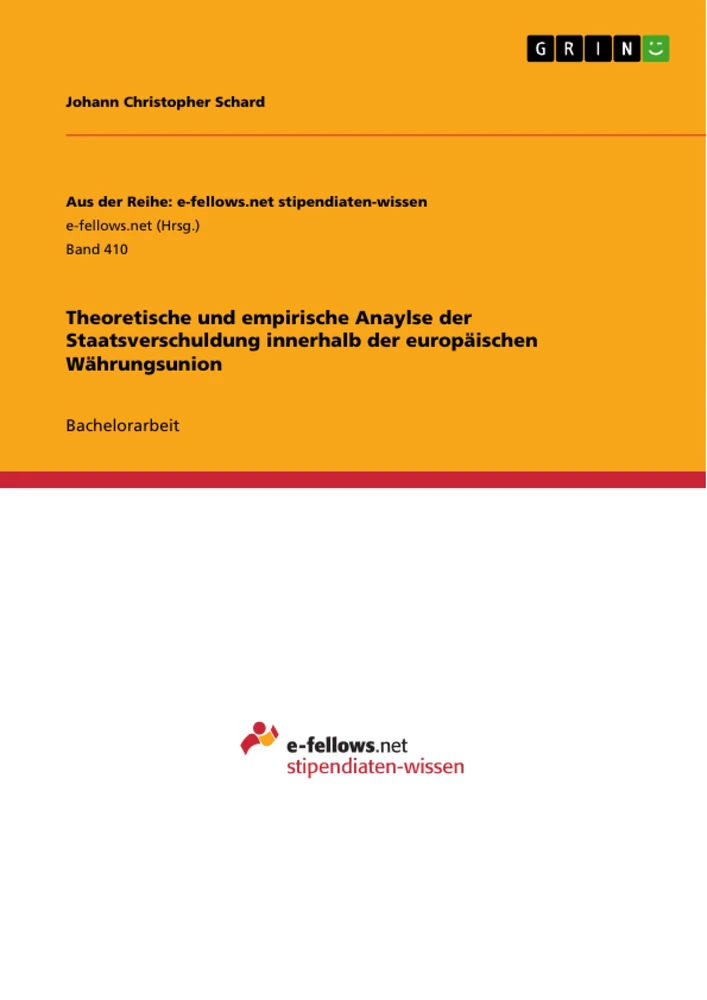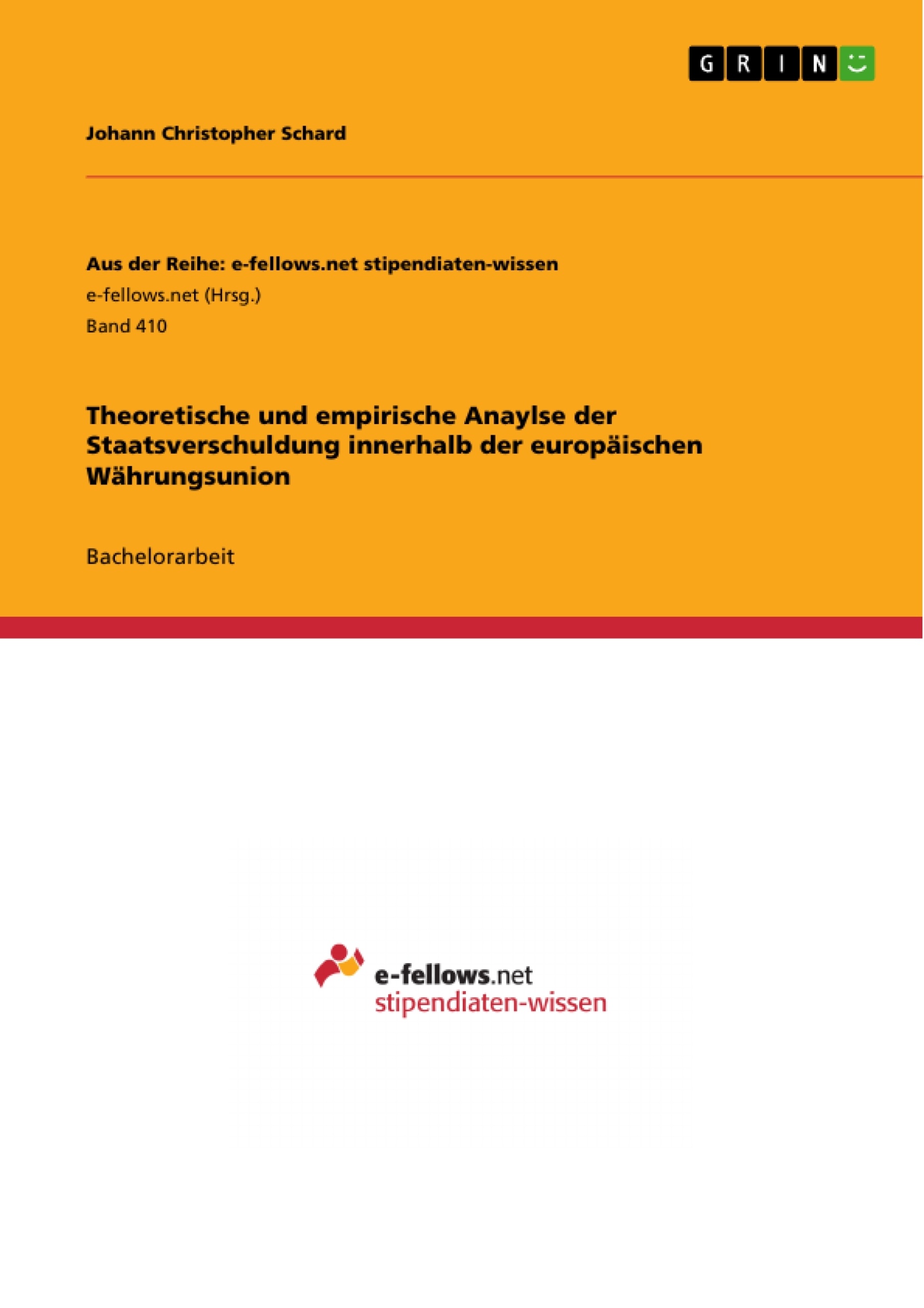Steht die Europäische Währungsunion vor dem Abgrund? Sind die über die Jahre angehäuften öffentlichen Schulden überhaupt noch bewältigbar?
Diese Fragen, die man so oder ähnlich im Sommer 2011 täglich hören kann, werden in der folgenden Ausarbeitung genauer betrachtet. In den ersten Kapiteln wird erklärt, welche Formen von Staatsverschuldung es gibt, dies wird algebraisch soweit wie möglich dargestellt. Darauf aufbauend wird gezeigt, von welchen Parametern die Tragfähigkeit (Sustainability) der öffentlichen Verschuldung abhängt. Die Ausarbeitung besteht aus einem Theorieteil, der den Schwerpunkt der Arbeit ausmacht und einem Empirieteil. Im Theorieteil werden verschiedene Ansätze aufgegriffen, bei denen es grundsätzlich darum geht, die Auswirkungen einer zunehmenden Staatsverschuldung auf makroökonomische Variablen und auf interpersonale und intergenerationelle Verteilungswirkungen zu erklären. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, ob Staatsverschuldung per se gut oder schlecht ist. Die Ansätze kommen dabei zu heterogenen Ergebnissen. Es findet eine Fokussierung auf fiskalpolitische Aktivitäten statt. Auf die Ursache der Staatsverschuldung gehen diese Ansätze wenig bis gar nicht ein.
Im Empirieteil wird, anhand verschiedener relevanter Werte für die öffentliche Verschuldung, die Entwicklung einiger Länder der Währungsunion betrachtet. Dafür wird zunächst auf den historischen Prozess der Entstehung des einheitlichen Währungsraums ab dem Vertrag von Maastricht und später dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) eingegangen. Dieser Prozess soll als übergeordnetes Ziel der Begrenzung der öffentlichen Schulden dienen. Dabei wird auch nicht außer Acht gelassen, welche Probleme es bei diesem Prozess gegeben hat und gibt. Insbesondere die Nichtbeistandsklausel (No-Bail-Out-Klausel) wird dabei genauer untersucht. Betrachtet werden darüber hinaus weitere Begrenzungsmöglichkeiten der öffentlichen Verschuldung. Beispielhaft wird in verschiedenen Abschnitten der Ausarbeitung Griechenland herausgegriffen und punktuell genauer analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eingrenzung des Begriffs Staatsverschuldung
- Algebra der expliziten Staatsverschuldung
- Implizite Staatsverschuldung
- Tragfähigkeit der Staatsschulden
- Ricardianisches Äquivalenztheorem
- Kritik an dem ricardianischen Äquivalenztheorem
- Ricardo-Barro-Äquivalenztheorem
- "Neue Orthodoxie" und Buchanans Kritik
- "Neue Orthodoxie"
- Differenzierung zwischen privaten und öffentlichen Schulden
- Differenzierung zwischen Inland- und Auslandstaatsverschuldung
- Lastentragung der öffentlichen Schulden durch verursachende Generation
- Buchanans Kritik
- Analogie zwischen privaten und öffentlichen Schulden
- Betrachtung der Inland- und Auslandstaatsverschuldung
- Lastentragung der öffentlichen Schuld durch zukünftige Generationen
- Stellvertretertheorie
- Die konventionelle Sicht: kurzfristige und langfristige Wirkung von öffentlichen Schulden
- "Ponzi-Spiel"
- Entwicklung und Schranken der Staatsverschuldung
- Maastricht-Kriterien und Stabilitäts- und Wachstumspakt
- No-Bail-Out-Klausel (Nichtbeistandsklausel)
- Analyse der Schuldenproblematik Griechenlands
- Sonstige Begrenzungsvorschläge
- "Goldene Regel"
- Insolvenzrecht für Staaten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Staatsverschuldung innerhalb der Europäischen Währungsunion sowohl theoretisch als auch empirisch zu analysieren. Dabei werden verschiedene ökonomische Ansätze und Theorien beleuchtet, um die Auswirkungen von Staatsverschuldung auf die Wirtschaft und Gesellschaft zu untersuchen. Im Fokus stehen die Auswirkungen von Staatsverschuldung auf die Wirtschaftsentwicklung, die Steuerpolitik und die Verteilung von Lasten zwischen Generationen.
- Theoretische Modellierung von Staatsverschuldung
- Ricardianische Äquivalenz und alternative Ansätze
- Empirische Analyse der Staatsverschuldung in der EU
- Tragfähigkeit von Staatsschulden und deren Auswirkungen
- Die Rolle von Institutionen und Politik bei der Bewältigung von Staatsverschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Analyse sowie die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Anschließend wird der Begriff der Staatsverschuldung eingegrenzt und in die verschiedenen Formen der Staatsverschuldung differenziert. Im Anschluss daran werden verschiedene ökonomische Theorien zur Staatsverschuldung beleuchtet, darunter das ricardianische Äquivalenztheorem, die "Neue Orthodoxie" und Buchanans Kritik, sowie die Stellvertretertheorie. Darüber hinaus werden die konventionellen Sichtweisen auf die kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen von Staatsverschuldung dargestellt. Abschließend wird das "Ponzi-Spiel" als problematisches Szenario für die Entwicklung von Staatsverschuldung erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Staatsverschuldung, der Europäischen Währungsunion und der ökonomischen Theorie. Hierzu zählen insbesondere die Begriffe Staatsverschuldung, Staatsdefizit, ricardianische Äquivalenz, "Neue Orthodoxie", Buchanans Kritik, Stellvertretertheorie, Tragfähigkeit von Staatsschulden, Maastricht-Kriterien, Stabilitäts- und Wachstumspakt, No-Bail-Out-Klausel, Schuldenproblematik Griechenlands, "Goldene Regel" und Insolvenzrecht für Staaten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen expliziter und impliziter Staatsverschuldung?
Explizite Verschuldung umfasst die offiziell ausgewiesenen Schuldenstände, während implizite Verschuldung künftige Leistungsverpflichtungen (z.B. Rentenansprüche) bezeichnet.
Was besagt das Ricardianische Äquivalenztheorem?
Es besagt, dass die Form der Finanzierung (Steuern oder Schulden) keinen Einfluss auf den Konsum hat, da Bürger künftige Steuererhöhungen zur Schuldentilgung antizipieren und heute mehr sparen.
Welche Bedeutung haben die Maastricht-Kriterien?
Die Kriterien begrenzen das jährliche Haushaltsdefizit auf 3% und den Gesamtschuldenstand auf 60% des BIP, um die Stabilität der Währungsunion zu gewährleisten.
Was ist die No-Bail-Out-Klausel?
Die Nichtbeistandsklausel besagt, dass weder die EU noch andere Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten eines anderen Staates haften oder für diese aufkommen müssen.
Was versteht man unter der "Goldenen Regel" der Staatsverschuldung?
Die Regel besagt, dass Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden sollten, die auch künftigen Generationen zugutekommen, während laufende Ausgaben durch Steuern zu decken sind.
Warum wird Buchanans Kritik an der "Neuen Orthodoxie" angeführt?
James Buchanan kritisierte die Ansicht, Schulden seien harmlos, und betonte die Lastenverschiebung auf künftige Generationen sowie die Analogie zwischen privaten und öffentlichen Schulden.
- Citation du texte
- Johann Christopher Schard (Auteur), 2011, Theoretische und empirische Anaylse der Staatsverschuldung innerhalb der europäischen Währungsunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192157