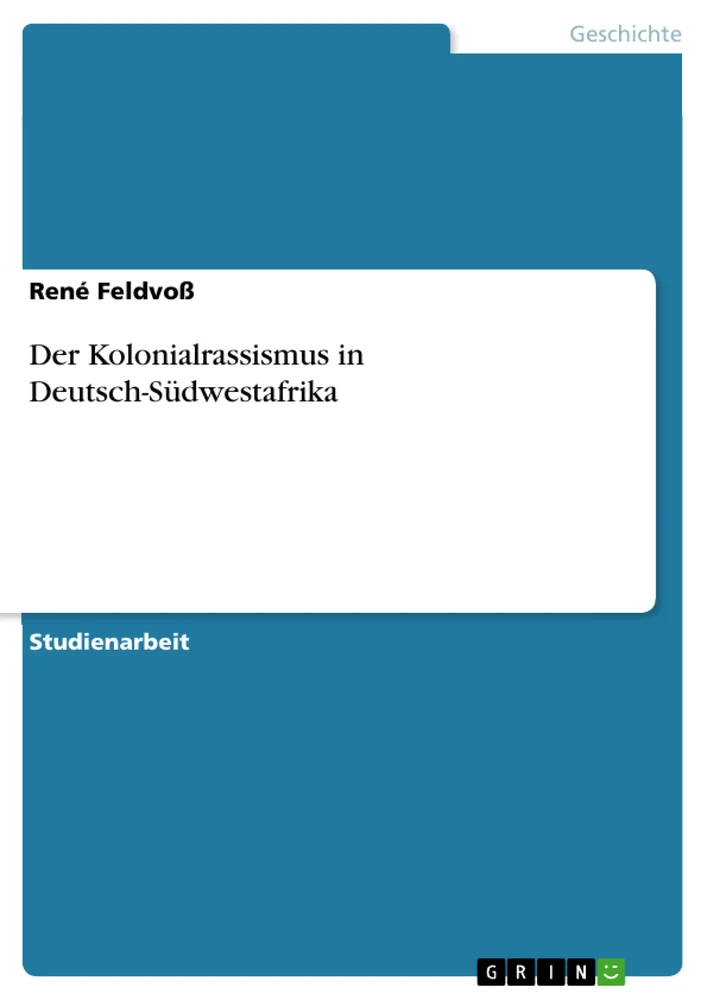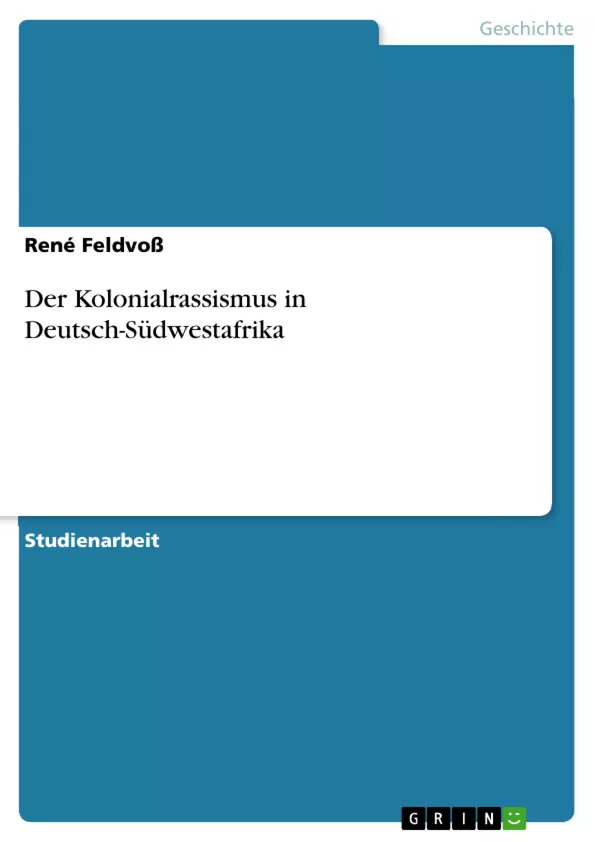Der deutsche Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika war nicht nur die praktische Anwendung rassistisch legitimierter Herrschaftsansprüche, sowie die logische Fortführung des, gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer populärer werdenden, Sozialdarwinismus, sondern diente zu einem nicht unerheblichen Anteil auch der Durchsetzung wirtschaftlich motivierter Interessen der deutschen Siedlergemeinschaft.
Die Machtansprüche der deutschen Kolonisatoren in Deutsch-Südwestafrika (und auch in den übrigen Kolonien) lagen größtenteils in der Überzeugung, dass die Afrikaner einer „minderwertigen Rasse“ angehörten und es ein „natürliches Verhältnis“ zwischen der herrschenden weißen und der beherrschten schwarzen Rasse gäbe.1 Diese Rassentheorien waren somit also eine absolute Voraussetzung für die Annexion überseeischer Gebiete und die Unterwerfung der dort lebenden Bevölkerung.
Doch auch die Übernahme rassistischen Gedankenguts aus den Nachbarkolonien der übrigen europäischen Kolonialmächte beeinträchtigte die rigide Herrschaftspolitik der deutschen Kolonialbeamten.2 Besonders der Herrschaftsverlust der spanischen und portugiesischen Kolonien diente als warnendes Beispiel für eine zu laxe Herrschaftspolitik gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Dadurch, dass in Fragen betreffend der „Mischehe“ und der „Mischlingskinder“ mit zu viel Nachsicht gehandelt wurde, sahen die deutschen Kolonialbeamten das Scheitern anderer europäischer Kolonialmächte begründet und damit den praktizierten Rassismus legitimiert.3
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Lage für den männlichen Siedler in Deutsch-Südwestafrika
- Die „Bedrohung durch die Mischlinge“
- Die rechtliche Stellung von „Eingeborenen“
- Das „Verkaffern“
- Vorurteile gegenüber der afrikanischen Bevölkerung und Rassentheorien um die Jahrhundertwende
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den deutschen Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika, seine Auswirkungen auf die afrikanische Bevölkerung und insbesondere die Rolle von Mischehen und "Mischlingskindern". Die Studie beleuchtet die wirtschaftlichen und politischen Motive hinter der rassistischen Politik und analysiert die rechtlichen und gesellschaftlichen Folgen des Mischehenverbots.
- Der Einfluss des Frauenmangels unter den deutschen Siedlern auf die Bildung von Beziehungen mit afrikanischen Frauen.
- Die rechtlichen und sozialen Folgen des Mischehenverbots von 1907.
- Die Rolle von Rassentheorien und Vorurteilen in der Legitimation der Kolonialherrschaft.
- Die Bedeutung wirtschaftlicher Interessen der deutschen Siedlergemeinschaft.
- Die Auswirkungen der "Verkafferung" auf die Kolonisten und die afrikanische Bevölkerung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des deutschen Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika ein. Sie betont die Verknüpfung von rassistischen Herrschaftsansprüchen, Sozialdarwinismus und wirtschaftlichen Interessen der deutschen Siedler. Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Frauenmangels unter den deutschen Siedlern, die Folgen des Mischehenverbots und die Rolle von Rassentheorien an.
Die Lage für den männlichen Siedler in Deutsch-Südwestafrika: Dieses Kapitel analysiert den eklatanten Mangel an weißen Frauen in Deutsch-Südwestafrika und die daraus resultierenden Beziehungen zwischen deutschen Männern und afrikanischen Frauen. Es wird gezeigt, dass diese Beziehungen sowohl wirtschaftliche Vorteile für die deutschen Siedler als auch strategische Vorteile für afrikanische Familienoberhäupter mit sich brachten. Die Diskussion umfasst die Frage der Freiwilligkeit solcher Verbindungen im Kontext des Machtgefälles zwischen Kolonisten und Kolonisierten.
Die „Bedrohung durch die Mischlinge“: Das Kapitel behandelt die Angst der deutschen Kolonisten vor dem zahlenmäßigen Übergewicht einer "Mischlingsbevölkerung" und die damit verbundenen Repressalien gegen Männer mit afrikanischen Ehefrauen oder sexuellen Beziehungen zu afrikanischen Frauen. Das Mischehenverbot von 1907 wird als konkreter Ausdruck dieser Angst dargestellt, zusammen mit den daraus resultierenden Diskriminierungen über Generationen hinweg.
Schlüsselwörter
Deutscher Kolonialrassismus, Deutsch-Südwestafrika, Mischehen, Mischlingskinder, Mischehenverbot, Rassentheorien, Sozialdarwinismus, Frauenmangel, wirtschaftliche Interessen, Herero- und Namaaufstände, "Verkafferung", Kolonialherrschaft, weiße Privilegiengesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Deutscher Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht den deutschen Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika, seine Auswirkungen auf die afrikanische Bevölkerung und insbesondere die Rolle von Mischehen und „Mischlingskindern“. Sie beleuchtet die wirtschaftlichen und politischen Motive hinter der rassistischen Politik und analysiert die rechtlichen und gesellschaftlichen Folgen des Mischehenverbots.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Einfluss des Frauenmangels unter deutschen Siedlern auf Beziehungen mit afrikanischen Frauen, die rechtlichen und sozialen Folgen des Mischehenverbots von 1907, die Rolle von Rassentheorien und Vorurteilen, die Bedeutung wirtschaftlicher Interessen der deutschen Siedler und die Auswirkungen der „Verkafferung“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die Lage der männlichen Siedler, ein Kapitel über die „Bedrohung durch die Mischlinge“, ein Kapitel über die rechtliche Stellung von „Eingeborenen“, ein Kapitel zum Thema „Verkaffern“, ein Kapitel über Vorurteile und Rassentheorien und abschließend ein Fazit.
Was ist das Ziel der Studie?
Die Zielsetzung ist es, den deutschen Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika zu untersuchen, seine Auswirkungen auf die afrikanische Bevölkerung zu analysieren und die Rolle von Mischehen und „Mischlingskindern“ im Kontext der Kolonialherrschaft zu beleuchten. Die Studie möchte die Verknüpfung von Rassismus, Sozialdarwinismus und wirtschaftlichen Interessen aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Deutscher Kolonialrassismus, Deutsch-Südwestafrika, Mischehen, Mischlingskinder, Mischehenverbot, Rassentheorien, Sozialdarwinismus, Frauenmangel, wirtschaftliche Interessen, Herero- und Namaaufstände, „Verkafferung“, Kolonialherrschaft, weiße Privilegiengesellschaft.
Wie wird die „Verkafferung“ in der Studie behandelt?
Die Studie untersucht die Auswirkungen der „Verkafferung“ sowohl auf die Kolonisten als auch auf die afrikanische Bevölkerung. Die genauen Details der Behandlung dieses Themas sind in den Kapiteln der Studie zu finden.
Welche Rolle spielen Rassentheorien in der Studie?
Die Studie analysiert die Rolle von Rassentheorien und Vorurteilen in der Legitimation der Kolonialherrschaft und deren Einfluss auf die rechtlichen und gesellschaftlichen Diskriminierungen.
Wie wird der Frauenmangel unter den deutschen Siedlern behandelt?
Die Studie untersucht den eklatanten Mangel an weißen Frauen und die daraus resultierenden Beziehungen zwischen deutschen Männern und afrikanischen Frauen, einschließlich der wirtschaftlichen und strategischen Vorteile für beide Seiten und der Frage der Freiwilligkeit dieser Verbindungen im Kontext des Machtgefälles.
Welche Folgen hatte das Mischehenverbot von 1907?
Das Mischehenverbot von 1907 wird als Ausdruck der Angst vor einer zahlenmäßigen Übermacht der „Mischlingsbevölkerung“ dargestellt. Die Studie analysiert die konkreten rechtlichen und sozialen Folgen dieses Verbots sowie die daraus resultierenden Diskriminierungen über Generationen hinweg.
- Citation du texte
- René Feldvoß (Auteur), 2012, Der Kolonialrassismus in Deutsch-Südwestafrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192189