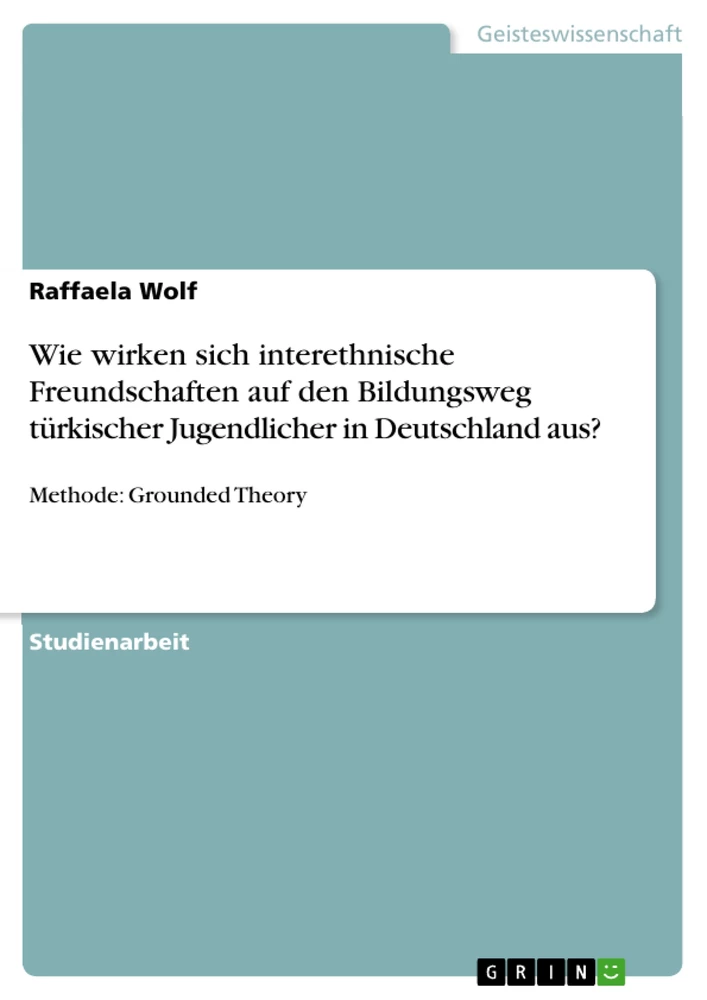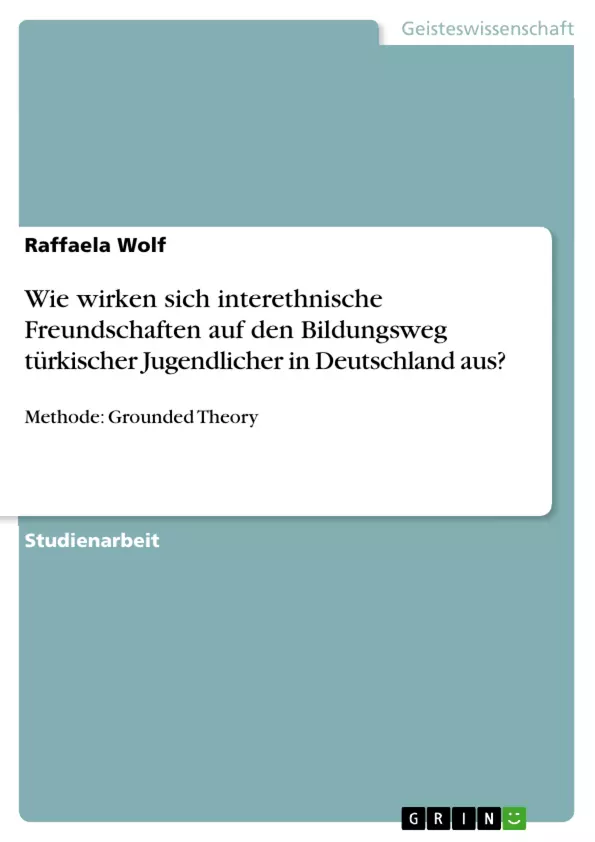Laut Pressemitteilung der Autorengruppe Bildungsberichterstattung zum „Bericht Bildung in Deutschland 2008“ vom 12. Juni 2008 beträgt der prozentuale Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Westdeutschland ca. 21%, in Ostdeutschland ca. 8%. Dabei macht die Gruppe der Türkinnen und Türken rund ein Viertel der ausländischen Bevölkerung aus (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, S. 15).
Analog dazu bilden türkische Kinder und Jugendliche die am stärksten vertretene Gruppe ethnischer Minderheiten an deutschen Schulen. Wie in den Jahren zuvor sind SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Real- und vor allem an Hauptschulen stark überrepräsentiert. Desweiteren verlassen im Vergleich zu deutschen SchülerInnen in etwa doppelt so viele ausländische Jugendliche die allgemeinbildende Schule, ohne einen Schulabschluss vorweisen zu können (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008, S. 17).
Die Benachteiligung türkischer Jugendlicher im deutschen Schulsystem hat unterschiedliche Ursachen, die sowohl in durch komplexe kulturelle Anforderungen erschwerten Identifikationsmöglichkeiten wie auch in sprachlicher Benachteiligung und sozio-ökonomischen Unterschieden zu suchen sind.
Die vorliegende Hausarbeit wird im Zuge des Modul 2A an der FernUniversität Hagen im Studiengang Bildungswissenschaft verfasst. Das übergeordnete Thema ist die Applikation einer qualitativen Methode der Sozialforschung auf eine frei gewählte Forschungsfrage. Auf dieser Grundlage befasst sich diese Arbeit unter Anwendung der Grounded Theory im weitesten Sinne mit den Bedingungen der Eingliederung türkischer Jugendlicher in das deutsche Bildungs- und Schulsystem. Es werden zwei Interviews aus der Shell-Jugendstudie 2000 (Fischer, Fritzsche, Fuchs-Heinritz, 2000) miteinander verglichen. Dabei wird näher auf die Frage eingegangen, welche Rolle interethnische Freundschaften bei der Teilhabe am deutschen Schulsystem spielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darlegung der Forschungsfrage
- 2.1 Aktueller Stand der Forschung
- 2.2 Bezugsliteratur
- 2.3 Hypothese
- 3. Methode
- 3.1 Darlegung der Methode
- 3.2 Begründung der Methodenwahl
- 4. Beschreibung der Art und Güte der Daten
- 5. Reflexion und Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Vorgehensweise und Erfahrungen mit der Datenanalyse
- 5.2 Inhaltliche Auswertung der Daten
- 5.2.1 Phase 1: Das offene Kodieren
- 5.2.2 Phase 2: Das selektive Kodieren
- 5.3 Diskussion der Ergebnisse in Hinblick auf die Forschungsfrage
- 5.4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss interethnischer Freundschaften auf den Bildungsweg türkischer Jugendlicher in Deutschland. Ziel ist es, mithilfe der Grounded Theory Methode, ausgehend von zwei Interviews der Shell-Jugendstudie 2000, Zusammenhänge zwischen diesen Freundschaften und der schulischen Integration aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die qualitative Analyse der Daten und vermeidet verallgemeinernde Aussagen.
- Auswirkungen interethnischer Freundschaften auf die schulische Integration türkischer Jugendlicher
- Anwendung der Grounded Theory Methode in der empirischen Bildungsforschung
- Analyse der Rolle von Freundschaften im Kontext von Migration und Bildung
- Bedeutung kultureller und sozioökonomischer Faktoren für den Bildungserfolg
- Möglichkeiten integrativer Maßnahmen im Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den hohen Anteil türkischer Jugendlicher im deutschen Schulsystem und deren Überrepräsentation an Hauptschulen sowie die hohe Abbruchquote. Sie führt in das Thema der Benachteiligung ein, die sowohl kulturelle als auch sprachliche und sozioökonomische Ursachen hat. Die Arbeit selbst wird als Anwendung qualitativer Methoden auf die Forschungsfrage nach dem Einfluss interethnischer Freundschaften auf den Bildungsweg dieser Jugendlichen vorgestellt.
2. Darlegung der Forschungsfrage: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage: Wie wirken sich interethnische Freundschaften auf den Bildungsweg türkischer Jugendlicher in Deutschland aus? Es wird der Fokus auf bikulturelle Freundschaften als intensive und positiv erlebte Kontakte gelegt. Die Relevanz der Forschungsfrage wird anhand des Mangels an expliziten Studien zu diesem Thema und im Kontext der Kontakthypothese von Allport begründet, wobei die Schule als potenzieller Ort für solche Freundschaften hervorgehoben wird. Die persönliche Motivation der Autorin, basierend auf ihrer Erfahrung im Nachhilfebereich, wird ebenfalls erwähnt.
2.1 Aktueller Stand der Forschung: Kapitel 2.1 beschreibt den aktuellen Forschungsstand zum Thema Migration und Freundschaften in der Adoleszenz. Es wird festgestellt, dass wenige Studien die Auswirkungen von Freundschaften auf die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund untersuchen. Das gewählte Thema wird als geeignet für die Erschließung neuer Zusammenhänge dargestellt, da es Forschungslücken schließt und gleichzeitig auf vorhandene Arbeiten aufbauen kann.
2.2 Bezugsliteratur: Kapitel 2.2 nennt die sozialwissenschaftliche Zeitschrift „Diskurs Kindheits- und Jugendforschung“ und einen Beitrag von Dr. Heinz Reinders zu interethnischen Beziehungen als relevante Quelle. Die Zusammenfassung bricht hier ab, da der bereitgestellte Text an dieser Stelle unvollständig ist.
Schlüsselwörter
Interethnische Freundschaften, türkische Jugendliche, Bildung, Schulsystem, Integration, Grounded Theory, qualitative Forschung, Migrationshintergrund, Shell-Jugendstudie, Kontakthypothese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Einfluss interethnischer Freundschaften auf den Bildungsweg türkischer Jugendlicher in Deutschland
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss interethnischer Freundschaften auf den Bildungsweg türkischer Jugendlicher in Deutschland. Der Fokus liegt auf der qualitativen Analyse, wie diese Freundschaften die schulische Integration beeinflussen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Grounded Theory Methode. Diese qualitative Methode erlaubt es, aus den Daten selbst Theorien zu entwickeln, ohne von vorab festgelegten Hypothesen auszugehen. Die Datenbasis bilden zwei Interviews aus der Shell-Jugendstudie 2000.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirken sich interethnische Freundschaften auf den Bildungsweg türkischer Jugendlicher in Deutschland aus? Dabei wird besonders auf bikulturelle Freundschaften als intensive und positiv erlebte Kontakte eingegangen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Darlegung der Forschungsfrage (inkl. aktueller Forschungsstand und Bezugsliteratur), Methode, Beschreibung der Daten, Reflexion und Darstellung der Ergebnisse (inkl. Vorgehensweise, Datenanalyse und Diskussion der Ergebnisse), Fazit und Ausblick.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen interethnischer Freundschaften auf die schulische Integration, die Anwendung der Grounded Theory Methode in der Bildungsforschung, die Rolle von Freundschaften im Kontext von Migration und Bildung, die Bedeutung kultureller und sozioökonomischer Faktoren für den Bildungserfolg, sowie Möglichkeiten integrativer Maßnahmen im Schulsystem.
Welche Daten werden verwendet?
Die Datenbasis besteht aus zwei Interviews der Shell-Jugendstudie 2000. Die Arbeit konzentriert sich auf die qualitative Analyse dieser Interviews und vermeidet verallgemeinernde Aussagen.
Warum ist diese Forschungsfrage relevant?
Die Relevanz der Forschungsfrage ergibt sich aus dem Mangel an expliziten Studien zu diesem Thema und dem Kontext der Kontakthypothese von Allport. Die Schule wird als potenzieller Ort für interethnische Freundschaften hervorgehoben.
Welche Literatur wird zitiert?
Als relevante Quelle wird die sozialwissenschaftliche Zeitschrift „Diskurs Kindheits- und Jugendforschung“ und ein Beitrag von Dr. Heinz Reinders zu interethnischen Beziehungen genannt. Der bereitgestellte Textausschnitt enthält jedoch keine vollständige Liste der zitierten Literatur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interethnische Freundschaften, türkische Jugendliche, Bildung, Schulsystem, Integration, Grounded Theory, qualitative Forschung, Migrationshintergrund, Shell-Jugendstudie, Kontakthypothese.
Was ist das Fazit der Einleitung?
Die Einleitung beleuchtet den hohen Anteil türkischer Jugendlicher im deutschen Schulsystem, deren Überrepräsentation an Hauptschulen und die hohe Abbruchquote. Sie führt in das Thema Benachteiligung ein und stellt die Arbeit als Anwendung qualitativer Methoden zur Untersuchung des Einflusses interethnischer Freundschaften dar.
- Quote paper
- Raffaela Wolf (Author), 2009, Wie wirken sich interethnische Freundschaften auf den Bildungsweg türkischer Jugendlicher in Deutschland aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192202