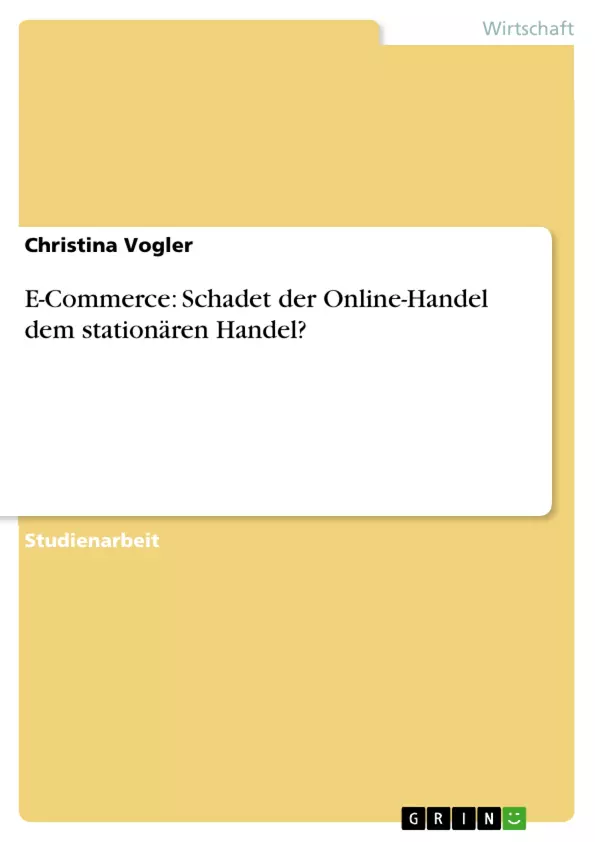In der Literatur wurde bisher keine einheitliche und allgemein gültige Definition zu dem Begriff Electronic-Commerce festgehalten . Allgemein wird darunter die Unterstützung von Handelsaktivitäten über sogenannte Kommunikationsnetzwerke verstanden . Der stationäre Einzelhandel weist seit Jahren eine Stagnation auf. Der Online-Handel hingegen wächst so schnell wie nie zuvor . Einen E-Handel zu betreiben ist inzwischen unabdingbar. Dieser hat nämlich Wachstumschancen, die der stationäre Handel nicht mehr hat. Auch veränderte Kundenwünsche machen einen Online-Handel notwendig. Ebenso trägt die Wettbewerbsaktivität maßgeblich zur Notwendigkeit eines elektronischen Handels bei . Die am meisten verbreiteten Betriebstypen von Distanzkanälen sind der Katalog- und Internet-Versandhandel. Beide Arten gehören zum B2C Distanzhandel. Der zentrale Unterschied zwischen E-Commerce und stationärem Handel ist der persönliche Kontakt, welcher nur im stationären Handel gegeben ist. Die Basis dieser Studie bildet Sekundärliteratur, welche zahlreich vorhanden ist. Dennoch stellte dieses ein Problem dar, da es von vielen Büchern keine erneuerten und überarbeiteten Auflagen gibt. Bei einem sich so schnell entwickelnden Fachbereich wie dem Internethandel, ist Fachliteratur welche bereits 5 bis 10 Jahre alt ist wenig hilfreich.
1.1 Leitende Fragestellung
Durch die rasante Entwicklung der Technologie sowie der zunehmenden Internationalisierung haben sich die Kundenwünsche stark verändert. Die Entwicklung und der Erfolg von Smartphones sowie Tablett PCs verdeutlicht, dass der Trend, so viel wie möglich elektronisch zu erleben und zu konsumieren fortlaufen wird. Auf Grund einer weltweiten Vernetzung hat der elektronische Markt eine globale Dimension angenommen. Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage danach, ob diese Entwicklung dem stationären Handel schadet oder einen positiven Einfluss hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leitende Fragestellung
- Gliederung
- Der stationäre Handel
- Erscheinungsformen des E-Commerce
- Business-to-Business
- Business-to-Consumer
- Consumer-to-Consumer
- Business-/Consumer-to Administration
- Anwendungsbereiche des E-Commerce
- Online-Shops
- Electronic Shopping-Malls
- Online Auktionen
- Veränderung des Kundenverhaltens
- Hürden des E-Commerce
- Vorteile des elektronischen Marktes
- Transformation der Wertschöpfungskette
- Fallbeispiel evolutionäre Transformation
- Fallbeispiel revolutionäre Transformation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, ob der Online-Handel dem stationären Handel schadet oder einen positiven Einfluss auf diesen hat. Sie analysiert die Entwicklung des E-Commerce und die Veränderungen im Kundenverhalten, die durch diese Entwicklung ausgelöst werden.
- Erscheinungsformen und Anwendungsbereiche des E-Commerce
- Veränderungen im Kundenverhalten durch den E-Commerce
- Transformation der Wertschöpfungskette durch den E-Commerce
- Vorteile und Hürden des E-Commerce
- Bedeutung des E-Commerce für den stationären Handel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Electronic Commerce ein und stellt die Leitende Fragestellung der Studie dar. Anschließend wird ein Überblick über den stationären Handel gegeben. Die Studie behandelt dann verschiedene Erscheinungsformen des E-Commerce wie Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C) und Consumer-to-Consumer (C2C). Außerdem werden wichtige Anwendungsbereiche des E-Commerce wie Online-Shops, Electronic Shopping-Malls und Online Auktionen vorgestellt.
Im Anschluss daran wird das veränderte Kundenverhalten im Kontext des E-Commerce betrachtet, wobei sowohl Hürden als auch Vorteile des elektronischen Marktes beleuchtet werden. Schließlich geht die Studie auf die Transformation der Wertschöpfungskette durch den E-Commerce ein, wobei zwei Fallbeispiele, eines für eine evolutionäre und eines für eine revolutionäre Transformation, vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
E-Commerce, Electronic Commerce, Online-Handel, stationärer Handel, Kundenverhalten, Wertschöpfungskette, Transformation, B2B, B2C, C2C, Online-Shops, Electronic Shopping-Malls, Online Auktionen.
Häufig gestellte Fragen
Schadet der Online-Handel dem stationären Einzelhandel?
Die Studie untersucht, ob der E-Commerce eine Bedrohung darstellt oder durch veränderte Kundenwünsche sogar positive Impulse geben kann.
Was ist der zentrale Unterschied zwischen E-Commerce und Ladenlokal?
Der Hauptunterschied liegt im persönlichen Kontakt und der physischen Erfahrung, die nur der stationäre Handel bieten kann.
Welche Erscheinungsformen des E-Commerce gibt es?
Unterschieden werden Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C) und Consumer-to-Consumer (C2C).
Wie verändert sich das Kundenverhalten durch Smartphones?
Kunden wollen heute so viel wie möglich elektronisch erleben und konsumieren, was zu einer globalen Dimension des Marktes führt.
Was bedeutet "Transformation der Wertschöpfungskette"?
Es beschreibt, wie der Online-Handel traditionelle Geschäftsabläufe entweder schrittweise (evolutionär) oder radikal (revolutionär) verändert.
- Citation du texte
- Christina Vogler (Auteur), 2011, E-Commerce: Schadet der Online-Handel dem stationären Handel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192224