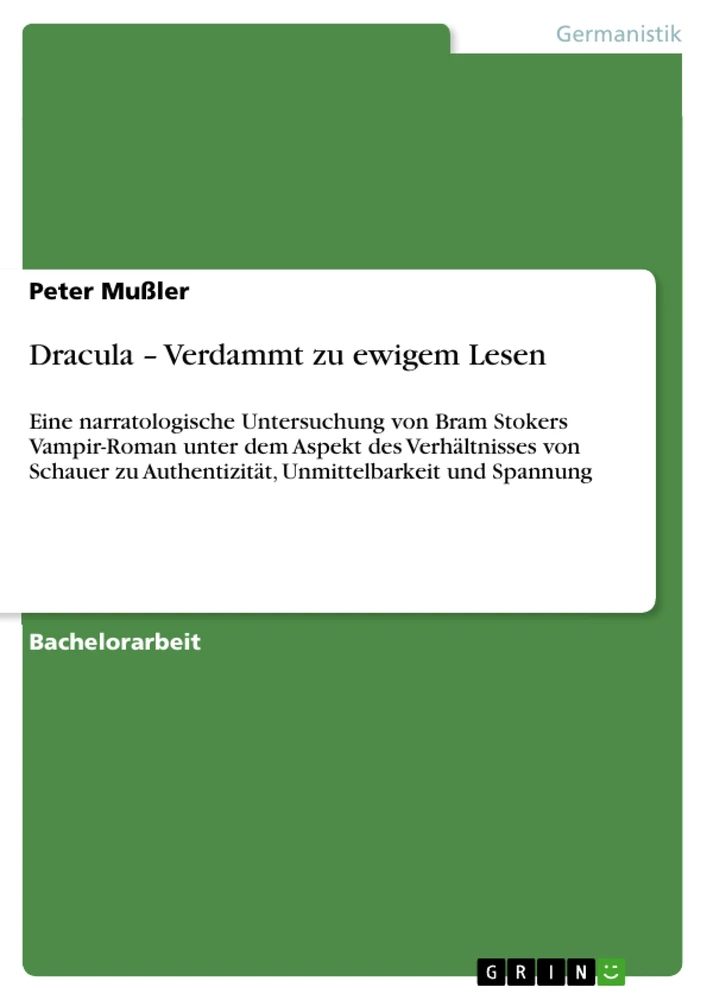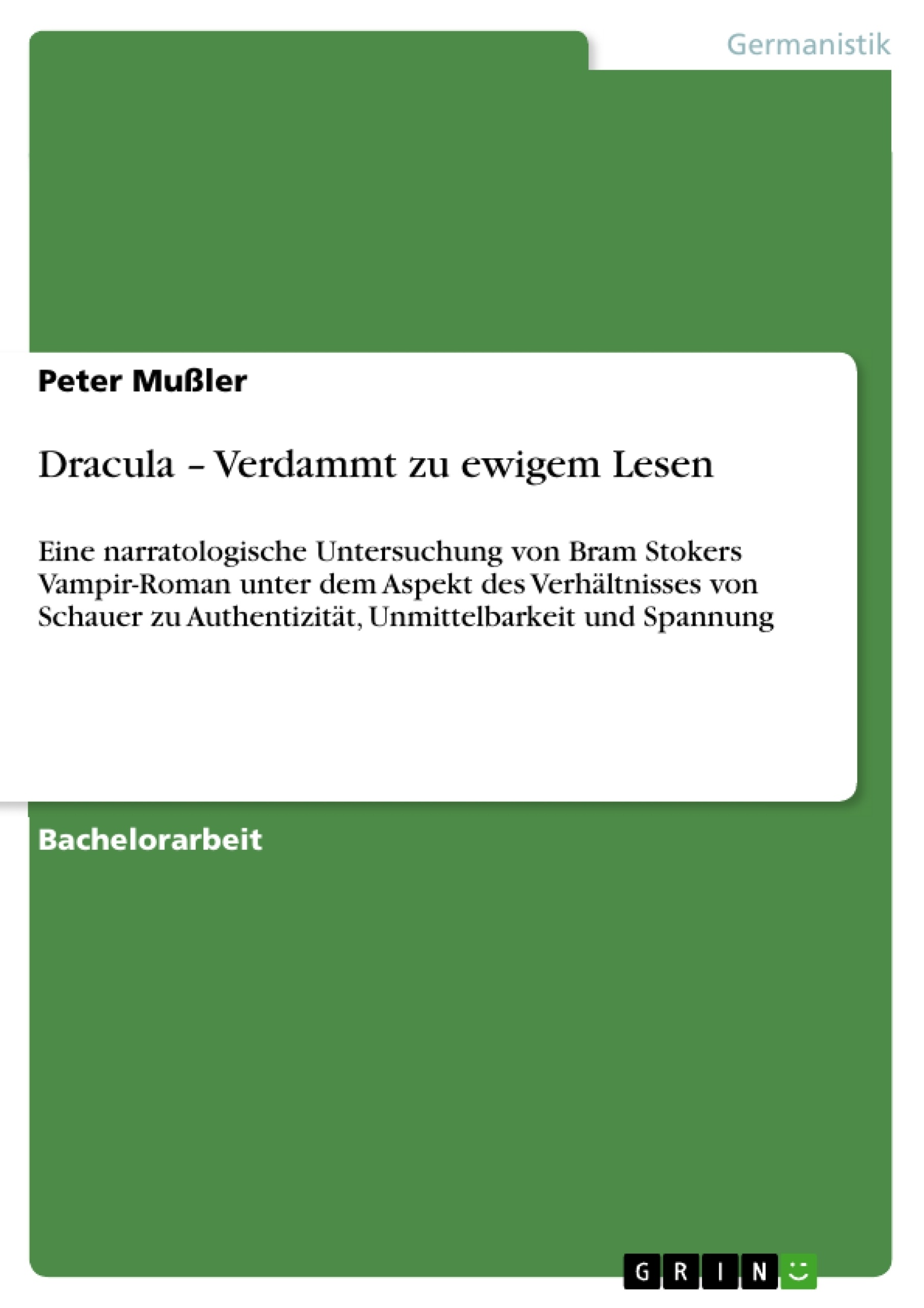Man braucht kein Literaturwissenschaftler zu sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass es sich bei Dracula um Schauerliteratur handelt. Alleine die Figur des Vampirfürsten steht, ähnlich wie die des Frankensteinschen Monsters, prototypisch für das Genre, ist jedoch – ebenfalls wie die Patchwork-Kreatur aus der Feder Mary Shelleys – aufgrund einer Hyperpopularisierung für eine breite Öffentlichkeit bereits losgelöst von ihrer eigenen Geschichte. Zeichen dafür sind nicht nur die Parodien, die es zu jedem etablierten Genre und speziell zu den populären Stoffen selbst gibt, sondern die beinahe omnipräsenten Erscheinungen außerhalb eines echten schauerlichen Kontextes: Kaum eine "Trick or Treat"-Darstellung zu Halloween kann ohne ein bleichgeschminktes Kind mit zurückgegelten Haaren, Eckzähnen und Umhang auskommen, die an Bela Lugosis Verkörperung des transsylvanischen Grafen angelehnt ist. Die Figur Dracula ist ein Sinnbild für Schauer geworden, ein Symbol des Genres Schauerliteratur und nicht nur der Subkategorie Vampirliteratur.
Der Ursprung dieser Entwicklung liegt sicher im Roman. Was nun aber macht diesen so schaurig? Wieso bekommt man es beim Lesen mit der Angst zu tun, obwohl die geschilderten Phänomene doch augenscheinlich so weit von der Wirklichkeit entfernt sind? Warum kann man, einmal damit angefangen, nicht mehr aufhören, diese Geschichte der letzten sechs Monate aus dem "Leben" des Vaters aller Vampire zu lesen?
Der Roman wurde von der Literaturwissenschaft lange Zeit ignoriert. Er schien für sie uninteressant zu sein, da es sich bei diesem Werk unstrittig um populäre Literatur handelt, die aber außerdem nur die Absicht zu haben schien, zu gruseln und somit als Populärliteratur abgestempelt und geringgeschätzt wurde. Schwerpunkt der erst in den 1980/90er-Jahren gemachten Untersuchungen zu Dracula ist zum Einen die genderkritische Analyse, zum Anderen, nicht ganz davon zu trennen, die Thematisierung von Sexualität und Begierde im Kontext des Vampirismus. Diese Themen könnten eine Ursache für die starke Attraktivität des Romans sein. Die latenten Botschaften, wie z.B. die Idee der Promiskuität oder des Masochismus, mögen auf das zeitgenössische wie auf das spätere Publikum einen Reiz ausgeübt haben und auch noch heute wirken.
Der größere Reiz liegt aber im schauerlichen Potenzial. Ausgehend von der eigenen Leseerfahrung und allgemeinen Einordnung des Werkes will ich untersuchen, wie schauerliches Erzählen in Bram Stokers Roman funktioniert, denn...
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkung zu Personennamen
- 1. Einleitung
- 2. Illusion der Echtheit: Glaubhaft Angst machen
- 2.1 Form: Tagebuch, Briefroman oder Montage?
- 2.2 Explizite Marker im Text
- 2.3 Glaubwürdigkeit auf Personenebene: Harker, Mina, Seward
- 2.4 Evidenz der Aktualität: Phonograph, Fahrrad und Hypnose
- 2.5 Expliziter Aufruf zu glauben? We ask none to believe us!
- 3. Unmittelbarkeit: Zeitlich und sprachlich
- 4. Van Helsing als Vorreiter des Lesers: Keep an open mind
- 5. Manipulation durch Rede: Rhetorik zwischen Hetzen und Hoffnung machen
- 6. Fokalisierung und Multiperspektivität: Ich über mich und andere
- 7. Spannung I: Schauer durch Vorankündigung
- 8. Spannung II: Struktur des Romans - Rausch durch Unterbrechung
- 9. Selbstreferenzialität und Autorenstimme:
- Erzählen über Erzählen, Schreiben über Schreiben - Maximierung des Schauereffekts
- 10. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht das schauerliche Erzählen in Bram Stokers Roman "Dracula" unter dem Aspekt des Verhältnisses von Schauer zu Authentizität, Unmittelbarkeit und Spannung. Ziel ist es, die narrativen Mechanismen zu analysieren, die den Leser in den Bann ziehen und die Angst erzeugen, die den Roman so erfolgreich macht.
- Illusion der Echtheit
- Unmittelbarkeit und Spannung
- Manipulation durch Sprache und Rede
- Fokalisierung und Multiperspektivität
- Selbstreferenzialität und Autorenstimme
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt den Roman "Dracula" als Prototyp der Schauerliteratur vor und thematisiert die verbreitete Rezeption der Figur des Vampirs.
- Kapitel 2: Die Illusion der Echtheit wird anhand der narrativen Struktur (Tagebuch, Briefroman, Montage), der expliziten Marker im Text sowie der Glaubwürdigkeit der Figuren und der Darstellung der Zeitgenossenschaft beleuchtet.
- Kapitel 3: Das Kapitel analysiert die sprachliche und zeitliche Unmittelbarkeit des Romans.
- Kapitel 4: Die Rolle von Van Helsing als Vorreiter des Lesers und dessen Aufgabe, mit offenem Geist zu lesen, wird betrachtet.
- Kapitel 5: Die Manipulation durch Rede und deren Funktion, Spannung aufzubauen oder Hoffnung zu wecken, wird untersucht.
- Kapitel 6: Die Fokalisierung und Multiperspektivität des Romans, die Perspektivenwechsel und die Reflexion über die eigene Wahrnehmung, werden analysiert.
- Kapitel 7: Das Kapitel beleuchtet den Einsatz von Spannung durch Vorankündigungen und die damit verbundene Steigerung der Schauerlichkeit.
- Kapitel 8: Die Struktur des Romans, der Einsatz von Unterbrechungen und die daraus resultierende Spannung, werden untersucht.
- Kapitel 9: Die Selbstreferenzialität des Romans, die reflexiven Elemente und die Maximierung des Schauereffekts werden analysiert.
Schlüsselwörter
Schauerliteratur, Dracula, Bram Stoker, Vampir, Authentizität, Unmittelbarkeit, Spannung, Narratologie, Form, Tagebuch, Briefroman, Montage, Fokalisierung, Multiperspektivität, Rhetorik, Manipulation, Selbstreferenzialität.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Bram Stokers "Dracula" als Prototyp der Schauerliteratur?
Die Figur des Vampirfürsten vereint klassische Gruselmotive mit psychologischen Urängsten. Der Roman nutzt narrative Techniken, die bis heute als Standard für das Genre gelten.
Wie erzeugt der Roman eine "Illusion der Echtheit"?
Durch die Form eines Briefromans, bestehend aus Tagebucheinträgen, Briefen und Zeitungsberichten, wirkt die fiktive Geschichte wie eine dokumentarische Montage realer Ereignisse.
Welche Rolle spielen moderne Erfindungen wie der Phonograph im Buch?
Stoker integrierte damals aktuelle Technik (Phonograph, Schreibmaschine, Hypnose), um die Geschichte in der damaligen Gegenwart zu verankern und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Warum wurde Dracula lange Zeit von der Literaturwissenschaft ignoriert?
Er wurde lange als reine "Populärliteratur" abgestempelt, die nur auf Grusel abzielte. Erst später erkannte man die tiefen Ebenen bezüglich Sexualität, Gender und Gesellschaftskritik.
Was macht die Figur Van Helsing für den Leser so wichtig?
Van Helsing fungiert als Vorreiter für den Leser: Er fordert dazu auf, einen "offenen Geist" zu bewahren und auch das Unmögliche für wahr zu halten, was die Immersion in den Schauer verstärkt.
- Citar trabajo
- Peter Mußler (Autor), 2012, Dracula – Verdammt zu ewigem Lesen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192247