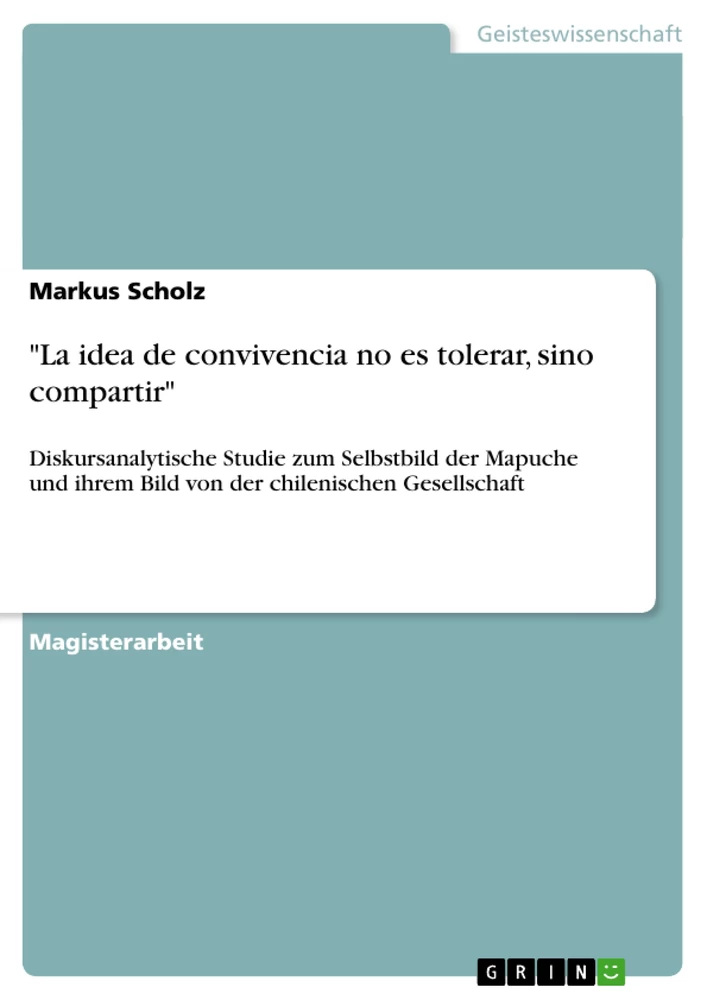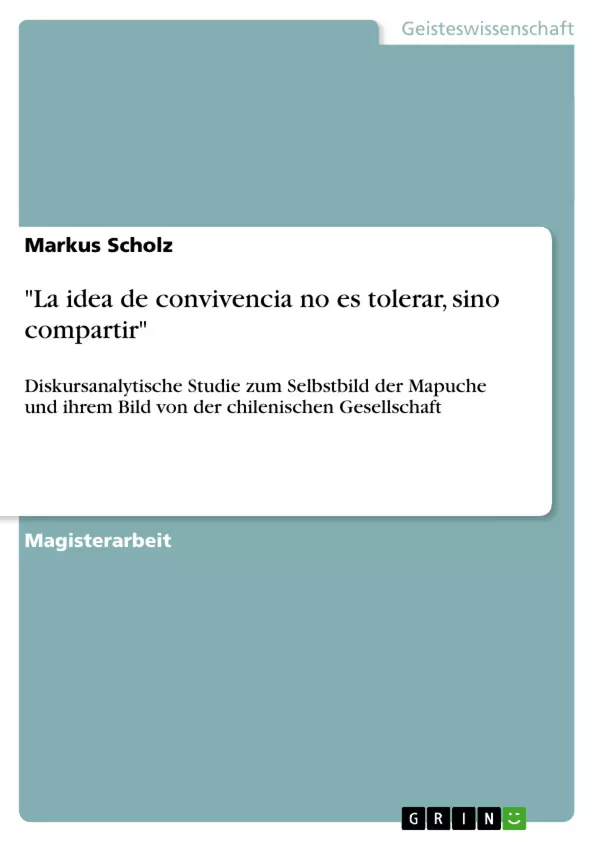In dieser Arbeit wird unter Anwendung der diskursanalytischen Methode Siegfried Jägers eine Analyse der Auto- und der Heterostereotypen der chilenischen Mapuche-Indianer vorgenommen. Zu diesem Zweck wurden Primärtexte aus den Jahren 1986/87, 1992/93, 1999 und 2007 analysiert. Die Textsammlung ist heterogen, enthält jedoch schwerpunktmäßig Texte aus Publikationen politisch aktiver Mapuche. Die Untersuchung der Texte zu den genannten Zeitpunkten hat die Erfassung der thematischen Breite und von Schwerpunkten innerhalb des Diskurses zum Ziel. Aufmerksamkeit gilt bei der Untersuchung auch der Frage nach der Präsenz rezenter „ethnonationaler“ Identität gegenüber der zuvor schon bestehenden ethnischen Identität in der heterogen beschaffenen Gesellschaft der Mapuche in der Gegenwart.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- Die Mapuche in Chile
- Die Mapuche in historischer Zeit
- Die Vergabe von Land an die Mapuche
- Die Mapuche unter Allende und Pinochet
- Der Übergang zu demokratischen Verhältnissen in Chile
- Das geltende Ley Indígena
- Die Mapuche zur Regierungszeit der Concertación
- Die Umfrage des CEP von 2006
- Theorie und Methode
- Leontjew
- Jürgen Link
- Jägers Terminologie
- Van Dijk
- Jägers Diskurstheorie als Grundlage für diese Arbeit
- Diskursanalyse
- Die konkrete methodische Vorgehensweise in dieser Arbeit
- Analyse der Texte aus den Jahren 1986 und ‘87
- Analyse der Texte aus den Jahren 1992 und ‘93
- Analyse der Texte aus dem Jahr 1999
- Analyse der Texte aus dem Jahr 2007
- Schlussbemerkung
- Verzeichnis der Abbildungen, Karten und Fotos
- Bibliographie
- Primärliteratur
- Selbst erhobenes Material
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterhausarbeit beschäftigt sich mit dem Selbstbild der Mapuche und ihrem Bild von der chilenischen Gesellschaft, wobei die Entwicklung dieser Bilder seit den 1980er Jahren analysiert wird. Die Arbeit untersucht die Veränderung des Auto- und Heterostereotyps der Mapuche in einem Zeitraum, der viele politische und gesellschaftliche Veränderungen in Chile beinhaltete, wie die Diktatur unter Pinochet, die Einführung des Ley Indígena und die Herausforderungen der modernen Forstwirtschaft.
- Die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mapuche und chilenischer Gesellschaft
- Die Bedeutung von Landbesitz und Landkonflikten für die Mapuche-Identität
- Die Rolle der chilenischen Regierung und der Unternehmer im Konflikt mit den Mapuche
- Die unterschiedlichen Perspektiven und Diskurse innerhalb der Mapuche-Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Modernisierung und die Auswirkungen des Kapitalismus auf die Mapuche-Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die Geschichte und Gegenwart der Mapuche in Chile, beleuchtet die Landpolitik des chilenischen Staates und die verschiedenen Konfliktlinien zwischen Mapuche und Chilenen. Das zweite Kapitel stellt die Diskurstheorie von Siegfried Jäger vor, die als theoretische Grundlage für die Analyse des Mapuche-Diskurses dient. Die Kapitel drei bis sechs beinhalten die Analyse von Texten aus verschiedenen Zeitpunkten: 1986/87, 1992/93, 1999 und 2007. Die Analyse konzentriert sich auf die wichtigsten Themen, Argumente und Erzählungen in diesen Texten, um ein Bild von der Entwicklung des Selbstbildes der Mapuche und ihres Bildes von der chilenischen Gesellschaft zu zeichnen. Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die verschiedenen Diskurse und Konfliktlinien innerhalb des Mapuche-Diskurses.
Schlüsselwörter
Mapuche, Chile, Selbstbild, Heterostereotyp, Diskursanalyse, Landkonflikt, Forstwirtschaft, Unternehmer, Regierung, Unterdrückung, Identität, Kultur, Sprache, Tradition, Moderne, Kapitalismus, Staatsterrorismus, politische Gefangene, Ethnotourismus, Ley Indígena.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Mapuche?
Die Mapuche sind ein indigenes Volk in Chile, das für seinen langen Widerstand gegen Kolonialisierung und für den Erhalt seiner kulturellen Identität bekannt ist.
Was ist das zentrale Thema des Mapuche-Diskurses?
Der Landkonflikt steht im Zentrum: Die Rückgabe von angestammtem Land, das heute oft von Forstunternehmen genutzt wird, und die Forderung nach Autonomie.
Welche Methode wird in der Analyse verwendet?
Die Arbeit nutzt die kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger, um Auto- und Heterostereotypen in chilenischen Texten von 1986 bis 2007 zu untersuchen.
Was bedeutet „ethnonationale Identität“ im Kontext der Mapuche?
Es beschreibt die Entwicklung von einer rein kulturellen Identität hin zu einem politischen Bewusstsein als eigene Nation innerhalb des chilenischen Staates.
Wie hat sich die Situation unter der Concertación-Regierung verändert?
Trotz der Einführung des „Ley Indígena“ (Indigenengesetz) blieben viele Konflikte ungelöst, da wirtschaftliche Interessen der Forstindustrie oft Priorität hatten.
- Quote paper
- Markus Scholz (Author), 2008, "La idea de convivencia no es tolerar, sino compartir", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192305