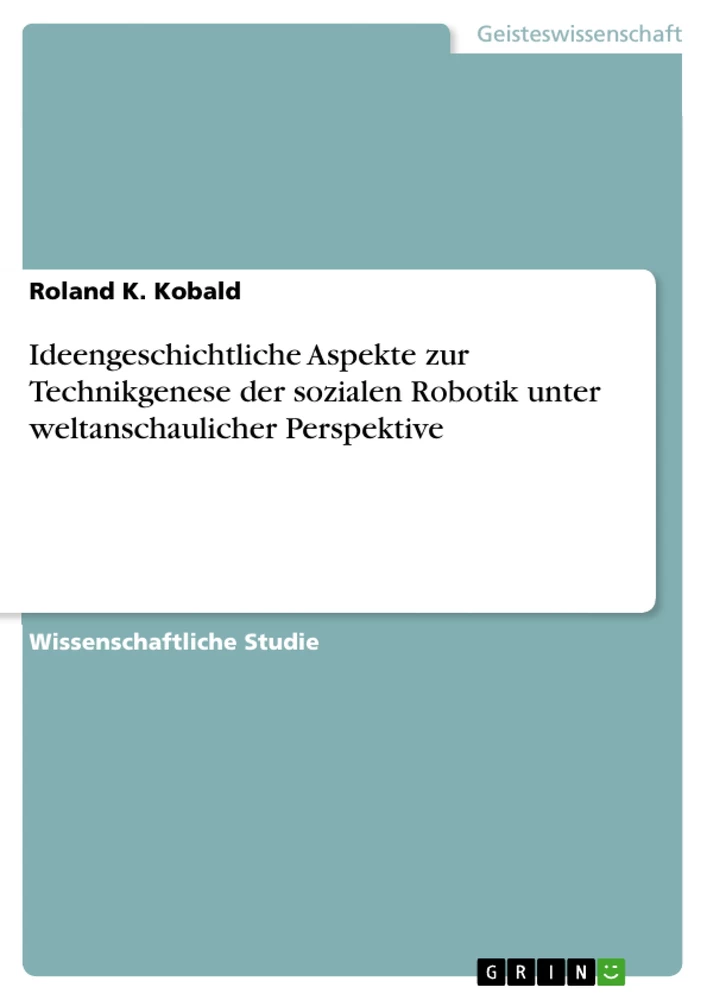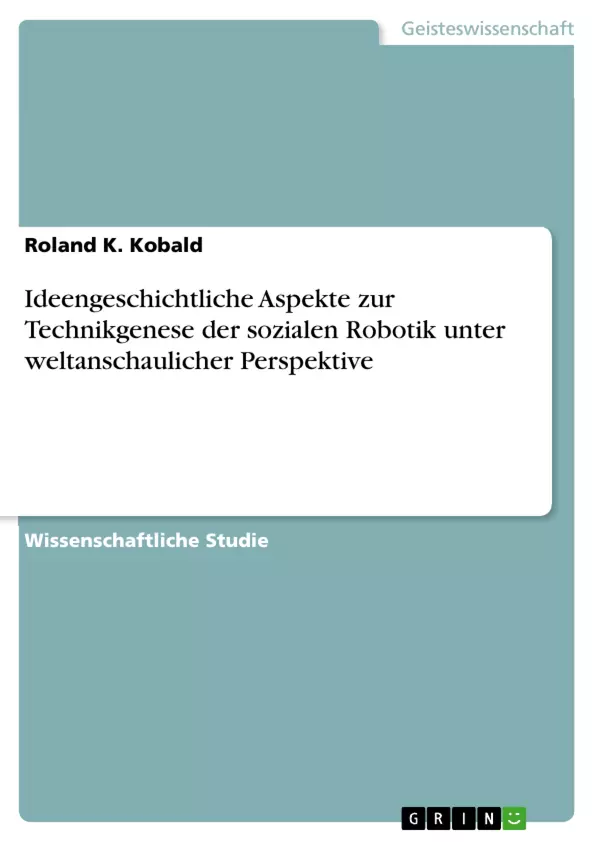Humanoide Roboter zeichnen sich durch menschenähnliche „Sensorik“ sowie „Aktorik“ und handlungsbezogener „Künstlicher Intelligenz“ aus. Anthropomorphe Roboter sind jene Klasse von Robotern, die beispielsweise als Spielzeug in Haushalten oder der Alten- und Krankenpflege als maschinelle Helfer Verwendung finden. Zwar sind sie derzeit noch kein soziotechnisches Massenphänomen in unseren Gesellschaften, jedoch aber bereits auf bestem Weg dazu, in die demographisch rasant alternden Industriegesellschaften als artifizielle Handlungspartner zu migrieren. Diesbezüglich sieht die „Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen“ die Sozialrobotik als eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts an, die unser alltägliches Leben stark verändern wird und daher besonderer Kontrollmacht bedarf. Evidenz dafür liefern nicht zuletzt eine ganze Reihe an EU-Projekten, die in diesem Bereich am Laufen sind. Hierbei kreisen die Forschungsfragen zu Servicerobotern nicht nur mehr allein um technische oder ökonomische Aspekte, sondern es werden verstärkt die soziologisch-gesellschaftlichen Perspektivfragen integriert. Dazu gehören beispielsweise ethische, soziologische, sozialphilosophische, oder rechtliche Fragestellungen. In den Geschichtswissenschaften allerdings führt dieses Thema noch ein Schattendasein. Diese Marginalisierung des Themas in der Historiographie sollte baldigst beendet werden, denn eine wesentliche Funktion der Geschichtswissenschaften ist ihr Nachzeichnen von „geschichtlich-sozialem Gewordensein“ historischer Entitäten (hier Technikobjekten), um sie einer Erklärung für das Hier und Jetzt zuführen. Gerade die sich historisch „verändernde soziale Wirklichkeit“ muss kulturhistorisch argumentiert werden, damit wir daraus für die Zukunft lernen können.
Irgendwie scheint das technische Objekt Sozialrobotik auf den ersten Blick tatsächlich etwas sperrig für eine geschichtliche Darstellung und eigentlich auch nur geringe technikhistorische Relevanz zu besitzen sowie zeitlich ausschließlich in der Moderne bzw. Postmoderne verortet zu sein. Wie die hier vorgestellte Studie exemplifiziert, ist der Androide als Figur des artifiziellen Helfers in der europäischen Kulturgeschichte allerdings schon lange Zeit im Kollektivgedächtnis verankert. Der Mensch als Schöpfer seines artifiziellen (mechanischen) Alter Ego ist bereits in den frühen griechischen Mythen durchgehend als tiefenpsychologisches Motiv enthalten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Methodologische Grundlegung und Darstellung des zu untersuchenden Forschungsfeldes
- III. Technikmythen als epochenübergreifende plurifunktionale Führungssysteme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die ideengeschichtliche Entwicklung der sozialen Robotik unter weltanschaulicher Perspektive zu beleuchten. Sie untersucht die Technikgenese des Sozialroboters als ein komplexes Gefüge aus Mythen, Ingenieurskunst und gesellschaftlicher Integration. Im Fokus steht die Frage, wie sich der Wunsch, körperliche Unzulänglichkeit durch artifizielle Knechte auszugleichen, im Laufe der Geschichte in technische Innovationen übersetzt hat.
- Die Technikgenese der sozialen Robotik als historischer Prozess
- Die Rolle von Mythen und Weltbildern in der Entwicklung von Sozialrobotern
- Die Beziehung zwischen dem technischen Objekt und dem Individuum
- Das Zusammenspiel von rationaler und irrationaler Rationalität in der Sozialrobotik
- Die Bedeutung der "plurifunktionalen Führungssysteme" für das Verständnis der Technikgenese
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Das Kapitel führt in die Thematik der sozialen Robotik ein und erläutert die Bedeutung der Geschichtswissenschaften für die Analyse dieser Schlüsseltechnologie. Dabei wird betont, dass die Sozialrobotik bereits heute eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt und in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen wird.
II. Methodologische Grundlegung und Darstellung des zu untersuchenden Forschungsfeldes
Dieses Kapitel legt die methodologischen Grundlagen der Arbeit dar und beschreibt das zu untersuchende Forschungsfeld. Es wird die Rolle des Wissenssoziologen Karl Mannheim und seiner Konzepte der "Seinsverbundenheit des Denkens" und der "Generationenlage" hervorgehoben.
III. Technikmythen als epochenübergreifende plurifunktionale Führungssysteme
Das dritte Kapitel untersucht die ideengeschichtlichen Wurzeln der Sozialrobotik und beleuchtet die Bedeutung von Mythen und Weltbildern für die Entwicklung dieser Technik. Es wird auf die "plurifunktionalen Führungssysteme" von Ernst Topitsch und deren Rolle als Orientierungsfunktion für das menschliche Handeln eingegangen.
Schlüsselwörter
Soziale Robotik, Technikgenese, Mythen, Weltbilder, "Plurifunktionale Führungssysteme", Wissenssoziologie, Karl Mannheim, Ernst Topitsch, Anthropologie, Kulturgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was ist soziale Robotik?
Sie umfasst humanoide und anthropomorphe Roboter, die als artifizielle Interaktionspartner in Bereichen wie der Pflege oder als Spielzeug eingesetzt werden.
Warum ist die Technikgenese der Robotik historisch relevant?
Die Geschichtswissenschaft hilft zu verstehen, wie Mythen und kulturelle Vorstellungen über künstliche Helfer technische Innovationen über Jahrhunderte beeinflusst haben.
Welche Rolle spielen antike Mythen für moderne Roboter?
Schon in griechischen Mythen ist das Motiv des Menschen als Schöpfer eines mechanischen Alter Ego als tiefenpsychologisches Muster verankert.
Was sind „plurifunktionale Führungssysteme“ nach Ernst Topitsch?
Es sind Weltbilder und Mythen, die dem menschlichen Handeln eine Orientierung geben und die Entwicklung von Technik ideengeschichtlich steuern.
Gilt Robotik als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts?
Ja, Experten sehen in ihr eine Technologie, die den Alltag in alternden Gesellschaften massiv verändern wird und daher ethischer und rechtlicher Kontrolle bedarf.
Wie beeinflussen Weltbilder die Ingenieurskunst?
Technische Objekte entstehen oft aus dem Wunsch, körperliche Unzulänglichkeit durch „artifizielle Knechte“ auszugleichen, was tief in der europäischen Kulturgeschichte verwurzelt ist.
- Quote paper
- Mag. Roland K. Kobald (Author), 2012, Ideengeschichtliche Aspekte zur Technikgenese der sozialen Robotik unter weltanschaulicher Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192312