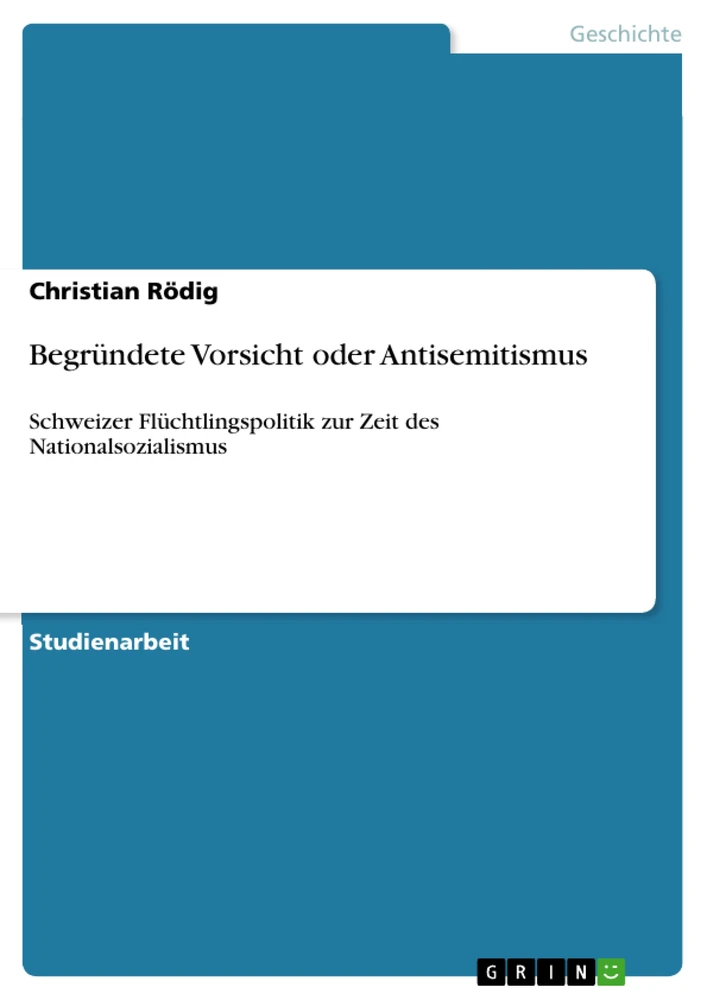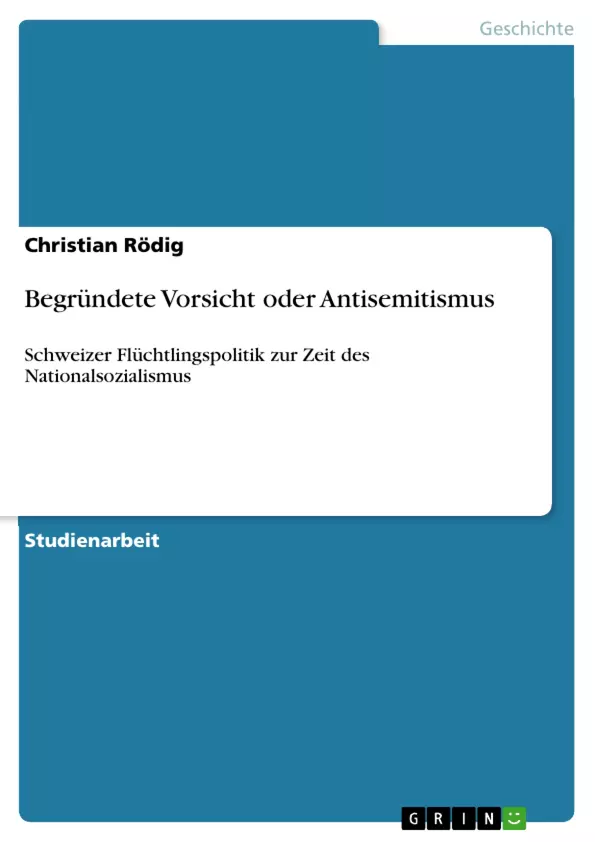Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland begann eine Verfolgungswelle, welche letztlich im schrecklichen und historisch einzigartigen Ereignis des Holocaust mündete. Diese Verfolgungen und später gezielten Massentötungen führten dazu, dass große Flüchtlingsströme entstanden, welche in anderen Nationen Zuflucht suchten. Anfangs strömten die Flüchtlinge – oftmals Juden – aus dem Deutschen Reich selbst, dann aus „angeschlossenen“ Gebieten, wie etwa Österreich, und im Zweiten Weltkrieg von den einzelnen Fronten, speziell der Ostfront, Hilfe suchend in andere Staaten. Dies konnten sowohl angrenzende Staaten des Deutschen Reiches, andere europäische Nationen oder gar Länder auf anderen Kontinenten sein. Die Frage um die Aufnahme der Flüchtlinge stellte sich also weltweit und jedes der betroffenen Länder sah sich vor eine Belastungsprobe gestellt.
Eine besondere Stellung unter diesen betroffenen Ländern nahm die Schweiz ein. Seit langem bekannt für ihre humanitäre Tradition und geographisch für viele Fliehende relativ günstig gelegen, sah sie sich schnell mit den Flüchtlingen konfrontiert und musste eine eigene Politik gegenüber diesen entwickeln. Diese Flüchtlingspolitik soll in der vorliegenden Hausarbeit thematisiert werden. Es soll veranschaulicht werden, welche Faktoren bei der Aufnahme oder Abweisung von Flüchtlingen eine Rolle spielten. Dabei geht es vor allem um eine Bewertung der Bedeutung fremdenfeindlicher und antisemitischer Einflüsse. Wie offen war die Schweiz für Menschen, die vor dem NS-Regime flüchteten? Wurde die damalige Flüchtlingspolitik der Schweiz durch antisemitische Tendenzen beeinflusst? Gab es auch rationale Faktoren, welche die Schweiz zu ihrer Haltung berechtigten? Handelten andere Staaten besser als die Eidgenossenschaft?
Dabei wird der Blick zuerst auf die damalige politische Situation der Schweiz und das historische Umfeld gerichtet, um ein Grundverständnis für den weiteren Argumentationsgang zu schaffen. Anschließend werden die fremdenfeindlichen und antisemitischen Tendenzen in der Schweiz näher beleuchtet, um ein Verständnis dafür zu schaffen, inwiefern solches Gedankengut in der Schweiz überhaupt vorhanden war. Dabei wird zuerst die Schweizer Bevölkerung, danach die politischen Entscheidungsträger näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historisches Umfeld
- Antisemitische Schweiz?
- Bevölkerung
- Politische Entscheidungsträger und Institutionen
- Die Flüchtlinge
- Ausmaße der Flüchtlingswellen
- Aufenthaltsbedingungen für Flüchtlinge in der Schweiz
- Finanzierung der Flüchtlingspolitik
- Ausnahme oder Normalfall?
- Schweizer Hilfsaktionen
- Flüchtlingspolitik anderer Nationen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die schweizerische Flüchtlingspolitik während der Zeit des Nationalsozialismus. Das Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die bei der Aufnahme oder Abweisung von Flüchtlingen eine Rolle spielten, insbesondere die Bedeutung fremdenfeindlicher und antisemitischer Einflüsse.
- Bewertung der Bedeutung fremdenfeindlicher und antisemitischer Einflüsse auf die Schweizer Flüchtlingspolitik
- Analyse der Offenheit der Schweiz für Menschen, die vor dem NS-Regime flüchteten
- Untersuchung der Rolle von rationalen Faktoren bei der Schweizer Flüchtlingspolitik
- Vergleich der Schweizer Flüchtlingspolitik mit der anderer Staaten
- Beurteilung der historischen Situation der Schweiz im Kontext der Flüchtlingsproblematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung der Flüchtlingsströme während des Nationalsozialismus und die besondere Stellung der Schweiz als potenzielles Zufluchtsland. Das Kapitel „Historisches Umfeld“ analysiert die wirtschaftliche Abhängigkeit der Schweiz vom Außenhandel und die damit verbundenen Herausforderungen in der Zeit des Krieges.
Das Kapitel „Antisemitische Schweiz?“ untersucht die Verbreitung fremdenfeindlicher und antisemitischer Tendenzen in der Schweizer Bevölkerung und bei politischen Entscheidungsträgern. Das Kapitel „Die Flüchtlinge“ beleuchtet die Ausmaße der Flüchtlingsströme, die Aufenthaltsbedingungen in der Schweiz und die Finanzierung der Flüchtlingspolitik.
Das Kapitel „Ausnahme oder Normalfall?“ untersucht Hilfsaktionen für Flüchtlinge in der Schweiz sowie die Flüchtlingspolitik anderer Staaten im Vergleich.
Schlüsselwörter
Schweizer Flüchtlingspolitik, Nationalsozialismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Flüchtlingsströme, Aufenthaltsbedingungen, Finanzierung, Hilfsaktionen, internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Schweiz für Flüchtlinge im Nationalsozialismus?
Aufgrund ihrer humanitären Tradition und geografischen Lage war die Schweiz ein zentrales Ziel für Menschen, die vor dem NS-Regime flüchteten.
Wurde die Schweizer Flüchtlingspolitik durch Antisemitismus beeinflusst?
Die Arbeit untersucht, inwiefern antisemitische und fremdenfeindliche Tendenzen in der Bevölkerung und bei politischen Entscheidungsträgern die Aufnahmebereitschaft minderten.
Gab es rationale Gründe für die restriktive Flüchtlingspolitik der Schweiz?
Ja, Faktoren wie die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Außenhandel, die Versorgungslage während des Krieges und die politische Neutralität spielten eine Rolle.
Wie waren die Aufenthaltsbedingungen für Flüchtlinge in der Schweiz?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Bedingungen, die Unterbringung sowie die Finanzierung der Flüchtlingshilfe in jener Zeit.
Wie schnitt die Schweiz im Vergleich zu anderen Nationen ab?
Es wird analysiert, ob die Schweizer Politik eine Ausnahme darstellte oder ob andere Staaten ähnlich restriktiv auf die Flüchtlingswellen reagierten.
- Quote paper
- B.A. Christian Rödig (Author), 2011, Begründete Vorsicht oder Antisemitismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192389