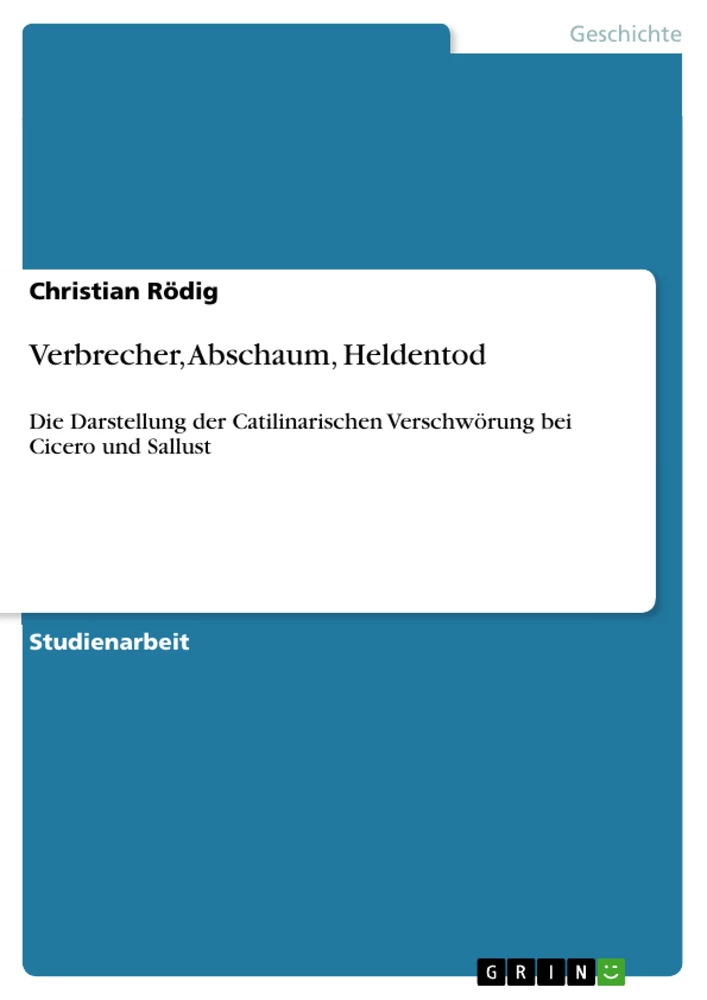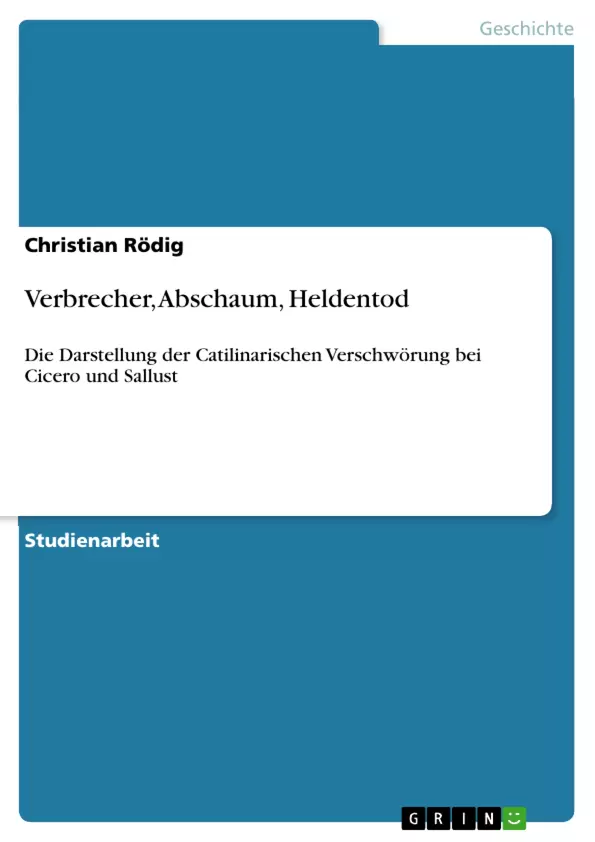Das Römische Reich gilt als eines der größten und bedeutendsten Imperien der Antike. In seiner langen Geschichte schwankte seine Macht und Stabilität sowohl innen- als auch außenpolitisch.
Mehrmals in der Geschichte dieses Weltreiches waren es einzelne Persönlichkeiten, welche das Schicksal ihrer Zeitgenossen bestimmten. Dabei gab es verschiedene Arten, wie dies geschehen konnte. Neben Kriegen gegen andere Völker und Reiche, zwangen auch innere Konflikte, wie Aufstände und Bürgerkriege, der jeweiligen Zeit ihren Stempel auf. Der Erfolg war dabei freilich ebenso verschieden, wie jene Charaktere, die als Hauptakteure der Konflikte auftraten. Großen Eroberungen nach allen Himmelsrichtungen hin standen in der römischen Geschichte auch katastrophale militärische Niederlagen entgegen. Ähnlich erscheint es bei den innenpolitischen Kämpfen. Neben den Erfolgen eines Sulla oder Julius Cäsar verblassen heute in der breiten Öffentlichkeit zu Unrecht jene Aufständischen, die mit ihrer Rebellion keinen Erfolg hatten.
Einer von diesen ist Lucius Sergius Catilina. Seine Erhebung fand 63 v. Chr. statt und endete mit seinem Tod im darauf folgenden Jahr. Catilinas Umsturzversuch befindet sich zeitlich somit zwischen jenem von Sulla und Cäsar und damit in einer äußerst brisanten Zeit der späten Römischen Republik. Trotz ihres Scheiterns hatte die Verschwörung für viele Zeitgenossen sowie für die weitere Geschichte der Römischen Republik große Bedeutung. Auch zeigt sich an den späteren Triumphen Cäsars, dass ein Aufstand zur damaligen Zeit durchaus Erfolgschancen hatte.
Die Verschwörung ist uns heute vor allem aus zwei zeitgenössischen Quellen bekannt. Zum einen aus den vier „Catilinarischen Reden“1 des Cicero, welche er parallel zu den Ereignissen rund um die Rebellion im Senat bzw. vor dem Volk in Rom hielt.2 Zum anderen aus der Monographie „Die Verschwörung Catilinas“3 von Sallust. Dieses Werk, zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen entstanden, erläutert den Verlauf der Verschwörung sowie weitere Hintergründe. Cicero und Sallust stellen bicht nur die wichtigsten zeitgenössischen Quellen für die Verschwörung des Catilina dar, sondern die wohl wichtigsten überhaupt. Umso interessanter sind ihre Eigenheiten, mit welchen sie die Verschwörung des Catilina schildern.
Inhaltsverzeichnis
- Das historische Umfeld der Catilinarischen Verschwörung
- Der Verschwörer und seine Chronisten
- Catilina
- Cicero
- Sallust
- Die Darstellung der Catilinarischen Verschwörung bei Cicero und Sallust
- Charaktereigenschaften Catilinas
- Anhängerschaft Catilinas
- Doppelte Verschwörung und historiographische Probleme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Darstellung der Catilinarischen Verschwörung durch Cicero und Sallust. Sie beleuchtet die historischen Rahmenbedingungen, die Catilinas Rebellion begünstigten, und stellt die Hauptfiguren - Catilina, Cicero und Sallust - vor. Der Fokus liegt auf der Analyse der Charaktereigenschaften Catilinas, seiner Anhängerschaft und den historiographischen Problemen der Verschwörung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Darstellung der Catilinarischen Verschwörung zu gewinnen, indem die Quellen und Intentionen der Autoren Cicero und Sallust analysiert werden.
- Die Catilinarische Verschwörung im Kontext der späten römischen Republik
- Die Persönlichkeit und Motivationen Catilinas
- Die Rolle von Cicero und Sallust als Historiker und ihre Darstellung der Verschwörung
- Die Charakterisierung von Catilinas Anhängern
- Historiographische Probleme und widersprüchliche Darstellungen der Verschwörung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht das historische Umfeld der Catilinarischen Verschwörung und beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die den Aufstand begünstigten. Das zweite Kapitel stellt die wichtigsten Figuren der Verschwörung vor: Catilina, Cicero und Sallust. Es beleuchtet ihre Motivationen, Intentionen und die Beziehung, die sie zu Catilina hatten. Das dritte Kapitel analysiert Ciceros und Sallusts Darstellungen der Catilinarischen Verschwörung. Es konzentriert sich auf die Charakterisierung von Catilinas Persönlichkeit, seiner Anhängerschaft und den historiographischen Problemen, die sich aus den unterschiedlichen Quellen ergeben.
Schlüsselwörter
Catilinarische Verschwörung, Römische Republik, Cicero, Sallust, Historiographie, Quellenkritik, politische Instabilität, soziale Ungleichheit, politische Intrigen, Aufstand, Rebellion.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Lucius Sergius Catilina?
Catilina war ein römischer Politiker, der im Jahr 63 v. Chr. einen Umsturzversuch gegen die Römische Republik anführte, der jedoch scheiterte.
Wie unterscheiden sich die Quellen von Cicero und Sallust zur Verschwörung?
Cicero verfasste seine Reden zeitnah als politischer Akteur (Konsul), während Sallust seine Monographie erst zwei Jahrzehnte später aus historischer Distanz schrieb.
Welche Charaktereigenschaften werden Catilina zugeschrieben?
Beide Autoren beschreiben ihn oft negativ als skrupellos, wobei Sallust ihn als Symbol für den moralischen Verfall der römischen Aristokratie nutzt.
Welche Bedeutung hatte die Verschwörung für die späte Römische Republik?
Sie verdeutlichte die tiefen sozialen und politischen Spannungen sowie die Instabilität des Staates kurz vor dem Aufstieg von Julius Cäsar.
Was sind die historiographischen Probleme bei der Untersuchung der Verschwörung?
Die einseitige Überlieferung durch Catilinas Gegner macht es schwierig, seine tatsächlichen Motive und die Unterstützung durch das Volk objektiv zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- B.A. Christian Rödig (Autor:in), 2010, Verbrecher, Abschaum, Heldentod, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192402