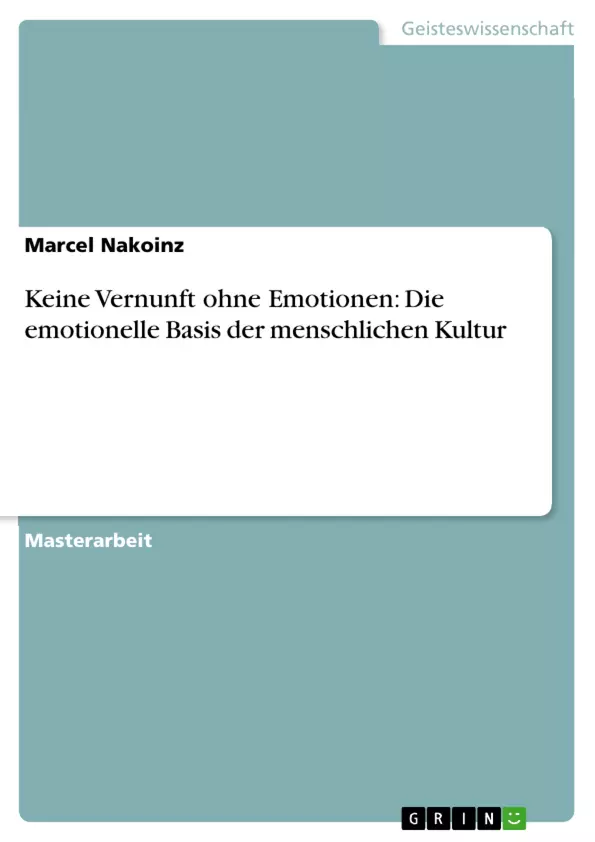Wie kommt es, dass beim alltäglichen Sprechen über private emotionale Erlebnisse mit einer gewissen Grundsicherheit angenommen werden kann, dass man sich einander versteht, obwohl Philosophen und Naturwissenschaftler zugleich größte Schwierigkeiten haben, Emotionen zu definieren und zu verstehen, inwieweit intrapersonale Empfindungen mit den sich auf diese beziehenden interpersonal wahrnehmbaren Wortäußerungen verbunden sind? Diese Sicherheit ist umso erstaunlicher, als dass sie sich mit einem relativ begrenzten Vokabular begnügt. Die mögliche Asynchronität, zwischen dem subjektiv reichhaltig empfundenen emotionalen Erleben und den im Vergleich dazu dürftigen Möglichkeiten einer begrifflichen Darstellung dieses Erlebens, umreißt das Grundproblem, welches innerhalb dieser Arbeit kritisch beleuchtet wird.
Im Folgenden wird die These vertreten werden, dass es erst durch das Einbeziehen der handlungssteuernden Motive eines Menschen und deren intersubjektiv-kulturellen Formung möglich wird, zu plausibilisieren, warum innere Vorgänge äußerer Kriterien bedürfen, wie es beispielsweise Ludwig Wittgenstein ausdrückte (vgl. Wittgenstein (2006a), § 580). Diese inneren Vorgänge als das emotionale Erleben des Subjekts, werden im Laufe der Arbeit als durch eine bereits auf einer vorsprachlichen Ebene der Ontogenese ansetzende, zwischenmenschliche Interaktion grundlegend strukturiert herausgearbeitet. Die dem subjektiven Erleben somit prinzipiell inhärente Intersubjektivität ist, so die These der vorliegenden Arbeit, die Bedingung des Verständnisses anderer und der damit einhergehenden Möglichkeit des allgemeinverständlichen Sprechens über Emotionen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I Zur Skizzierung des Grundproblems
- II Eine kleine Theoriegeschichte
- III Der Lösungsansatz
- IV Die Vorgehensweise
- Teil I: TERMINOLOGISCHE PRÄZISIERUNGEN
- 1 Sprache
- 2 Bewusstsein und Denken
- 3 Handlungsmotive
- 4 Emotionen und Gefühle
- TEIL II: IRRWEGE DES VERSTEHENS
- 5 Tomasellos "Error" - Die Annahme einer angeborenen Wir-Intentionalität
- 5.1 Die Entwicklung von Wittgensteins Bedeutungstheorie
- 5.2 Zur Möglichkeit vorreflexiv-nonverbaler Erfahrungen
- 5.3 Die Notwendigkeit eines zweidimensionalen Verständnisses von Bewusstsein
- 6 Damasios "Error" - Spiegelneurone als biologischer Ursprung innerer Repräsentationen
- 6.1 Der spiegelnde Mensch
- 6.2 Zwischenkonklusion
- TEIL III: WEGE DES VERSTEHENS
- 7 Vygotskijs kompetente Säuglinge
- 7.1 Pionierarbeit in der Säuglingsforschung
- 7.2 Vygotskijs Beitrag für die Moderne
- 7.3 Über Vygotskij hinaus
- 8 Holodynskis Modell der Sprachentwicklung - Die Entwicklung von Ausdruckszeichen und ihre Bedeutung für das Verständnis anderer
- 8.1 Holodynskis Internalisierungsmodell
- 8.1.1 Der Ausgangszustand des subjektiven emotionalen Erlebens
- 8.1.2 Der entwickelte Zustand des subjektiven emotionalen Erlebens
- 8.2 Der Stoff, aus dem die Emotionen sind
- 8.3 Zur Möglichkeit eines vorreflexiven Verständnisses anderer durch nonverbale Interaktion
- 8.3.1 Semiotische Ausdrucksreaktionen
- 8.3.2 Die vorreflexive Interaktion vermittels Ausdruckszeichen in der kindlichen Ontogenese
- 8.4 Der Einfluss des vorreflexiven Verständnisses anderer auf die reflexive Bewusstseinsebene
- 8.4.1 Gefühle als reflektierte Emotionen
- 8.4.2 Zur Möglichkeit, Gefühle zu umgehen
- 8.5 Der Einfluss der Kultur auf das Gefühl
- 8.5.1 Vorschlag für eine erweiterte Gefühlsdefinition
- 8.5.1.1 Nähere Bestimmung der Gefühle als reflektierte Emotionen
- 8.5.2 Die kulturelle Formung der Gefühle als Grundlage ihrer Versprachlichung
- 8.6 Die Verbalisierung der Gefühle auf Basis ihrer kulturellen Formung
- 8.6.1 Der Berührungspunkt des sprechenden Gefühls und des stummen Verständnisses
- 8.7 Über Holodynski hinaus
- 9 Die Beziehung des Gedankens zum Wort
- 9.1 Handlungswissen als Bedingung des vorreflexiven Verständnisses anderer
- 9.2 Die Bedeutung der gemeinsamen Aufmerksamkeit für das Handlungswissen
- 9.3 Die Bedeutung der gemeinsamen Hintergründe für die gemeinsame Aufmerksamkeit
- 10 Menschen lesen Körper - nicht Gedanken
- 11 Das Hirn als Antizipationsorgan
- 11.1 Die neuronale Bühne des vorreflexiven Verständnisses
- 11.2 Spiegelneurone als die Bretter dieser Bühne
- Die Problematik der sprachlichen Repräsentation von Emotionen
- Die Rolle nonverbaler Kommunikation im Verständnis anderer
- Der Einfluss kognitiver Prozesse auf das emotionale Erleben
- Die Bedeutung kultureller Faktoren für die Emotionsausdrücke
- Der Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze zur Emotionsforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen dem subjektiven Erleben von Emotionen und deren sprachlicher Darstellung. Ziel ist es, kritisch zu beleuchten, wie diese Asynchronität missverstanden und letztendlich auch produktiv genutzt werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG: Die Einleitung skizziert das Grundproblem der Arbeit: die Diskrepanz zwischen der subjektiven Intensität emotionaler Erlebnisse und den Möglichkeiten ihrer sprachlichen Ausdruck. Sie veranschaulicht dies anhand literarischer Beispiele, die die Unzulänglichkeit der Sprache in Bezug auf die Darstellung innerer Zustände belegen. Gleichzeitig verdeutlicht die Einleitung die Bedeutung dieses Problems für die empirische Emotionsforschung, in der die Validität von Selbsteinschätzungen immer wieder in Frage gestellt wird. Der Fokus liegt auf der Asynchronität zwischen innerem Erleben und äußerer Kommunikation, ein Phänomen, welches im weiteren Verlauf der Arbeit tiefergehend untersucht wird.
Teil I: TERMINOLOGISCHE PRÄZISIERUNGEN: Dieser Teil dient der Klärung grundlegender Begriffe. Die Kapitel befassen sich mit der Definition von Sprache, Bewusstsein, Denken, Handlungsmotiven und Emotionen. Er legt die terminologische Basis für die folgende Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien des Verständnisses von anderen. Es wird der Versuch unternommen, ein gemeinsames Verständnis für die im folgenden verwendeten zentralen Begriffe zu schaffen, um Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Definitionen zu vermeiden. Diese Klärung ist entscheidend für die spätere Analyse der Theorien, die sich mit dem Verständnis von Emotionen und ihrer Kommunikation befassen.
Teil II: IRRWEGE DES VERSTEHENS: Dieser Teil befasst sich kritisch mit Ansätzen, die die Fähigkeit zum Verständnis von anderen auf angeborene Mechanismen zurückführen. Kapitel 5 analysiert Tomasellos Theorie der angeborenen Wir-Intentionalität, während Kapitel 6 Damasios Theorie der Spiegelneurone kritisch beleuchtet. Beide Kapitel zeigen die Grenzen reduktionistischer Erklärungen des interpersonellen Verständnisses auf und bereiten den Weg für die im dritten Teil vorgestellten alternativen Perspektiven. Die Kritik zielt darauf ab, die Komplexität des Verständnisses von anderen zu verdeutlichen und die Notwendigkeit eines umfassenderen Ansatzes hervorzuheben.
Teil III: WEGE DES VERSTEHENS: Dieser Teil präsentiert alternative Erklärungsansätze für das Verständnis anderer, die über die im zweiten Teil kritisierten Theorien hinausgehen. Kapitel 7 behandelt Vygotskijs Ansatz und dessen Bedeutung für die Säuglingsforschung, während Kapitel 8 Holodynskis Modell der Sprachentwicklung im Detail analysiert. Hierbei wird der Fokus auf die Bedeutung nonverbaler Kommunikation und die Entwicklung von Ausdruckszeichen gelegt. Kapitel 9 untersucht den Zusammenhang zwischen Denken und Sprache und die Rolle gemeinsamer Aufmerksamkeit und Hintergrundwissen für das Verständnis anderer. Schließlich beleuchtet Kapitel 10 die Bedeutung der Körperkommunikation für das interpersonelle Verständnis, während Kapitel 11 das Gehirn als Antizipationsorgan beschreibt. Dieser Teil bietet eine differenzierte Perspektive auf das Verständnis von anderen, indem er die Bedeutung kultureller und sozialer Faktoren hervorhebt.
Schlüsselwörter
Emotionen, Sprache, Kommunikation, Verständnis, Interaktion, Bewusstsein, Denken, Spiegelneurone, Vygotskij, Holodynski, nonverbale Kommunikation, kulturelle Einflüsse, reflexives und vorreflexives Verständnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die Diskrepanz zwischen dem subjektiven Erleben von Emotionen und ihrer sprachlichen Darstellung. Er analysiert kritisch, wie diese Asynchronität missverstanden und produktiv genutzt werden kann, und beleuchtet die Rolle nonverbaler Kommunikation, kognitiver Prozesse und kultureller Faktoren im Verständnis anderer.
Welche zentralen Begriffe werden im Text definiert und präzisiert?
Teil I des Textes widmet sich der terminologischen Präzisierung von Schlüsselbegriffen wie Sprache, Bewusstsein, Denken, Handlungsmotiven und Emotionen. Diese Klärung bildet die Grundlage für die Analyse verschiedener Theorien des interpersonellen Verständnisses.
Welche Theorien werden im Text kritisch beleuchtet?
Teil II des Textes analysiert kritisch Tomasellos Theorie der angeborenen Wir-Intentionalität und Damasios Theorie der Spiegelneurone. Die Kritik zielt darauf ab, die Grenzen reduktionistischer Erklärungen des interpersonellen Verständnisses aufzuzeigen und die Komplexität des Verständnisses von anderen hervorzuheben.
Welche alternativen Erklärungsansätze für das Verständnis anderer werden präsentiert?
Teil III des Textes präsentiert alternative Ansätze, die über die im zweiten Teil kritisierten Theorien hinausgehen. Hier werden Vygotskijs Ansatz, Holodynskis Modell der Sprachentwicklung, die Bedeutung nonverbaler Kommunikation, gemeinsamer Aufmerksamkeit und Hintergrundwissen sowie die Rolle der Körperkommunikation und des Gehirns als Antizipationsorgan analysiert.
Welche Rolle spielt nonverbale Kommunikation im Verständnis anderer?
Der Text betont die immense Bedeutung nonverbaler Kommunikation für das Verständnis anderer. Insbesondere Holodynskis Modell der Sprachentwicklung hebt die Rolle von Ausdruckszeichen und vorreflexiver Interaktion hervor. Der Text argumentiert, dass ein umfassendes Verständnis von Emotionen und Interaktion die Berücksichtigung nonverbaler Signale erfordert.
Welche Bedeutung haben kulturelle Faktoren für die Emotionsausdrücke?
Der Text unterstreicht den Einfluss kultureller Faktoren auf die Formung und Versprachlichung von Gefühlen. Die kulturelle Prägung beeinflusst nicht nur den Ausdruck, sondern auch das subjektive Erleben von Emotionen. Dies wird insbesondere im Kontext von Holodynskis Modell diskutiert.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text gliedert sich in drei Teile: Eine Einleitung, einen Teil mit terminologischen Präzisierungen, einen Teil mit der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien und einen Teil mit der Präsentation alternativer Ansätze. Jeder Teil besteht aus mehreren Kapiteln mit detaillierten Analysen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind Emotionen, Sprache, Kommunikation, Verständnis, Interaktion, Bewusstsein, Denken, Spiegelneurone, Vygotskij, Holodynski, nonverbale Kommunikation, kulturelle Einflüsse, reflexives und vorreflexives Verständnis.
Für welche Zielgruppe ist der Text bestimmt?
Der Text richtet sich an eine akademische Zielgruppe, die sich mit Emotionsforschung, Sprachwissenschaft, Kognitionswissenschaft und verwandten Gebieten beschäftigt. Die detaillierte Analyse und der wissenschaftliche Stil sprechen für einen akademischen Kontext.
Wo finde ich weitere Informationen zu den im Text behandelten Theorien?
Der Text selbst nennt die relevanten Autoren (Vygotskij, Holodynski, Tomasello, Damasio) und bietet durch die detaillierten Kapitelzusammenfassungen einen guten Einstieg in die jeweilige Theorie. Zusätzliche Informationen können über die genannten Autoren und ihre Werke recherchiert werden.
- Citation du texte
- Marcel Nakoinz (Auteur), 2012, Keine Vernunft ohne Emotionen: Die emotionelle Basis der menschlichen Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192572