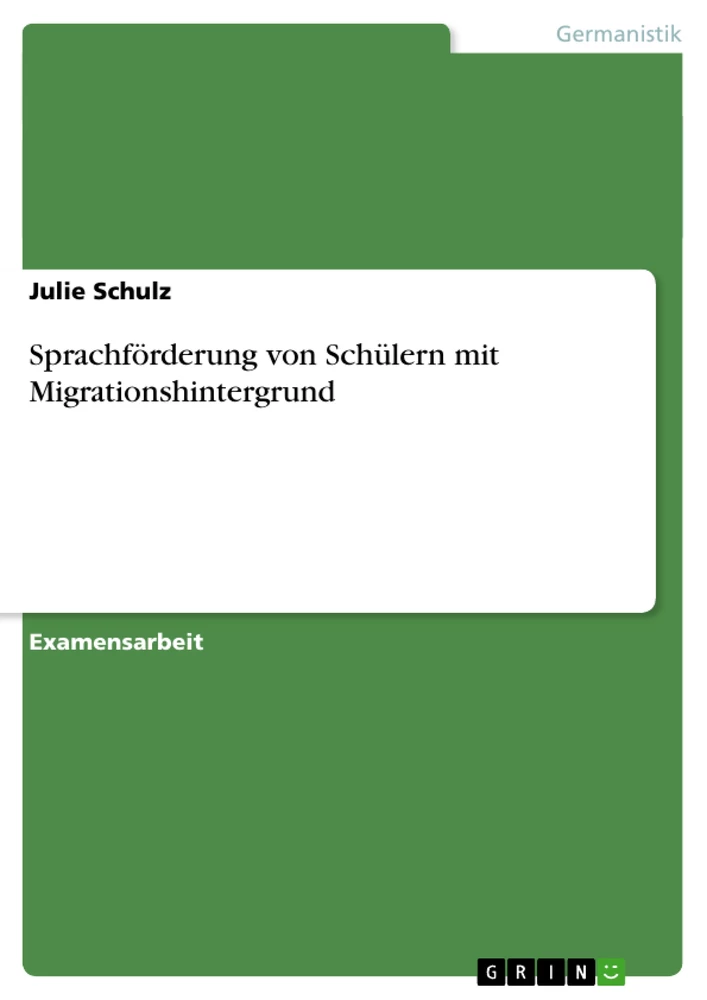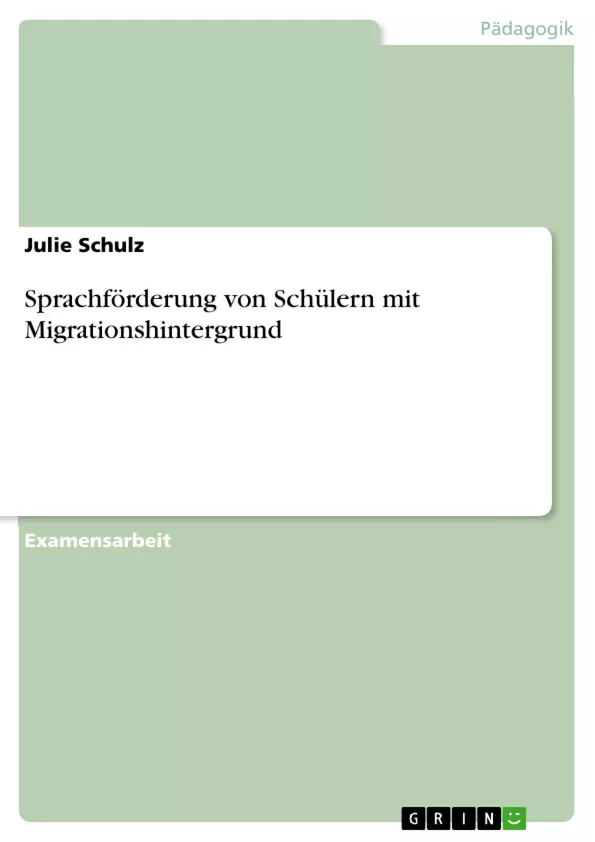Durch die alarmierenden Ergebnisse von Schulleistungsuntersuchungen wie PISA, IGLU oder TIMSS hat das Thema Bildung wieder zunehmend an Bedeutung gewonnen und bietet häufig Grundlage für Diskussionen in Politik und Schulwesen.
Besonders der Leistungsunterschied zwischen Schülern mit Migrationshintergrund und Schülern ohne Migrationshintergrund ist nach wie vor gravierend. Laut PISA 2006 liegen Kinder von Einwanderern, die in der Bundesrepublik geboren sind, in der Lernleistung fast zweieinhalb Schuljahre hinter gleichaltrigen deutschstämmigen Mitschülern. Die Situation für diese Gruppierung von Schülern ist in keinem Industriestaat der Welt als so problematisch einzustufen wie in Deutschland.
Es stellt sich also die Frage, warum diese angesprochenen Leistungsunterschiede so gravierend sind und welche bildungspolitischen Maßnahmen zu veranlassen sind, um diese zu verhindern oder zu verringern.
Inhaltsverzeichnis
- Migration, Bildung und Probleme im Zuwanderungsland Deutschland
- Der Begriff Migrant/Ausländer
- Bildung für die Entwicklung des „,Menschsein“
- Schule und ihre Bildungsaufgabe
- Einwanderungsgeschichte Deutschlands
- Schulsituation für Schüler als Resultat der Einwanderungsgeschichte
- Die PISA-Studie: Ergebnisse und Folgen
- Gründe für schulische Benachteiligung
- Bildungspolitische Konsequenzen
- Sprachdidaktik
- Schulsprachenpolitik- Umgang mit Zweisprachigkeit
- Empfehlungen der ständigen Kultusministerkonferenz
- Rahmenpläne für Deutsch als Zweitsprache
- Sprachförderung des Deutschen als Zweitsprache
- Der Begriff Deutsch als Zweitsprache
- Deutsch als Zweitsprache/als Fremdsprache/als Muttersprache
- Zweitspracherwerb
- Die Kontrastivhypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Interlanguagehypothese
- Die Teachabilityhypothese
- Folgerung für die Zweitsprachendidaktik
- Pädagogische Prinzipien
- Interkulturelles Lernen
- Zielsetzungen für den (Deutsch-) Unterricht
- Leistungsermittlung und Korrekturverhalten
- Sprachstandserhebung
- Der Begriff Deutsch als Zweitsprache
- Die Grammatik als Problemfeld des Zweitsprachenerwerbs
- Der Begriff Grammatik/ Grammatikunterricht
- Ziele, Methoden, Schwerpunkte des Grammatikunterrichts
- Schwierigkeiten beim mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch
- Grammatiktest
- Inhalt und Intention des Grammatiktests
- Versuchsgruppe
- Probleme (Pre-Test)
- Durchführung
- Auswertung und Schlussfolgerung
- Der Grammatiktest und die Grammatik im Zweitspracherwerb
- Befragung türkischer Quereinsteiger
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Sprachförderung von Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem, insbesondere an der Hauptschule. Sie analysiert die Herausforderungen, die durch sprachliche Unterschiede entstehen, und untersucht die Auswirkungen der Einwanderungsgeschichte auf die Schulsituation. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse von Schülern mit Migrationshintergrund zu gewinnen und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Sprachfördermaßnahmen zu entwickeln.
- Herausforderungen der Sprachförderung im Kontext von Migration
- Bildungspolitische Maßnahmen und ihre Effektivität
- Sprachdidaktische Ansätze für den Zweitspracherwerb
- Die Rolle der Grammatik im Zweitsprachenerwerb
- Empirische Untersuchungen zum Einfluss von Sprachförderung auf den Lernerfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten Kapitel der Arbeit beleuchten den Kontext von Migration und Bildung in Deutschland, den Begriff „Migrant/Ausländer“ und die Bedeutung von Bildung für die Entwicklung des „Menschseins“. Es wird auf die Einwanderungsgeschichte Deutschlands und deren Auswirkungen auf die Schulsituation eingegangen. Die PISA-Studie und ihre Ergebnisse werden analysiert, um die Ursachen für schulische Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund zu beleuchten.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit den bildungspolitischen Konsequenzen der Herausforderungen im Bereich der Sprachförderung. Die Bedeutung von Sprachdidaktik und die Entwicklung von Schulsprachenpolitik im Umgang mit Zweisprachigkeit werden diskutiert. Die Arbeit erörtert die Sprachförderung des Deutschen als Zweitsprache, einschließlich der verschiedenen Hypothesen zum Zweitspracherwerb und den pädagogischen Prinzipien der Sprachdidaktik.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Problemfeld der Grammatik im Zweitsprachenerwerb gewidmet. Es werden die Ziele, Methoden und Schwerpunkte des Grammatikunterrichts behandelt sowie die Schwierigkeiten beim mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch von Schülern mit Migrationshintergrund analysiert.
Das letzte Kapitel stellt einen empirischen Grammatiktest vor und analysiert die Ergebnisse. Es werden die Versuchsgruppe, die Durchführung und die Auswertung des Tests erläutert sowie die Schlussfolgerungen für den Grammatikunterricht im Zweitsprachenerwerb gezogen.
Schlüsselwörter
Migration, Bildung, Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, Zweitspracherwerb, Grammatik, Schulsituation, PISA-Studie, Schulsprachenpolitik, Sprachdidaktik, Interkulturelles Lernen, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was zeigen PISA-Studien über Schüler mit Migrationshintergrund?
PISA 2006 zeigte, dass Kinder von Einwanderern in Deutschland oft zweieinhalb Schuljahre hinter gleichaltrigen deutschstämmigen Mitschülern liegen.
Was ist der Unterschied zwischen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Fremdsprache (DaF)?
Deutsch als Zweitsprache wird im Zielland zur Bewältigung des Alltags erworben, während Deutsch als Fremdsprache meist im Ausland (z.B. in der Schule) gelernt wird.
Welche Hypothesen zum Zweitspracherwerb werden diskutiert?
Die Arbeit erläutert unter anderem die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguagehypothese.
Warum ist die Grammatik ein besonderes Problemfeld?
Schüler mit Migrationshintergrund haben oft Schwierigkeiten mit der komplexen deutschen Grammatik im mündlichen und schriftlichen Gebrauch, was den Lernerfolg in allen Fächern beeinflusst.
Was ist das Ziel des in der Arbeit erwähnten Grammatiktests?
Der Test untersucht empirisch den Kenntnisstand einer Versuchsgruppe (z.B. türkische Quereinsteiger), um daraus Schlussfolgerungen für die Sprachförderung zu ziehen.
- Citar trabajo
- Julie Schulz (Autor), 2011, Sprachförderung von Schülern mit Migrationshintergrund, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192623