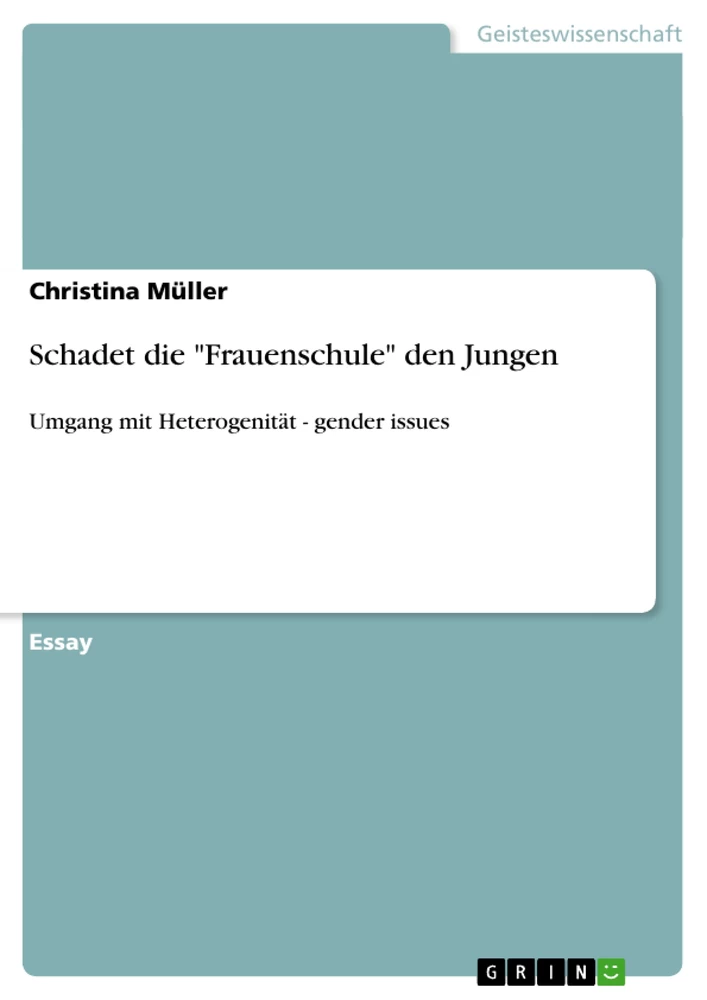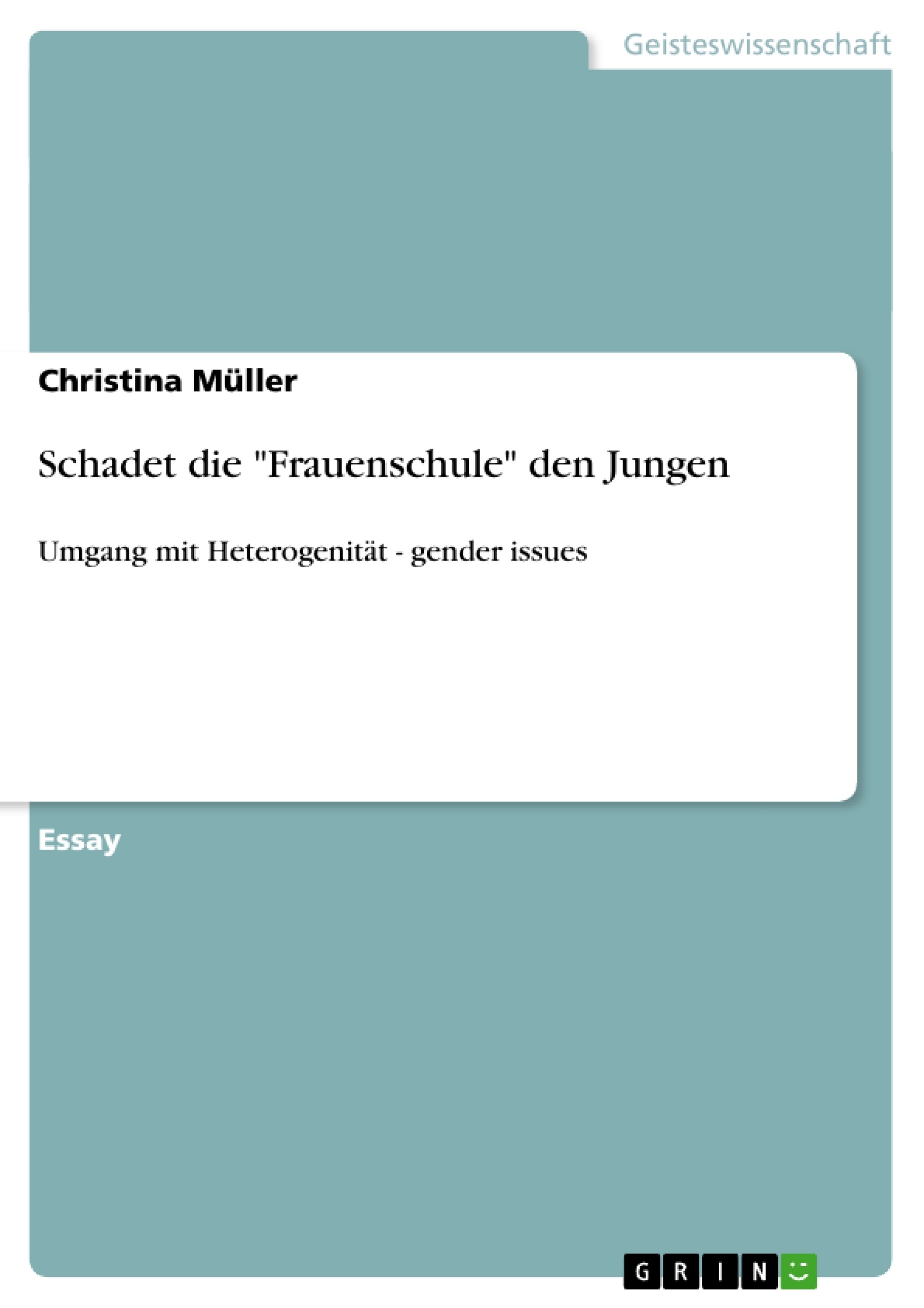„Jungen zählen heute weitaus häufiger zu den Bildungsverlierern und Schulverweige-rern“ äußerte sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ute Erdsiek-Raven, anlässlich einer Fachtagung zur geschlechtergerechten Schule. In diesem Zusam-menhang wies sie darauf hin, dass die Pädagogik- und Erziehungsberufe immer mehr verweiblichen und „mehr männliche Kompetenzen wünschenswert“ wären. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin sieht zwischen diesen beiden Entwicklun-gen einen Zusammenhang, jedoch lehnt sie eine „Männerquote für Kindergärten und Schulen“ ab.
Hintergründe
Für öffentliches Aufsehen haben vor allem Statistiken und Studien gesorgt, in denen belegt wurde, dass Jungen schlechtere Schulbiographien und geringere schulische Leistungen als Mädchen aufweisen. Nach Gründen und Ursachen sowie nach Lö-sungsansätzen wird gesucht. Jungenförderprogramme wurden, wie einige Jahre zu-vor die Mädchenförderprogramme, ins Leben gerufen. Jetzt sind es nicht mehr die Mädchen, die durch das System benachteiligt werden, sondern die Jungen. Zahlen-mäßig besuchen mehr Mädchen das Gymnasium, wohingegen der größere Anteil an den Haupt- und Sonderschulen von Jungen vertreten wird. Zudem bleiben mehr Jun-gen als Mädchen sitzen und verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss.
Wie kommt es zu so einer Entwicklung?
Aus Studien, wie Iglu und PISA , kristallisierten sich insbesondere die Leseschwäche der Jungen heraus. Terhart begründet anhand dieser Schwäche den hohen Anteil der Jungen in leistungsschwachen Schulformen: „Am Lesen und Lesenkönnen hängt alles – von da aus ergibt sich alles: Schulerfolg wie schließlich auch ein kompetentes Sich-Bewegen-Können in der modernen Welt.“ Aus schlechten Leistungen in der Grund-schule folgt natürlich nicht die Empfehlung für das Gymnasium - eine logische Schlussfolgerung in unserem dreigliedrigem Schulsystem. Es muss also schon in der frühen Kindheit Ursachen geben, die die Schulkarrieren der Jungen prägen.
Erklärungsmuster auf der biologischen Ebene, z. B. mit Hilfe des Gehirnhälftenmo-dells, oder auf der kognitiven Ebene, z. B. dass Jungen anders lernen als Mädchen, geben zwar wertvolle Hinweise, sind aber nicht ausschlaggebend für die schulische Entwicklung der Jungen.
Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem hohen Anteil an Lehre-rinnen und den immer schlechter werdenden Leistungen der Jungen in der Schule besteht, gilt zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Hintergründe
- Wie kommt es zu so einer Entwicklung?
- Ursachen für das spätere Schulversagen sind somit schon in den ersten Lebensjahren der Jungen zu suchen.
- Was könnte getan werden, damit Jungen wie Mädchen in unserer Gesellschaft nicht nur von Frauen erzogen werden?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht die Ursachen für die vermeintlich schlechteren schulischen Leistungen von Jungen im Vergleich zu Mädchen. Die Autorin beleuchtet die Rolle der Geschlechtersozialisation, die mangelnde männliche Präsenz in der Erziehung und die Auswirkungen auf die Geschlechteridentität von Jungen.
- Geschlechtersozialisation und Geschlechterrollen
- Mangelnde männliche Präsenz in der Erziehung
- Entwicklung der Geschlechteridentität
- Die Rolle der Medien und der öffentlichen Diskussion
- Mögliche Lösungsansätze für die Förderung von Jungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Hintergründe: Der Essay beginnt mit der Darstellung des Problems der schlechteren schulischen Leistungen von Jungen im Vergleich zu Mädchen. Es werden Statistiken und Studien zitiert, die diese Entwicklung belegen. Zudem wird auf die wachsende Anzahl von Jungenförderprogrammen hingewiesen.
- Wie kommt es zu so einer Entwicklung?: Der Essay beleuchtet die Ursachen für diese Entwicklung, wobei die Leseschwäche von Jungen als ein Schlüsselfaktor hervorgehoben wird. Terhart betont die Bedeutung des Lesens für den Schulerfolg und die allgemeine Kompetenzentwicklung.
- Ursachen für das spätere Schulversagen sind somit schon in den ersten Lebensjahren der Jungen zu suchen.: Die Autorin argumentiert, dass die Ursachen für das spätere Schulversagen von Jungen bereits in der frühen Kindheit liegen. Sie erklärt, dass die Geschlechtersozialisation und die mangelnde männliche Präsenz in der Erziehung eine entscheidende Rolle spielen. Die traditionelle Rollenverteilung in vielen Familien und der hohe Frauenanteil im Bildungswesen werden als problematisch dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Essays sind die Geschlechtersozialisation, Geschlechterrollen, männliche Identität, Erziehung, Schulsystem, Lesekompetenz, Jungenförderung und die Rolle des Vaters.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Jungen heute oft als „Bildungsverlierer“ bezeichnet?
Statistiken zeigen, dass Jungen häufiger die Schule ohne Abschluss verlassen, seltener Gymnasien besuchen und öfter sitzen bleiben als Mädchen.
Welche Rolle spielt die Lesekompetenz bei diesem Problem?
Studien wie PISA zeigen eine Leseschwäche bei Jungen. Da Schulerfolg in fast allen Fächern vom Leseverständnis abhängt, führt dies zu einer Benachteiligung im gesamten System.
Gibt es einen Zusammenhang mit der „Verweiblichung“ der Pädagogik?
Die Arbeit untersucht, ob der hohe Anteil an Lehrerinnen und der Mangel an männlichen Vorbildern in Kindergärten und Grundschulen die Entwicklung von Jungen negativ beeinflussen.
Sind biologische Unterschiede der Grund für schlechtere Leistungen?
Obwohl Gehirnhälftenmodelle Hinweise geben, argumentiert der Text, dass die Geschlechtersozialisation und das soziale Umfeld entscheidendere Faktoren sind.
Was versteht man unter Jungenförderprogrammen?
Ähnlich wie früher Mädchenförderung, sollen diese Programme heute gezielt Jungen unterstützen, um ihre schulischen Defizite auszugleichen und ihre Identität zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Christina Müller (Autor:in), 2006, Schadet die "Frauenschule" den Jungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192669