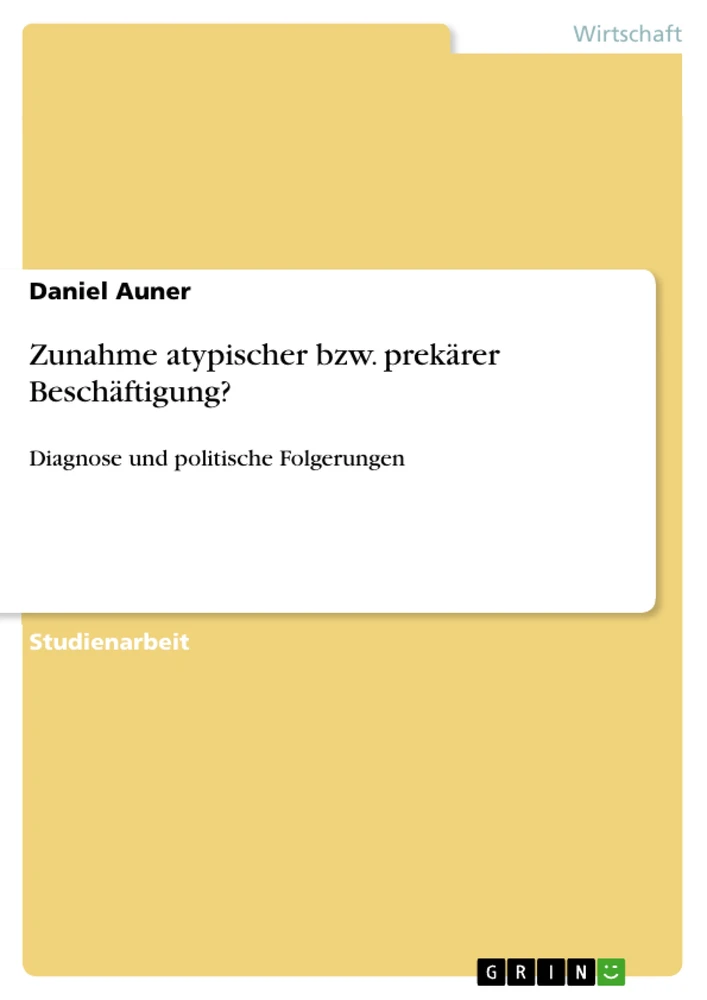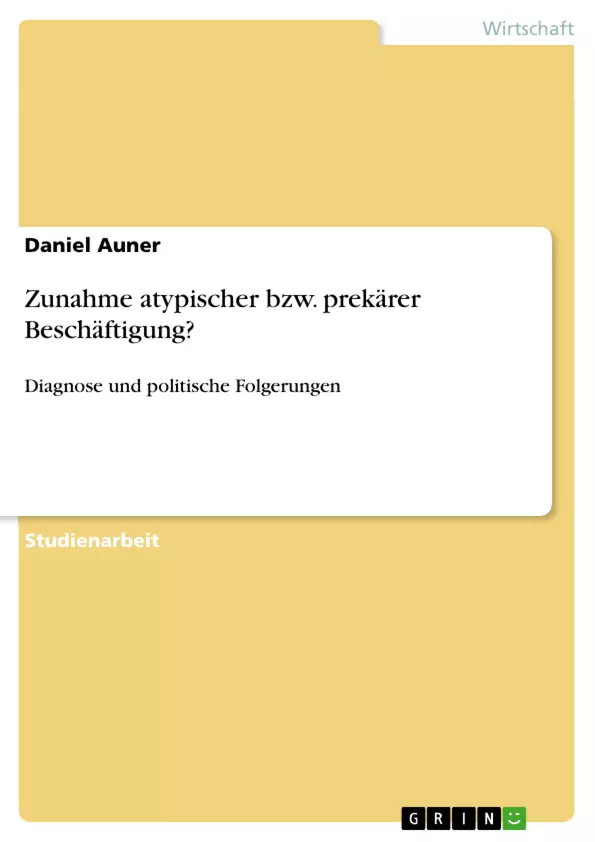Der Arbeitsmarkt von heute ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Beschäftigungsformen. War der Anteil der Normalarbeitsverhältnisse, darunter sind solche Arbeitsverhältnisse zu verstehen, die durch eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung mit Integration in die sozialen Sicherungssysteme gekennzeichnet sind (Statistisches Bundesamt 2009: S.5), gemessen an allen Erwerbstätigen im Jahr 1998 noch bei 72,6%, so liegt dieser Anteil im Jahr 2008 nur noch bei 66% (Statistisches Bundesamt 2009: S.26). Gleichzeitig aber steigt die Zahl der atypisch Beschäftigten an. Worauf diese Zunahme begründet ist und ob atypische Beschäftigung den Aufbau eines „Prekariats“ begünstigt, soll nachfolgend in dieser Arbeit erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Atypische Beschäftigungsverhältnisse
- Gründe für die Inanspruchnahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse aus Sicht der Arbeitnehmer
- Gründe für die Inanspruchnahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse aus Sicht der Unternehmen
- Befristete Arbeitsverträge
- Leiharbeit
- Geringfügige Beschäftigung
- Teilzeitbeschäftigung
- Praktika und geförderte Ein-Euro-Jobs
- Gründe für die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse
- Prekäre Beschäftigung
- Kann man atypische Beschäftigungsverhältnisse als prekär bezeichnen?
- Einkommen
- Beschäftigungsstabilität
- Beschäftigungsfähigkeit
- Politische Folgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Sie untersucht, welche Gründe sowohl auf Seiten der Arbeitnehmer als auch der Unternehmen zu dieser Entwicklung führen. Darüber hinaus wird die Frage geklärt, ob atypische Beschäftigung den Aufbau eines „Prekariats“ begünstigt.
- Die Entwicklung und Gründe für die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse.
- Die verschiedenen Formen atypischer Beschäftigung: befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Praktika und Ein-Euro-Jobs.
- Die Folgen atypischer Beschäftigung für Arbeitnehmer und Unternehmen.
- Die Frage, ob atypische Beschäftigung als prekär zu bezeichnen ist.
- Politische Maßnahmen zur Gestaltung des Arbeitsmarktes im Kontext der Entwicklung atypischer Beschäftigungsverhältnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Einleitung und liefert einen Überblick über die Problematik der zunehmenden atypischen Beschäftigung. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Formen atypischer Beschäftigung definiert und die Gründe für die Inanspruchnahme dieser Formen aus Sicht der Arbeitnehmer und Unternehmen untersucht.
Das dritte Kapitel widmet sich der Prekäre Beschäftigung und beleuchtet die Risiken und Folgen dieser Form der Beschäftigung. Im vierten Kapitel werden die Argumente dafür und dagegen diskutiert, ob atypische Beschäftigung als prekär bezeichnet werden kann.
Abschließend werden im fünften Kapitel politische Folgerungen aus der Analyse gezogen und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Atypische Beschäftigung, Prekäre Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Arbeitsordnungspolitik, Sozialpolitik, Normalarbeitsverhältnis, Befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, Geringfügige Beschäftigung, Teilzeitbeschäftigung, Praktika, Ein-Euro-Jobs, Einkommen, Beschäftigungsstabilität, Beschäftigungsfähigkeit, Politische Folgerungen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem "Normalarbeitsverhältnis"?
Ein Normalarbeitsverhältnis ist eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung, die voll in die sozialen Sicherungssysteme integriert ist.
Was sind Beispiele für atypische Beschäftigung?
Dazu zählen befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung (Minijobs), Teilzeitbeschäftigung, Praktika und Ein-Euro-Jobs.
Warum nehmen atypische Beschäftigungsverhältnisse zu?
Unternehmen nutzen sie zur Flexibilisierung und Kostensenkung, während Arbeitnehmer sie teils aus Mangel an Alternativen oder zur besseren Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf wählen.
Wann wird eine Beschäftigung als "prekär" bezeichnet?
Beschäftigung gilt als prekär, wenn sie durch ein sehr niedriges Einkommen, mangelnde Stabilität und eine geringe soziale Absicherung gekennzeichnet ist, was das Armutsrisiko erhöht.
Begünstigt atypische Beschäftigung die Entstehung eines Prekariats?
Die Arbeit untersucht diesen Zusammenhang kritisch und analysiert Faktoren wie Einkommen, Beschäftigungsstabilität und die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen.
- Arbeit zitieren
- Daniel Auner (Autor:in), 2009, Zunahme atypischer bzw. prekärer Beschäftigung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192707