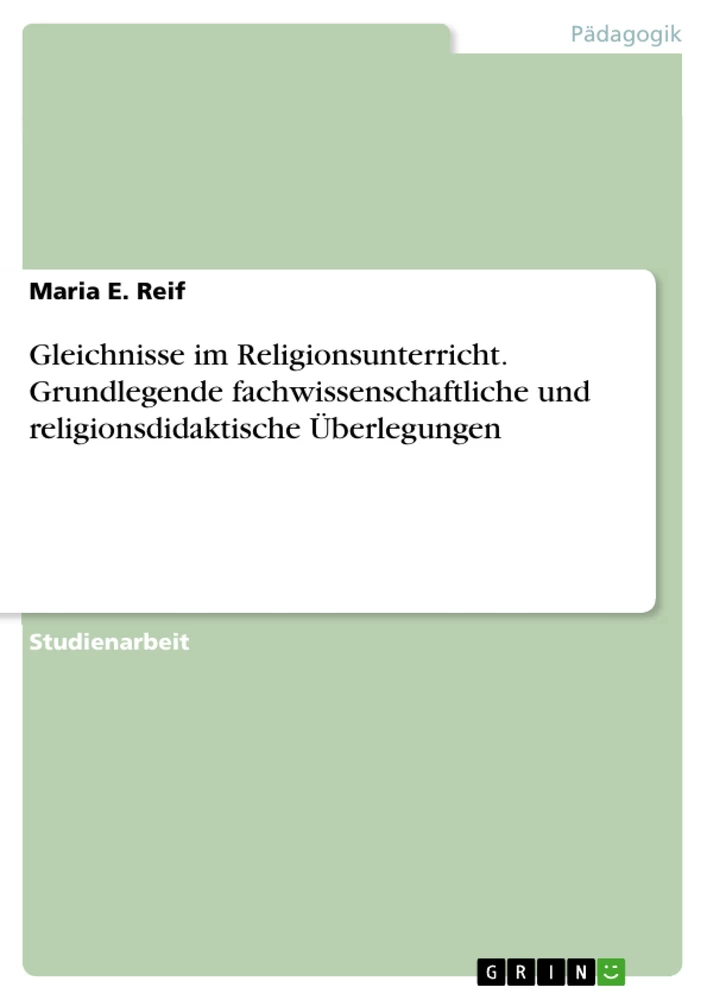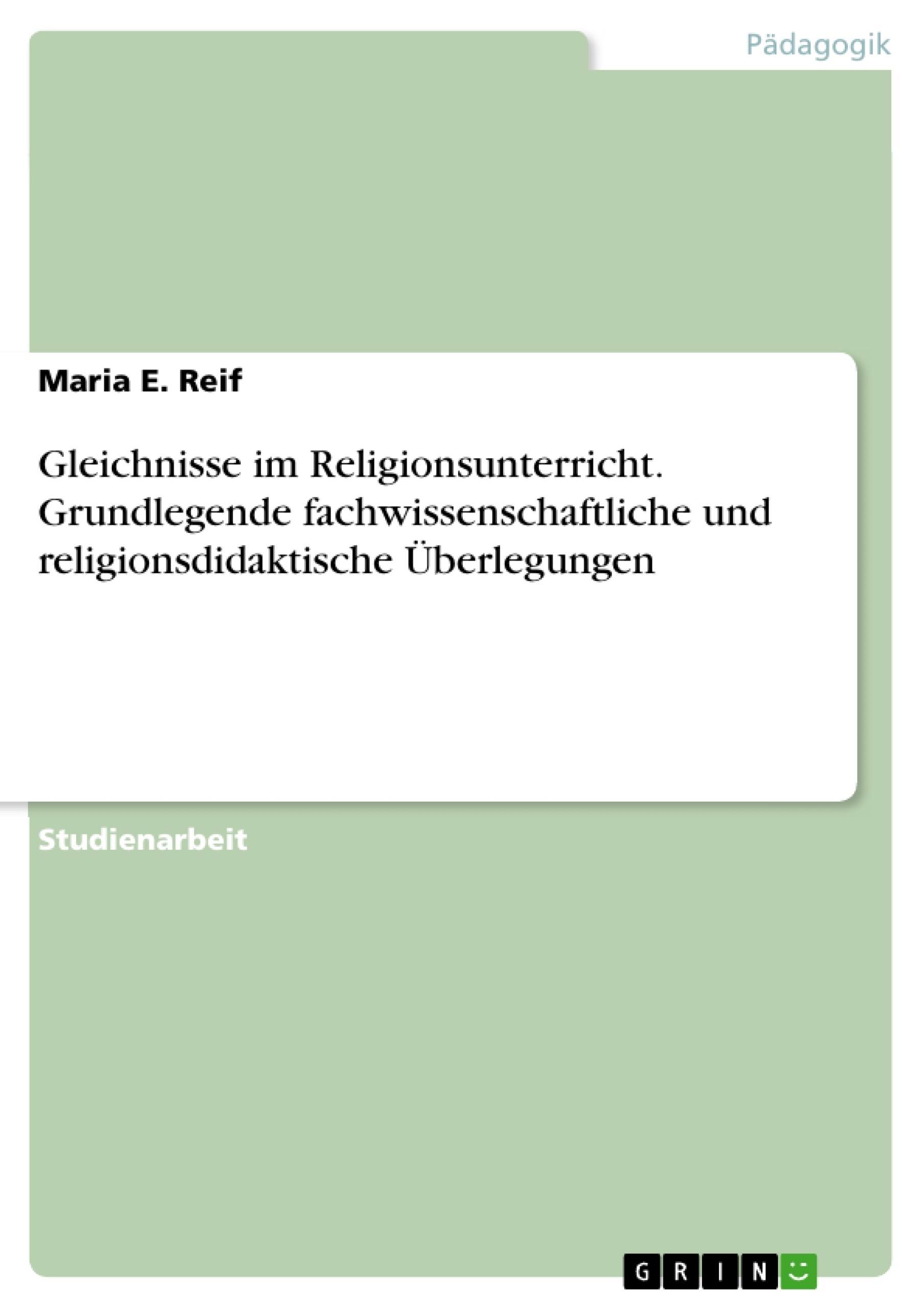Die Bibel birgt Schätze – unter anderem die Gleichnisse Jesu. Sie gehören auch im Religionsunterricht zum Grundstock neutestamentlicher Verkündigung. Gleichzeitig gilt es, die Sinnpotenziale von Gleichnissen auf theologischem, kirchlichem und auch literaturgeschichtlichem Feld immer wieder neu zu entdecken. Gleichnisse können Orientierung geben, herausfordern und ansprechen.
Im Rahmen der vorliegenden Seminararbeit sollen in grundlegenden fachwissenschaftlichen Überlegungen die theologische Dimension von Gleichnissen zur Sprache gebracht werden, sowie die wichtigsten Ansichten innerhalb der Gleichnisforschung dargelegt werden. Nach einer Bestimmung der literarischen Form des Gleichnisses folgen Gattungsbestimmung und Definitionen für die Gleichnisarten. Abschließend werden exemplarisch einige in den Evangelien vorkommende Gleichnisse aufgeführt.
Die didaktischen Überlegungen zur Thematik beinhalten den Hinweis auf die Notwendigkeit eines nicht nur kognitiven sondern auch symbolischen Verstehens der Inhalte von Gleichnissen. Es wird auf die unterschiedlichen Denk- und Verständnisvoraussetzungen in der Primar- und Sekundarstufe hingewiesen und Lernchancen, die durch die Beschäftigung mit Gleichnissen im Unterricht aufgetan werden können, benannt. Der Punkt zu den methodischen Lernwegen möchte aufzeigen, wie diese Gattung neutestamentlicher Erzählungen gewinnbringend in den Unterricht eingebracht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung zum Thema
- 2. Fachwissenschaftliche Überlegungen
- 2.1 Theologische Dimension
- 2.2 Forschungsgeschichtliche Standpunkte
- 2.3 Literarische Form(en) des Gleichnisses
- 2.4 Definitionen und Gattungsbestimmung
- 2.5 Gleichnisse in den Evangelien (exemplarisch)
- 3. Didaktische Überlegungen
- 3.1 Kognitive Voraussetzungen beim lernenden Subjekt
- 3.2 Lernchancen durch Gleichnisse
- 3.3 Methodische Lernwege
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Gleichnissen im Religionsunterricht. Sie verbindet fachwissenschaftliche und religionsdidaktische Überlegungen, um ein tieferes Verständnis für die theologische Dimension von Gleichnissen zu entwickeln und deren Einsatz im Unterricht zu optimieren.
- Theologische Dimension von Gleichnissen
- Forschungsgeschichtliche Perspektiven auf Gleichnisse
- Literarische Form und Gattungsbestimmung von Gleichnissen
- Didaktische Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einsatz von Gleichnissen im Unterricht
- Methodische Ansätze für den religionspädagogischen Umgang mit Gleichnissen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hinführung zum Thema: Diese Einführung stellt die Relevanz von Gleichnissen Jesu im Religionsunterricht heraus. Sie betont die Notwendigkeit, das Sinnpotenzial von Gleichnissen auf theologischer, kirchlicher und literaturgeschichtlicher Ebene immer wieder neu zu entdecken, da sie Orientierung bieten, herausfordern und ansprechen können. Die Arbeit kündigt die folgenden Abschnitte an, die sich mit der theologischen Dimension, der Gleichnisforschung, der literarischen Form, der Definition und der didaktischen Implikationen befassen.
2. Fachwissenschaftliche Überlegungen: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung von Gleichnissen im Neuen Testament und betont die Notwendigkeit, theologische Aspekte und verschiedene forschungsgeschichtliche Zugänge (historisch, hermeneutisch, literarisch) zu berücksichtigen. Es unterstreicht die Herausforderung, schülergerechte Zugänge zu Gleichnissen im Religionsunterricht zu finden, die didaktischen Aspekten gerecht werden. Die verschiedenen Unterkapitel befassen sich detailliert mit der theologischen Dimension, der Forschungsgeschichte, der literarischen Form, der Definition und der exemplarischen Betrachtung von Gleichnissen in den Evangelien. Besonders wird der Aspekt hervorgehoben, dass Gleichnisse als "prädestinierte Medien der Jesuserinnerung" dienen und eine Konvergenz zwischen Form und Inhalt aufweisen.
3. Didaktische Überlegungen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den didaktischen Aspekten des Umgangs mit Gleichnissen im Religionsunterricht. Es wird die Notwendigkeit eines kognitiven und symbolischen Verständnisses der Gleichnisse betont, wobei die unterschiedlichen Denk- und Verständnisvoraussetzungen in der Primar- und Sekundarstufe berücksichtigt werden. Das Kapitel identifiziert Lernchancen, die durch die Beschäftigung mit Gleichnissen im Unterricht entstehen, und präsentiert methodische Lernwege, die den gewinnbringenden Einsatz dieser neutestamentlichen Erzählgattung im Unterricht ermöglichen. Die didaktische Reflexion zielt darauf ab, den Unterricht durch geeignete Methoden zu bereichern und ein tieferes Verständnis der Gleichnisse zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Gleichnisse Jesu, Religionsunterricht, Didaktik, Theologie, Gleichnisforschung, Hermeneutik, Literaturwissenschaft, Lernchancen, Methoden, Neutestamentliche Exegese, Symbolisches Verstehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit über Gleichnisse im Religionsunterricht
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Gleichnissen im Religionsunterricht. Sie verbindet fachwissenschaftliche und religionsdidaktische Überlegungen, um ein tieferes Verständnis für die theologische Dimension von Gleichnissen zu entwickeln und deren Einsatz im Unterricht zu optimieren. Die Arbeit umfasst eine Einführung, fachwissenschaftliche Überlegungen (theologische Dimension, Forschungsgeschichte, literarische Form, Definitionen, Beispiele aus den Evangelien), didaktische Überlegungen (kognitive Voraussetzungen, Lernchancen, Methoden) und eine Schlussbetrachtung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die theologische Dimension von Gleichnissen, verschiedene forschungsgeschichtliche Perspektiven, die literarische Form und Gattungsbestimmung von Gleichnissen, didaktische Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einsatz von Gleichnissen im Unterricht sowie methodische Ansätze für den religionspädagogischen Umgang mit Gleichnissen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung von Form und Inhalt der Gleichnisse und ihrer Bedeutung als "prädestinierte Medien der Jesuserinnerung".
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Hinführung zum Thema, 2. Fachwissenschaftliche Überlegungen (mit Unterkapiteln zu Theologie, Forschungsgeschichte, literarischer Form, Definition und Beispielen aus den Evangelien), 3. Didaktische Überlegungen (kognitive Voraussetzungen, Lernchancen, Methoden) und 4. Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Inhaltsangabe zusammengefasst.
Wie werden die didaktischen Aspekte behandelt?
Der didaktische Teil der Arbeit konzentriert sich auf die kognitiven und symbolischen Verständnisvoraussetzungen beim Umgang mit Gleichnissen im Unterricht, sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe. Es werden Lernchancen durch den Einsatz von Gleichnissen identifiziert und methodische Ansätze für einen gewinnbringenden Unterricht vorgestellt. Das Ziel ist, den Religionsunterricht durch geeignete Methoden zu bereichern und ein tieferes Verständnis der Gleichnisse zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gleichnisse Jesu, Religionsunterricht, Didaktik, Theologie, Gleichnisforschung, Hermeneutik, Literaturwissenschaft, Lernchancen, Methoden, Neutestamentliche Exegese, Symbolisches Verstehen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist es, die Bedeutung von Gleichnissen im Religionsunterricht zu untersuchen und ein tieferes Verständnis für deren theologische Dimension zu entwickeln. Dies soll dazu beitragen, den Einsatz von Gleichnissen im Unterricht zu optimieren und schülergerechte Zugänge zu finden.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende der Religionspädagogik, Lehrer*innen des Religionsunterrichts und alle, die sich mit der didaktischen und theologischen Bedeutung von Gleichnissen im Neuen Testament auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Maria E. Reif (Author), 2012, Gleichnisse im Religionsunterricht. Grundlegende fachwissenschaftliche und religionsdidaktische Überlegungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192732