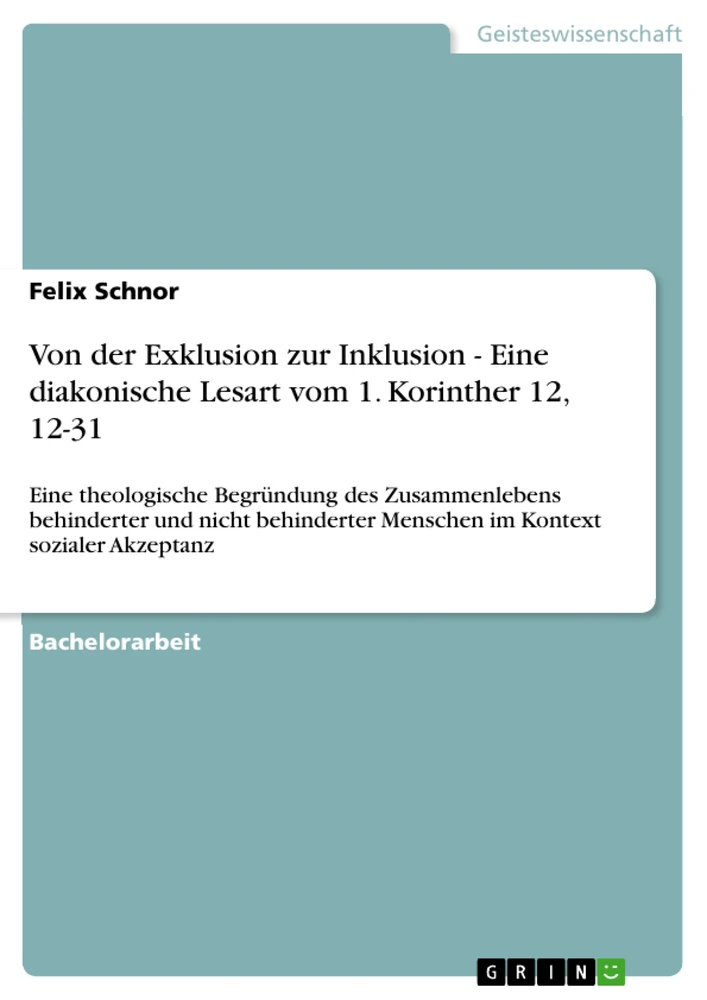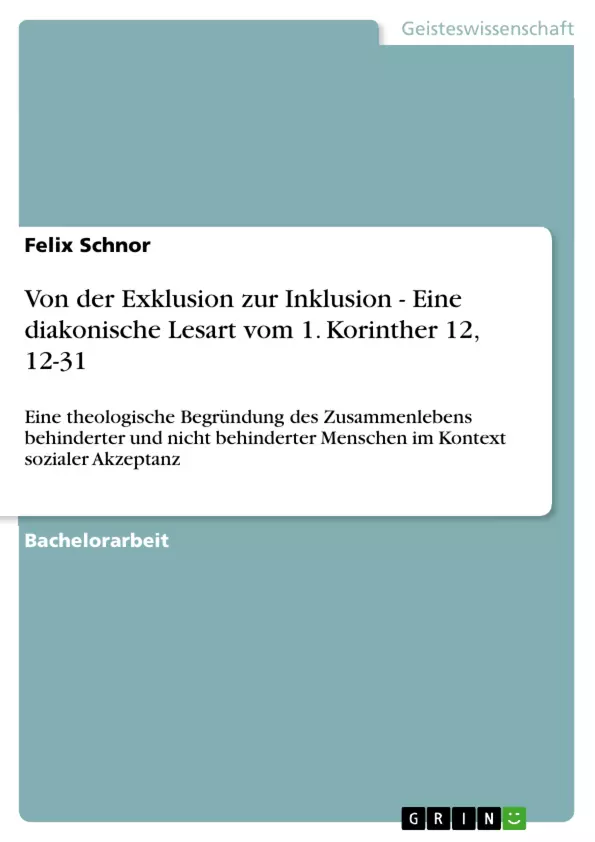Ist Gleichberechtigung nur ein Thema unserer Zeit, oder finden wir es schon in der Bibel?
Gibt es die Diskussion um Exklusion(Ausschluss, Separieren von Menschen aus der Gesellschaft) oder/und Inklusion (gleichberechtigte Akzeptant aller Menschen) auch schon in der Bibel,
und ist Gleichberechtigung auch schon ein biblisches Menschenrecht?
Um diesen Fragen aus diakonischer Perspektive auf den Grund zu gehen, wird in dieser Arbeit der Abschnitt 1. Korinter 12, 12-31 näher untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Korinther 12, 12-31, Korinth und Paulus
- 1.1 Erklärungen zum 1. Korinther 12,12-31 (Exegese)
- 1.2 Blick auf die Korinther Gemeinde aus den Informationen aus 1. Kor 12,12-31
- 1.3 Blick auf die Beweggründe Paulus, die Verse „1. Kor 12, 12-32\" zu schreiben
- 2 Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Begriffe Seperation, Integration und Inklusion
- 2.1 Die Begriffe Exklusion, Separation, Integration und Inklusion grafisch dargestellt und erläutert
- 2.1.1 Die Auseinandersetzung mit der lateinischen Übersetzung der Wörter Integration und Inklusion
- 2.1.2 Was versteht man heute unter Integration und wie hat sich dieses Verständnis im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert?
- 2.1.3 Was bedeutet Inklusion in der praktischen Umsetzung?
- 2.2 Was können wir unter Exklusion, Separation, Integration und Inklusion im Sinne der Korinther und unseres heutigen Gemeindelebens verstehen?
- 3 Der Zusammenhang vom 1. Korinther 12,12-31 und dem Wunsch nach Inklusion
- 4 Ein Dutzend Gründe, warum die Integration in der Gesellschaft scheitert
- 5 Inwieweit ist inkludierendes Handeln im Assistenzbereich für behinderte Menschen automatisch diakonisches Handeln
- 6 Die Glieder und der eine Leib
- 7 Die Beantwortung der drei gestellten Fragen:
- 7.1 Gleiche Rechte für alle?
- 7.2 Für wen ist Christus gestorben?
- 7.3 Wie können wir miteinander leben?
- 8 War die Urgemeinde als Lebensgemeinschaft geprägt durch die Anweisungen der Bergpredigt eine inklusive Gemeinde?
- Fazit
- Nachbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diakonenarbeit befasst sich mit dem Abschnitt 1. Korinther 12, 12-31, um aus diakonischer Perspektive die Fragen nach Gleichberechtigung und Inklusion in der Bibel zu untersuchen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob die Diskussion um Exklusion oder/und Inklusion bereits in der Bibel vorhanden ist und ob Gleichberechtigung ein biblisches Menschenrecht darstellt.
- Exegetische Analyse des 1. Korinther 12, 12-31
- Entwicklung des Verständnisses von Exklusion, Separation, Integration und Inklusion
- Der Zusammenhang zwischen 1. Korinther 12, 12-31 und dem Wunsch nach Inklusion
- Die Bedeutung von Inklusion in der heutigen Gesellschaft
- Die Rolle des christlichen Glaubens in der Inklusionsdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der biblischen Grundlage von Gleichberechtigung und Inklusion und führt die drei zentralen Fragen der Arbeit ein.
- Kapitel 1 beleuchtet den Kontext des 1. Korinther Briefes, insbesondere die Situation in der Korinther Gemeinde und die Motivationen des Apostels Paulus für seine Ausführungen.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Begriffen Exklusion, Separation, Integration und Inklusion und deren Entwicklung über die Zeit.
- Kapitel 3 untersucht die Verbindung zwischen den Aussagen des 1. Korinther 12, 12-31 und dem Wunsch nach Inklusion.
- Kapitel 4 analysiert die Gründe für das Scheitern von Integrationsbemühungen in der Gesellschaft.
- Kapitel 5 befasst sich mit der Frage, ob inkludierendes Handeln im Assistenzbereich für behinderte Menschen automatisch diakonisches Handeln darstellt.
- Kapitel 6 beleuchtet die Metapher des Leibes Christi im 1. Korinther 12 und deren Bedeutung für das Miteinander in der Gemeinde.
- Kapitel 7 beantwortet die drei zentralen Fragen der Arbeit: die Gleichberechtigung, das Sterben Christi und das Miteinanderleben.
- Kapitel 8 untersucht die Frage, ob die Urgemeinde durch die Anweisungen der Bergpredigt eine inklusive Lebensgemeinschaft darstellte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: 1. Korinther 12, 12-31, Inklusion, Exklusion, Integration, Diakonie, Gleichberechtigung, Gemeinde, Leib Christi, Menschlichkeit, Behinderung, Assistenzbereich, Bergpredigt.
Häufig gestellte Fragen
Was sagt der 1. Korinther 12 über Inklusion aus?
Der Text nutzt die Metapher des einen Leibes mit vielen Gliedern, um zu zeigen, dass jeder Mensch – unabhängig von seinen Fähigkeiten – ein wertvoller Teil der Gemeinschaft ist.
Ist Gleichberechtigung ein biblisches Menschenrecht?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die biblischen Texte bereits Konzepte von Inklusion und gleicher Würde aller Menschen enthalten, lange bevor moderne Menschenrechte formuliert wurden.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion in diesem Kontext?
Während Integration oft das Anpassen des Einzelnen an ein System meint, fordert Inklusion eine Gemeinschaft, die von vornherein so gestaltet ist, dass jeder dazugehört.
War die Urgemeinde eine inklusive Gemeinschaft?
Die Arbeit analysiert, ob die Urgemeinde durch die Anweisungen der Bergpredigt als eine inklusive Lebensgemeinschaft verstanden werden kann.
Ist inkludierendes Handeln automatisch diakonisches Handeln?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob die Unterstützung behinderter Menschen im Sinne der Inklusion ein wesensnotwendiger Teil des christlichen Auftrags (Diakonie) ist.
- Citation du texte
- Felix Schnor (Auteur), 2012, Von der Exklusion zur Inklusion - Eine diakonische Lesart vom 1. Korinther 12, 12-31, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192789