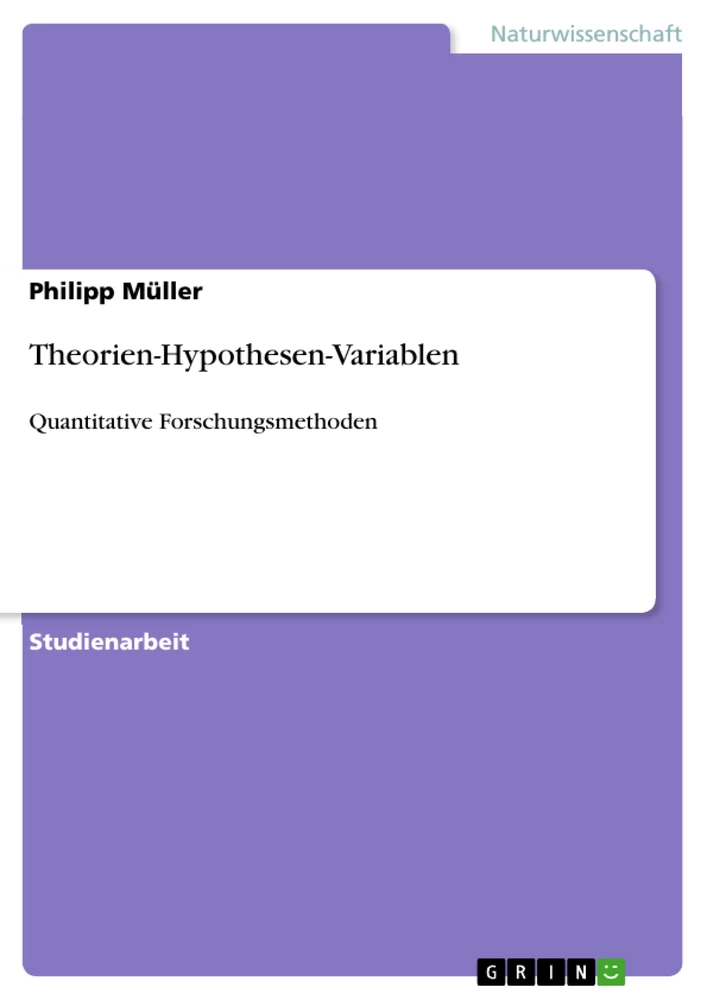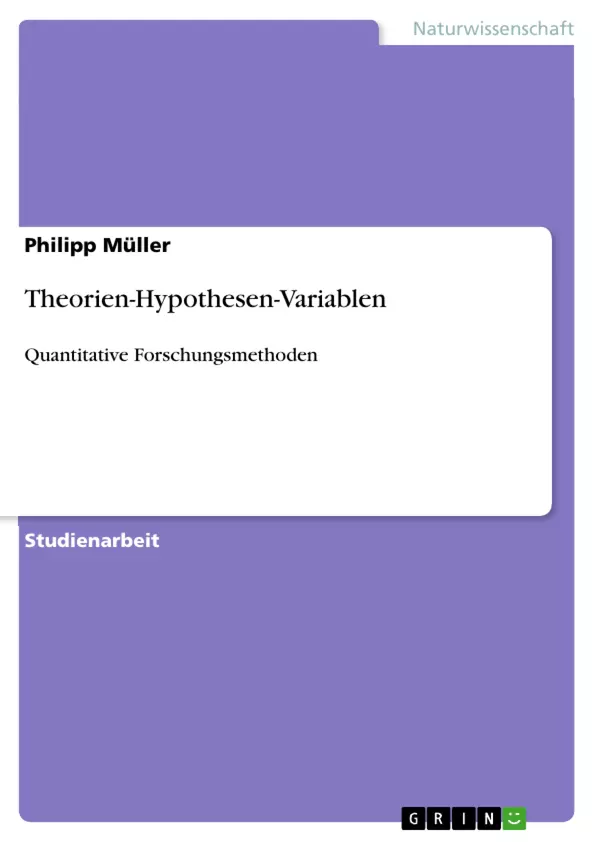In der schriftlichen Ausarbeitung werde ich größtenteils Inhalt als auch Ablauf meines Referates beibehalten. Demzufolge werde ich mit der Definition der wissenschaftlichen Hypothese beginnen, mit den verschiedenen Arten der Hypothesen fortfahren, über Theorie und Modell berichten und mit Falsifikationismus und Konkurrenz von Forschungsprogrammen enden. Dementsprechend werde ich für dieses Thema wichtige Aspekte wie „Typen von Variablen“, „Arten von Sätzen“ und „Informationsgehalt“, sowie „Wissenschaftliche Erklärungen“ nicht beleuchten, da diese von meiner Kommilitonin vorgestellt und somit auch in ihrer Hausarbeit bearbeitet werden bzw. wurden. Da es sich um eine schriftliche Ausarbeitung meines Referats handelt, werde ich die darin verwendete Literatur als Grundlage verwenden. Mein Anspruch besteht darin, einen knappen, verständlichen und übersichtlichen ersten Einblick in das Thema zu ermöglichen und somit gemäß dem Seminar, einen ersten Eindruck in quantitative Forschungsmethoden zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Wissenschaftliche Hypothesen
- 1.1 Definition
- 1.2 Unterschiedliche Arten von Hypothesen
- 1.3 Mathematische Darstellung der Zusammenhänge
- 2. Theorie & Modell
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Eigenschaften von Modellen
- 3. Verifikation und Falsifikation
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Ausarbeitung widmet sich den zentralen Inhalten der Seminarsitzung „-Theorien-Hypothesen-Variablen-“, die am 11.05.2009 von der Autorin und C.C. gehalten wurde. Sie verfolgt das Ziel, einen ersten Einblick in die Thematik zu geben, indem sie die Definition der wissenschaftlichen Hypothese, verschiedene Arten von Hypothesen, Theorie und Modell sowie Falsifikationismus und Konkurrenz von Forschungsprogrammen beleuchtet.
- Wissenschaftliche Hypothesen: Definition und Kriterien
- Arten von Hypothesen: gerichtete und ungerichtete, kausale und probabilistische
- Theorie und Modell: Definition und Eigenschaften
- Falsifikationismus und Konkurrenz von Forschungsprogrammen
- Einführung in quantitative Forschungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung dient als Überblick über die Inhalte der schriftlichen Ausarbeitung, die sich an der Seminarsitzung zum Thema „-Theorien-Hypothesen-Variablen-“ orientiert. Die Autorin gibt einen groben Überblick über die Themen, die in der Arbeit behandelt werden, und erklärt, warum bestimmte Aspekte nicht weiter beleuchtet werden. Sie betont den Anspruch, einen verständlichen und übersichtlichen Einstieg in das Thema zu ermöglichen.
1. Wissenschaftliche Hypothesen
Der erste Kapitel befasst sich mit der Definition und den Kriterien wissenschaftlicher Hypothesen. Die Autorin erklärt, dass wissenschaftliche Hypothesen mehr als nur Vermutungen sind und feste Bestandteile empirischer Forschung darstellen. Sie präsentiert vier zentrale Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine Behauptung als wissenschaftliche Hypothese gelten kann.
1.1 Definition
Die Autorin definiert wissenschaftliche Hypothesen als Annahmen über reale Sachverhalte, die in Form von Konditionalsätzen formuliert werden. Diese Hypothesen müssen über den Einzelfall hinausweisen und durch empirische Daten widerlegbar (falsifizierbar) sein. Es werden vier wichtige Punkte für die Definition einer wissenschaftlichen Hypothese erläutert: realer Sachverhalt und empirische Untersuchbarkeit, Allgemeingültigkeit, sinnvoller Konditionalsatz und potentielle Falsifizierbarkeit.
1.2 Unterschiedliche Arten von Hypothesen
Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Arten von Hypothesen, die sich durch ihre Merkmale und Eigenschaften unterscheiden. Die Autorin unterscheidet zwischen ungerichteten und gerichteten Hypothesen, die den Zusammenhang oder Unterschied zwischen zwei Variablen aufzeigen. Sie erklärt die Vorteile gerichteter Hypothesen im Vergleich zu ungerichteten Hypothesen und erläutert verschiedene Arten von Hypothesen: kausale, deterministische, probabilistische, Aggregat-, Zusammenhangs-, Entwicklungs-, Individual-, Kollektiv- und Kontexthypothesen. Es werden wichtige Aspekte wie Luhmanns Begriff des Technologiedefizits und die Herausforderungen bei der Formulierung von Kausalhypothesen in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe der schriftlichen Ausarbeitung sind wissenschaftliche Hypothesen, Theorie, Modell, Falsifikation, empirische Forschung, Variablen, Konditionalsätze, Falsifizierbarkeit, gerichtete und ungerichtete Hypothesen, kausale Hypothesen, probabilistische Hypothesen, Technologiedefizit, Forschungsprogramme und quantitative Forschungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert eine wissenschaftliche Hypothese?
Eine wissenschaftliche Hypothese ist eine Annahme über reale Sachverhalte, die in Konditionalsätzen (Wenn-Dann/Je-Desto) formuliert wird, allgemeingültig ist und durch empirische Daten widerlegt werden kann.
Was ist der Unterschied zwischen Verifikation und Falsifikation?
Verifikation ist die Bestätigung einer Theorie durch Daten. Falsifikation hingegen ist der Nachweis der Unrichtigkeit einer Hypothese. In der kritischen Wissenschaftstheorie gilt: Theorien können nie endgültig bewiesen, sondern nur vorläufig bestätigt werden.
Wie unterscheiden sich gerichtete und ungerichtete Hypothesen?
Eine ungerichtete Hypothese besagt nur, dass es einen Unterschied gibt. Eine gerichtete Hypothese gibt die Richtung des Zusammenhangs vor (z.B. „A ist größer als B“), was einen höheren Informationsgehalt bietet.
Was versteht man unter dem „Technologiedefizit“ nach Luhmann?
Es beschreibt die Schwierigkeit in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften, kausale Wirkungen exakt vorherzusagen, da Menschen keine trivialen Maschinen sind und Umweltfaktoren nicht vollständig kontrolliert werden können.
Was kennzeichnet ein wissenschaftliches Modell?
Ein Modell ist eine vereinfachte Abbildung der Realität, die komplexe Zusammenhänge greifbar macht und sich auf die für die Forschungsfrage relevanten Aspekte konzentriert.
- Quote paper
- Philipp Müller (Author), 2009, Theorien-Hypothesen-Variablen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192888