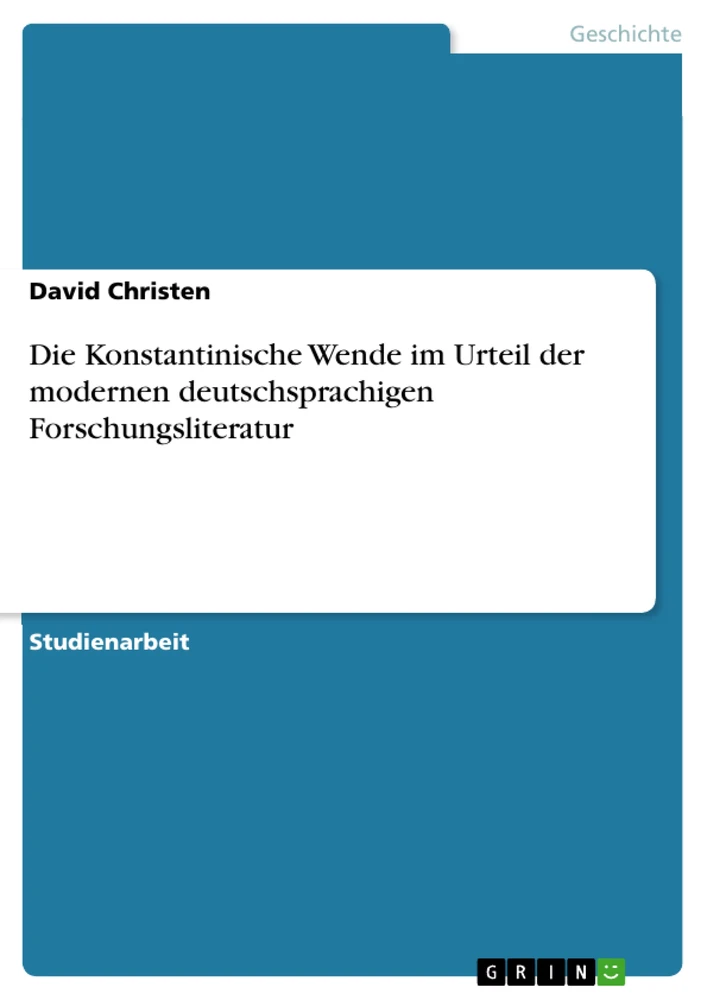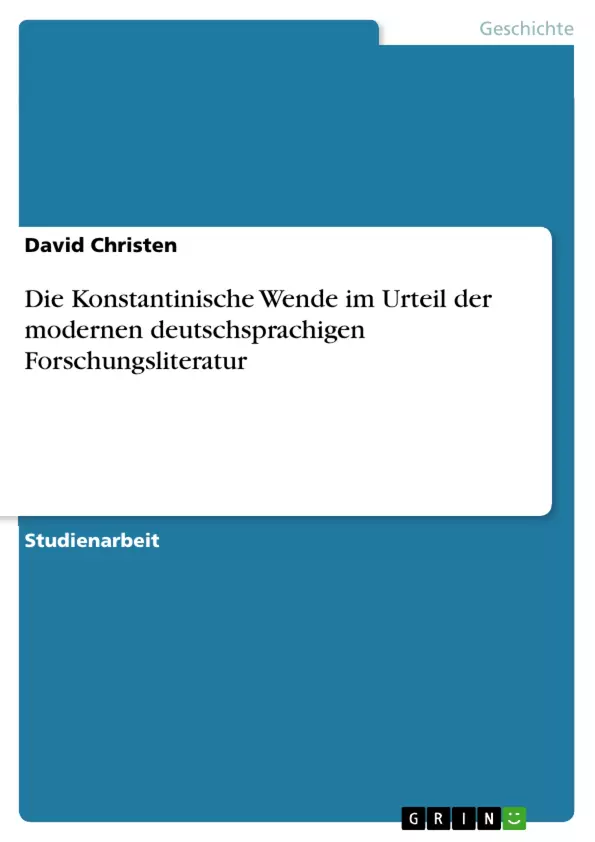Die Forschungsdiskussion um die Konstantinische Wende ist eine der ausgeprägtesten der antiken Geschichte. Wie, und vor allem, wieso genau Konstantin sich vor über 1700 Jahren dem Christentum zugewandt hat, ist und bleibt eine brennende Frage, da dieser Entscheid den weiteren Verlauf der europäischen und auch der weltweiten Geschichte wie vielleicht kein anderer beeinflusst hat. Denn das Christentum hat sich darauf zur Weltreligion entwickelt. Die umstrittenste Frage ist, ob Konstantin wirklich ein Christ war. Oder hat er sich aus reinen machtpolitischen Überlegungen dem Christentum zugewandt? Oder lässt sich diese Frage gar nicht beantworten, weil sie aus einer modernen Sichtweise auf die Antike entspringt?
In dieser Arbeit sollen nun, nach einer kurzen Einführung in Konstantins Zeit, vier verschiedene deutschsprachige Forschungsstandpunkte zu dieser Thematik genauer betrachtet werden. Angefangen mit Jacob Burckhardt und dessen Wert „Die Zeit Constantins des Grossen“ von 1853 geht es weiter mit Joseph Vogt, der 1949 „Constantin der Grosse und sein Jahrhundert“ veröffentlichte, über Jochen Bleicken, dessen Buch „Constantin der Grosse und die Christen“ aus dem Jahr 1990 stammt, bis zu Klaus Martin Girardet und seinem Werk über Konstantin mit dem Titel „Der Kaiser und sein Gott“, welches 2010 erschienen ist.
Es sind Arbeiten aus verschiedenen Zeitpunkten der letzten 160 Jahre. An diesen lässt sich besonders gut beobachten, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung und der persönliche Hintergrund des Autors einen wichtigen Unterschied in deren Beurteilung machen. Denn, um auf das Eingangszitat von Faulkner zurückzukommen, die Geschichte ist nicht tot, sie wird immer wieder neu in der Gegenwart konstruiert. Zusätzlich stellt sich bei einer derart einflussreichen Entwicklung wie der Konstantinischen Wende die Frage, ob es auch anders hätte kommen können. Wenn Konstantin sich nicht für das Christentum stark gemacht hätte, wie hätte sich die Geschichte dann weiter entwickelt? Auch hier herrscht unter den vorgestellten Historikern keine Einigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Zeit Konstantins
- Der historische Hintergrund
- Der Weg Konstantins zum Alleinherrscher
- Die Christenpolitik der Kaiser
- Die Quellen zu Konstantin
- Die spätere Beurteilung von Konstantin
- Ein Vergleich deutschsprachiger Forschungsliteratur
- Jacob Burckhardt - Die Zeit Constantins des Grossen (1853)
- Joseph Vogt - Constantin der Grosse und sein Jahrhundert (1949)
- Jochen Bleicken - Constantin der Grosse und die Christen (1992)
- Klaus Martin Girardet - Der Kaiser und sein Gott (2010)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Forschungsdiskussion um die Konstantinische Wende, insbesondere die Frage nach Konstantins Bekehrung zum Christentum und den Einfluss dieses Ereignisses auf die Geschichte Europas und der Welt. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von vier verschiedenen deutschsprachigen Forschungsstandpunkten aus unterschiedlichen Zeitpunkten.
- Die Rolle Konstantins in der europäischen und weltweiten Geschichte
- Die Motivation Konstantins für die Hinwendung zum Christentum
- Die Interpretation der Konstantinischen Wende in der modernen Forschung
- Die Entwicklung der Forschung zu Konstantin und seinem Jahrhundert
- Der Einfluss von Zeit und persönlichem Hintergrund auf die Bewertung der Konstantinischen Wende
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Konstantinischen Wende ein und erläutert die Relevanz dieser historischen Entwicklung für die europäische und weltweite Geschichte. Es wird die Kontroverse um Konstantins Bekehrung zum Christentum aufgezeigt und die zentrale Frage nach seiner Motivation erörtert.
Einführung in die Zeit Konstantins
Der historische Hintergrund
Dieser Abschnitt beleuchtet die Krise des römischen Reiches im 3. Jahrhundert. Die Herausforderungen durch germanische und persische Stämme sowie die Machtkämpfe innerhalb des Reiches werden dargestellt. Diokletians Tetrarchie wird als Reformmaßnahme vorgestellt, die Stabilität und eine bessere Verwaltung ermöglichte.
Der Weg Konstantins zum Alleinherrscher
Dieser Abschnitt beschreibt Konstantins Aufstieg zum Kaiser und seinen Weg zur Alleinherrschaft. Es werden die wichtigsten Stationen seiner Karriere sowie seine militärischen Erfolge und Konflikte mit anderen Kaisern behandelt. Die Bedeutung der Schlacht an der Milvischen Brücke und der darauf folgenden Ereignisse werden erläutert.
Die Christenpolitik der Kaiser
Dieser Abschnitt schildert die Entwicklung der Christenpolitik im römischen Reich. Die unterschiedliche Behandlung von Christen unter verschiedenen Kaisern wird dargestellt, wobei die Verfolgungen unter Decius und Diokletian hervorgehoben werden.
Ein Vergleich deutschsprachiger Forschungsliteratur
Dieser Abschnitt widmet sich der Analyse von vier verschiedenen deutschsprachigen Forschungsstandpunkten zur Konstantinischen Wende. Es werden die Werke von Jacob Burckhardt, Joseph Vogt, Jochen Bleicken und Klaus Martin Girardet vorgestellt und ihre jeweiligen Interpretationen der Konstantinischen Wende diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichen Perspektiven, die diese Forscher auf die Bekehrung Konstantins und deren Auswirkungen auf die Geschichte einnehmen.
Schlüsselwörter
Die Konstantinische Wende, Christentum, Bekehrung, Machtpolitik, Geschichtsinterpretation, Forschungsperspektive, Tetrarchie, Diokletian, Konstantin, Schlacht an der Milvischen Brücke, europäische Geschichte, Weltgeschichte, Jacob Burckhardt, Joseph Vogt, Jochen Bleicken, Klaus Martin Girardet.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der "Konstantinischen Wende"?
Damit wird die Hinwendung des römischen Kaisers Konstantin zum Christentum im frühen 4. Jahrhundert bezeichnet, die den Aufstieg des Christentums zur Weltreligion einleitete.
War Konstantin wirklich ein gläubiger Christ?
Dies ist eine der umstrittensten Fragen der Forschung. Einige Historiker sehen darin reine Machtpolitik, andere eine echte religiöse Überzeugung.
Welche Historiker werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Standpunkte von Jacob Burckhardt (1853), Joseph Vogt (1949), Jochen Bleicken (1990) und Klaus Martin Girardet (2010).
Welche Bedeutung hatte die Schlacht an der Milvischen Brücke?
Die Schlacht im Jahr 312 gilt als Wendepunkt, nach dem Konstantin seinen Sieg dem christlichen Gott zuschrieb und die Christenpolitik des Reiches grundlegend änderte.
Wie beeinflusst der Zeitgeist die historische Forschung?
Die Arbeit zeigt, dass der persönliche Hintergrund und der Zeitpunkt der Veröffentlichung (z.B. 19. Jh. vs. 21. Jh.) die Beurteilung Konstantins maßgeblich prägen.
- Citar trabajo
- David Christen (Autor), 2011, Die Konstantinische Wende im Urteil der modernen deutschsprachigen Forschungsliteratur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192891