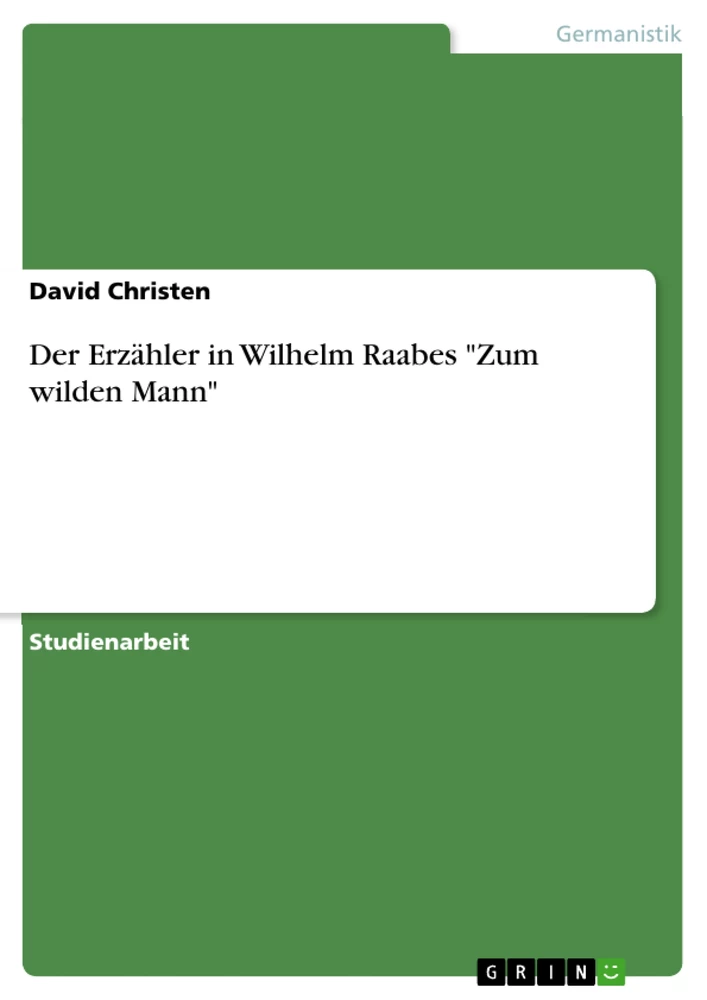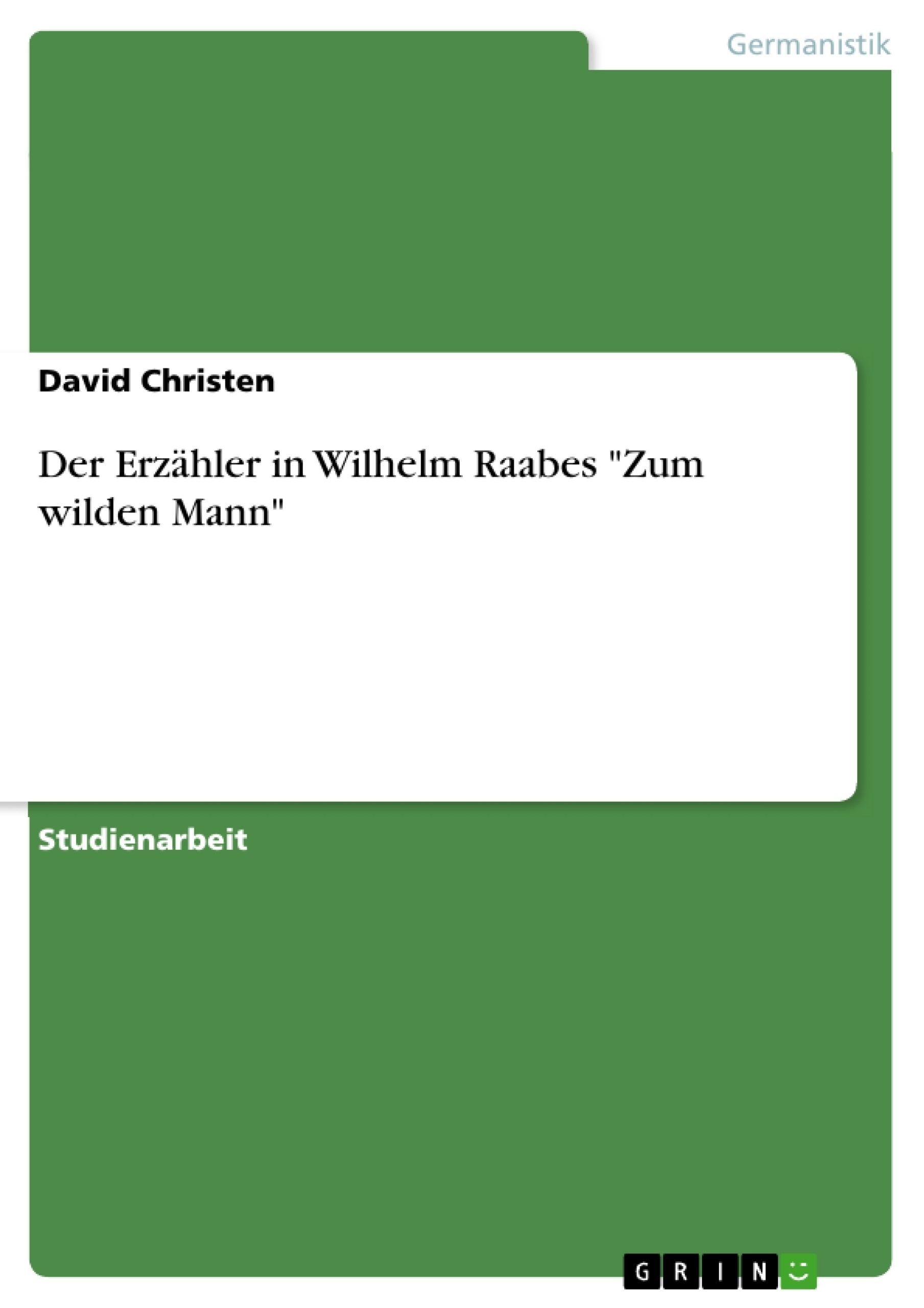"Es erzählt in einfachster Art und Weise eine einfache Begebenheit, an der keine Vorsteherin eines Töchterpensionats noch ein sonstiger Moralist der herkömmlichen Gattungen den geringsten Anstoss nehmen würde, und doch sollte es polizeilich verboten werden.“
So schrieb Wilhelm Jensen 1879, fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung, über Wilhelm Raabes Novelle „Zum wilden Mann“. Was hat ihn so an dieser Erzählung gestört?
„Denn es seziert und präpariert aus der Tiefe der Menschenseele mit Schonungslosigkeit die geheimsten Nervenverzweigungen empörendster Selbstsucht hervor, dass der Leser am Schluss, ohne jegliche ethische und poetische Erhebungsmöglichkeit platt zu Boden geworfen, sich von einem Widerwillen gegen das ganze Menschengeschlecht angepackt fühlt, das solche Beispiele aus seiner Mitte hervorbringt.“
Die Handlung der Geschichte hat also in der Zeit gewisse Leute schockiert. Die Geschichte eines Mannes, der in jungen Jahren von einem obskuren Freund Geld geschenkt bekommt, sich mit diesem eine Existenz aufbaut und jetzt, über 30 Jahre später, unverhofft wieder Besuch von seinem einstigen Freund bekommt und sich nun gezwungen sieht, das Geld wieder mit Zinsen zurückzubezahlen und dadurch ruiniert ist. In der Zeit der Gründerjahre war dies ein sehr aktuelles Thema, das Aufkommen eines kaltblütigen Kapitalismus, wo Geld mehr Wert als Freundschaft hat und man nichts geschenkt bekommt. Diese „einfache Begebenheit“ entfaltet seine Wirkung, weil sie nicht moralisiert, sondern „schonungslos“ darstellt, wie in dieser neuen Zeit ein wirtschaftlich denkender Mensch automatisch die noch in der alten Werteordnung Denkenden ausnützt. Dazu kommt, dass diese „einfache Begebenheit“ in „einfachster Art und Weise“ erzählt wird, wie Jensen gleich zu Beginn des Zitats hervorhebt. Dies muss also die Wirkung der Erzählung auf ihn noch verstärkt haben. Wie diese Geschichte erzählt wird, wird nun Thema dieser Arbeit sein. Dabei wird zuerst die Erzählerfigur untersucht, dann wird die Erzählung in ihrer Zeit verortet, indem das Erzählen im Bürgerlichen Realismus angeschaut wird, in einem dritten Teil werden die verschiedenen Erzählebenen behandelt und es wird eine Hierarchie unter ihnen herausgearbeitet. Im Schlussteil wird dann die Frage beantwortet, ob die Geschichte wirklich „in einfachster Art und Weise“ erzählt wird und wie der Erzählstil zur Wirkung des Inhalts beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Erzählerfigur
- 3. Die Erzählung im Kontext des Bürgerlichen Realismus
- 3.1. Der Erzähler im Bürgerlichen Realismus
- 4. Die Erzählebenen
- 4.1. Hierarchie zwischen den Erzählinstanzen
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Erzählstil in Wilhelm Raabes Novelle „Zum wilden Mann“ und analysiert, wie dieser Stil zur Wirkung der Geschichte beiträgt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Erzählerfigur, die Einordnung der Erzählung in den Kontext des Bürgerlichen Realismus und die Untersuchung der verschiedenen Erzählebenen.
- Analyse der Erzählerfigur und ihrer Rolle in der Geschichte
- Einordnung der Erzählung in den Kontext des Bürgerlichen Realismus
- Untersuchung der Erzählebenen und der Hierarchie zwischen ihnen
- Der Einfluss des Erzählstils auf die Wirkung der Geschichte
- Die Darstellung des aufkommenden Kapitalismus und der Veränderung von Werten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Wirkung von Raabes „Zum wilden Mann“, insbesondere im Hinblick auf Wilhelm Jensens Kritik an der scheinbar einfachen, aber tiefgründigen Darstellung von Selbstsucht und dem Zerfall von Freundschaft im Kontext des aufkommenden Kapitalismus. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Erzählerfigur, den literarischen Kontext und die Erzählebenen analysiert, um die Frage nach dem Erzählstil und seiner Wirkung zu beantworten. Der Fokus liegt auf der scheinbaren Einfachheit der Erzählung, die eine tiefgreifende Kritik an der Gesellschaft beinhaltet.
2. Die Erzählerfigur: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Erzählers in „Zum wilden Mann“. Der Erzähler ist zunächst homodiegetisch, da er in der Erzählung präsent ist, fungiert jedoch als unbeteiligter Beobachter und schafft eine Nähe zum Leser durch die Verwendung des „Wir“. Durch Metalepsen wird die Grenze zwischen Erzähler, Leser und erzählter Welt verwischt. Die Analyse argumentiert für eine letztendlich heterodiegetische Erzählinstanz, da der Erzähler zwar in die Erzählung eingreift, aber nicht direkt an den Ereignissen teilnimmt. Die Verwendung von Imperfekt (Diegesis) und Präsens (Exegesis) wird ebenfalls untersucht, um die verschiedenen Zeitebenen der Erzählung zu verdeutlichen. Das Kapitel zeigt, wie der Erzähler seine Macht über die Erzählung demonstriert, indem er Ereignisse auswählt und Figuren direkt manipuliert. Diese Analyse der Erzählperspektive bildet den Grundstein für das Verständnis des Gesamteffekts der Novelle.
Schlüsselwörter
Wilhelm Raabe, Zum wilden Mann, Erzählerfigur, Bürgerlicher Realismus, Erzählebenen, Metalepse, Kapitalismus, Freundschaft, Selbstsucht, Erzählstil, Wirkungsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu Wilhelm Raabes "Zum wilden Mann"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Erzählstil in Wilhelm Raabes Novelle „Zum wilden Mann“ und untersucht, wie dieser Stil zur Wirkung der Geschichte beiträgt. Der Fokus liegt auf der Erzählerfigur, der Einordnung der Erzählung in den Kontext des Bürgerlichen Realismus und der Analyse der verschiedenen Erzählebenen.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf folgende Themen: die Rolle der Erzählerfigur und deren Einfluss auf die Geschichte; die Einordnung der Novelle in den Bürgerlichen Realismus; die Untersuchung der Erzählebenen und ihrer Hierarchie; der Einfluss des Erzählstils auf die Wirkung der Geschichte; und die Darstellung des aufkommenden Kapitalismus und der Veränderung von Werten in der Novelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, Kapitel zur Erzählerfigur, zur Einordnung in den Bürgerlichen Realismus (inkl. Unterkapitel zum Erzähler im BR), zu den Erzählebenen (inkl. Unterkapitel zur Hierarchie der Erzählinstanzen) und einen Schluss. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Rolle spielt die Erzählerfigur?
Die Analyse der Erzählerfigur untersucht deren homodiegetischen und heterodiegetischen Züge. Es wird untersucht, wie der Erzähler durch die Verwendung von "Wir", Metalepsen und dem Wechsel zwischen Imperfekt und Präsens die Nähe zum Leser herstellt und gleichzeitig seine Macht über die Erzählung demonstriert, indem er Ereignisse auswählt und Figuren manipuliert.
Wie wird die Novelle in den Kontext des Bürgerlichen Realismus eingeordnet?
Die Arbeit analysiert, wie die Erzählung in den Kontext des Bürgerlichen Realismus einzuordnen ist und wie dieser Kontext die Erzählweise und die Themen der Novelle beeinflusst. Es wird insbesondere auf die Darstellung des aufkommenden Kapitalismus und den damit verbundenen Veränderungen von Werten eingegangen.
Welche Erzählebenen werden untersucht?
Die Analyse der Erzählebenen untersucht die Hierarchie zwischen den verschiedenen Erzählinstanzen und deren Einfluss auf die Gesamtgestaltung und Wirkung der Geschichte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wilhelm Raabe, Zum wilden Mann, Erzählerfigur, Bürgerlicher Realismus, Erzählebenen, Metalepse, Kapitalismus, Freundschaft, Selbstsucht, Erzählstil, Wirkungsanalyse.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage der Arbeit ist, wie der Erzählstil in „Zum wilden Mann“ zur Wirkung der Geschichte beiträgt, insbesondere im Hinblick auf Wilhelm Jensens Kritik an der scheinbar einfachen, aber tiefgründigen Darstellung von Selbstsucht und dem Zerfall von Freundschaft im Kontext des aufkommenden Kapitalismus.
Wie wird die Wirkung des Erzählstils analysiert?
Die Wirkungsanalyse betrachtet die scheinbare Einfachheit der Erzählung und deren tiefgreifende gesellschaftliche Kritik. Es wird untersucht, wie die Erzähltechnik – insbesondere die Rolle des Erzählers und die Gestaltung der Erzählebenen – zu dieser Wirkung beiträgt.
- Arbeit zitieren
- David Christen (Autor:in), 2011, Der Erzähler in Wilhelm Raabes "Zum wilden Mann", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192892