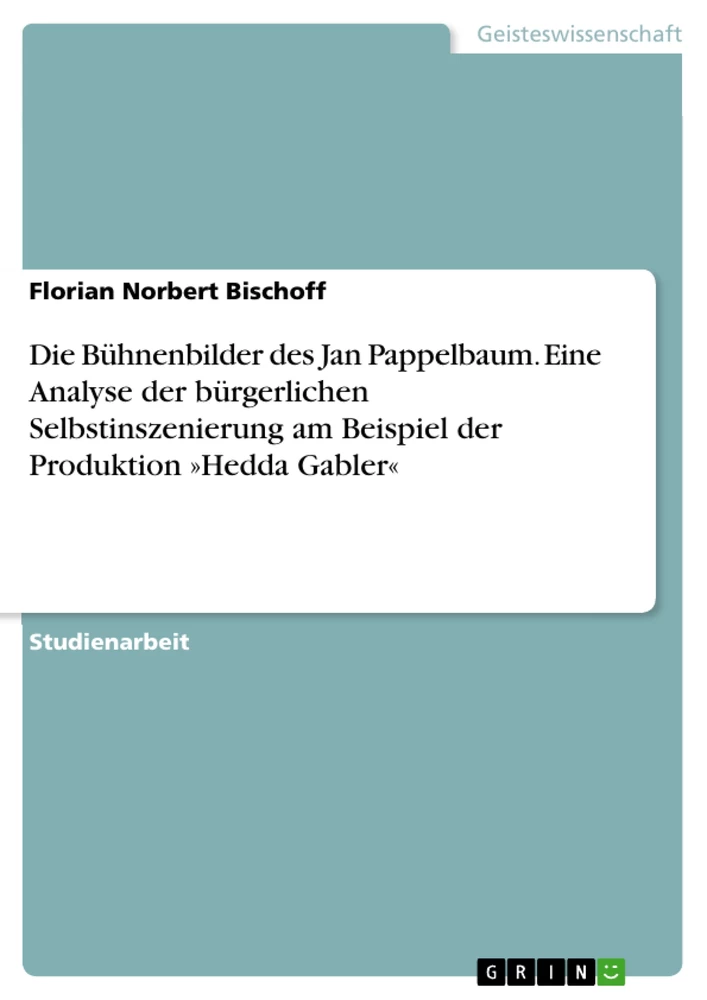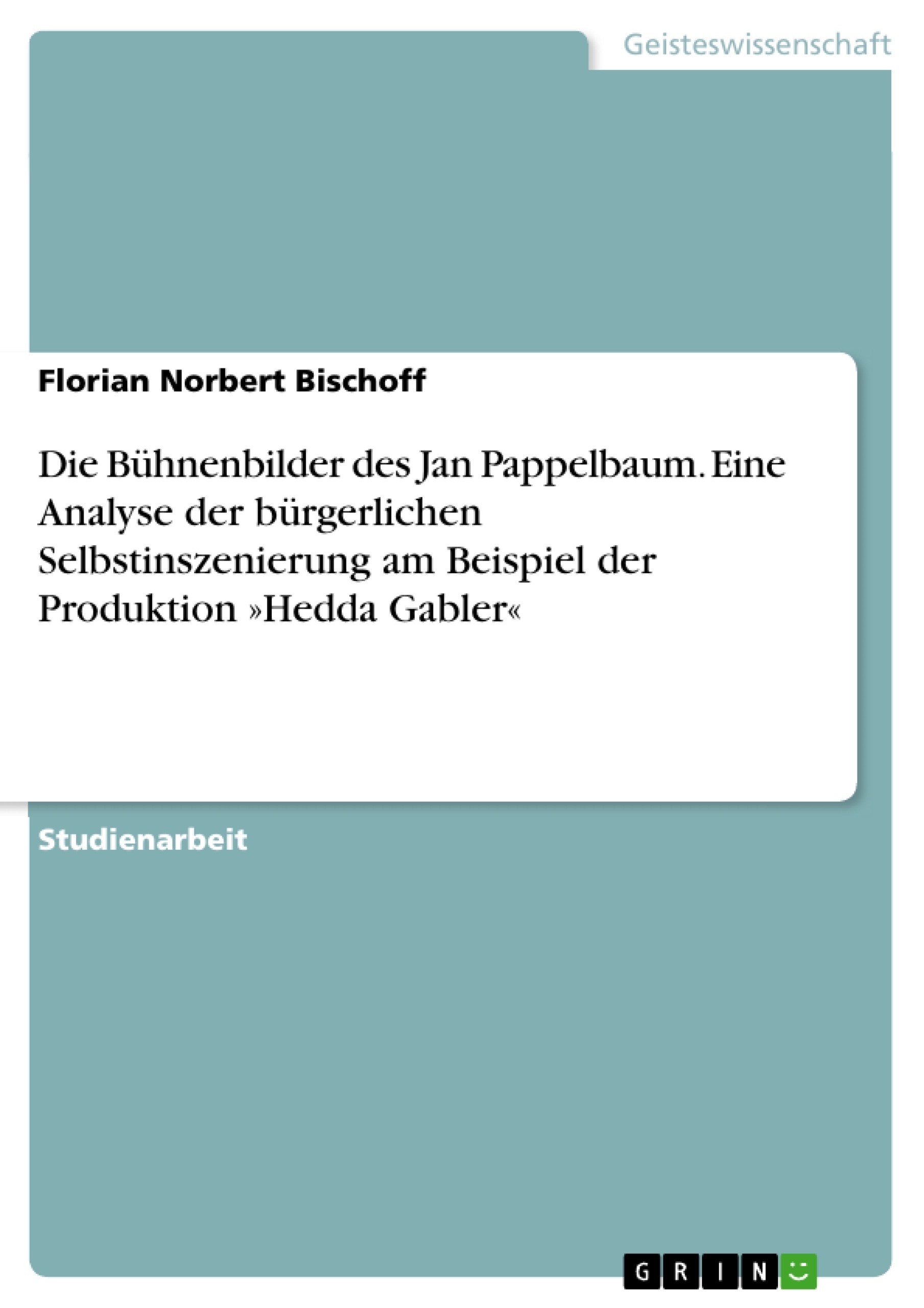„Um Gotteswillen, das macht man doch nicht.“ – mit diesen Worten kommentiert Richter Brack den Selbstmord Hedda Gablers am Ende der gleichlautenden Inszenierung von Thomas Ostermeier (Premiere: 26. Oktober 2005 im Saal B der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin). Es sind gleichzeitig die Worte, die am stärksten auf das um eine „heile Fassade“ bemühte Selbstverständnis jenes Bürgertums zurückweisen, wie man es zur Zeit Henrik Ibsens vorfand.
Ostermeier indes verlegt das ursprüngliche Setting Ibsens vom 19. Jahrhundert ins Hier und Jetzt der Gegenwart: Die Protagonisten bewegen sich im Berliner „Mitte-Loft“, die Duellpistolen des alten General Gablers sind Kleinkaliberwaffen gewichen, die Notizzettel modernen Notebooks. Die dramatische Vorlage in der zeitgemäßen Übersetzung Hinrich Schmidt-Henkels wurde entsprechend modernisiert und verdichtet.
Hedda Gabler die zweite von drei Ibsen-Inszenierungen durch Ostermeier. Allen drei Arbeiten gemein ist die Zusammenarbeit zwischen Ostermeier und dem Bühnenbilder Jan Pappelbaum. Pappelbaum arbeitet in allen drei Inszenierungen mit einem freistehenden, drehbaren Podest im „leeren Raum“ der Schaubühne.
Die nachfolgende Arbeit untersucht, inwiefern Pappelbaums Bühne Wohlstands- und Selbstinszenierung im Alltag bedingt bzw. in ihrer Funktionalität auf eine solche hin angelegt ist. Hierzu werden zunächst die intermedialen Verflechtungen zwischen Bühnenbild der Inszenierung und der klassischen modernen Architektur des 20. Jahrhunderts offengelegt. Auf eine nähere Betrachtung der Bedeutung und Funktion des Wohnens unter Rückbezug auf die Ausführungen Bazon Brocks folgt schließlich die Erörterung der These, dass sich Pappelbaums „Bühnenskulptur mit fehlenden Fassaden“ als eine zentrale Chiffre der vorliegenden Inszenierung verstehen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Um Gotteswillen, das macht man doch nicht
- Einfluss der klassischen Moderne der Architektur
- Fehlende Fassaden – das Bühnenbild als Chiffre der Inszenierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bühnenbildgestaltung von Jan Pappelbaum für Thomas Ostermeiers Inszenierung von Hedda Gabler. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen Pappelbaums Bühnenbild und der klassischen Moderne der Architektur, sowie die Funktion des Bühnenbilds als Chiffre für die Selbstinszenierung des Bürgertums im Stück.
- Der Einfluss der klassischen Moderne auf Pappelbaums Bühnenbildgestaltung
- Die Bedeutung der "fehlenden Fassaden" als zentrales Motiv
- Die Darstellung bürgerlicher Selbstinszenierung und -verständnisse
- Der Vergleich mit anderen Ibsen-Inszenierungen von Ostermeier
- Die intermedialen Verflechtungen zwischen Bühnenbild und Architektur
Zusammenfassung der Kapitel
Um Gotteswillen, das macht man doch nicht: Der einführende Abschnitt beschreibt die Inszenierung von Hedda Gabler durch Thomas Ostermeier und ihren Kontext. Er vergleicht die Inszenierung mit Ostermeiers vorherigen Ibsen-Adaptionen (Nora und John Gabriel Borkmann), betont die Gemeinsamkeiten (Angriff auf das Bürgertum von innen, Zusammenarbeit mit Jan Pappelbaum) und Unterschiede (Heddas kühle Manipulation im Gegensatz zu Noras offenem Widerstand). Die Verlegung des Settings ins moderne Berlin und die Modernisierung des Stücks werden erläutert. Der Selbstmord Heddas wird als zentrale Thematik des Stücks und als Kommentar zu den bürgerlichen Selbstinszenierungen der damaligen und heutigen Zeit vorgestellt.
Einfluss der klassischen Moderne der Architektur: Dieses Kapitel analysiert die architektonischen Einflüsse auf Pappelbaums Bühnenbild. Es wird die minimalistisch-klare Formensprache hervorgehoben und der pragmatische Ansatz Pappelbaums erläutert, der auf Funktionalität und die Vermeidung von "toter Masse" abzielt. Der offene Grundriss, inspiriert von der klassischen Moderne und Architekten wie van der Rohe, wird als zentrales Gestaltungselement beschrieben, im Gegensatz zu den "Kabinetten" anderer Bühnenbildner. Der Einfluss des Bauhauses auf Pappelbaums Arbeit wird ebenfalls diskutiert. Die beschriebenen vier Elemente des Bühnenbilds (Podest, Glasfront, Betonwand, Spiegel) werden detailliert beschrieben und in Bezug zu ihrer Funktion im Stück gesetzt. Die Abkehr von geschlossenen Räumen und die Verwendung des "leeren Raums" werden als charakteristisch für Pappelbaums Stil hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Hedda Gabler, Thomas Ostermeier, Jan Pappelbaum, Bühnenbild, klassische Moderne, Architektur, Bürgertum, Selbstinszenierung, Ibsen, minimalistische Formensprache, offener Grundriss, fehlende Fassaden, Chiffre, Manipulation, Intrige.
Häufig gestellte Fragen: Analyse der Bühnenbildgestaltung von Jan Pappelbaum in Thomas Ostermeiers Inszenierung von Hedda Gabler
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bühnenbildgestaltung von Jan Pappelbaum für Thomas Ostermeiers Inszenierung von Henrik Ibsens Hedda Gabler. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der klassischen Moderne der Architektur auf Pappelbaums Design und der Funktion des Bühnenbilds als Chiffre für die Selbstinszenierung des Bürgertums im Stück.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der klassischen Moderne auf Pappelbaums Bühnenbild, die Bedeutung der "fehlenden Fassaden" als zentrales Motiv, die Darstellung bürgerlicher Selbstinszenierung und -verständnisse, den Vergleich mit anderen Ibsen-Inszenierungen von Ostermeier und die intermedialen Verflechtungen zwischen Bühnenbild und Architektur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit der Inszenierung im Kontext von Ostermeiers anderen Ibsen-Adaptionen ("Um Gotteswillen, das macht man doch nicht"), dem Einfluss der klassischen Moderne der Architektur auf das Bühnenbild ("Einfluss der klassischen Moderne der Architektur") und der Bedeutung der fehlenden Fassaden und der Selbstinszenierung des Bürgertums befassen.
Wie wird der Einfluss der klassischen Moderne beschrieben?
Das Kapitel über den Einfluss der klassischen Moderne analysiert die minimalistisch-klare Formensprache Pappelbaums, seinen pragmatischen Ansatz und den offenen Grundriss, inspiriert von Architekten wie van der Rohe. Der Einfluss des Bauhauses wird ebenfalls diskutiert. Die vier zentralen Elemente des Bühnenbilds (Podest, Glasfront, Betonwand, Spiegel) werden detailliert beschrieben und in Bezug zu ihrer Funktion im Stück gesetzt.
Welche Rolle spielen die "fehlenden Fassaden"?
Die "fehlenden Fassaden" bilden ein zentrales Motiv. Sie werden als Chiffre für die Selbstinszenierung und die Intrigen des Bürgertums interpretiert und im Kontext der offenen, minimalistischen Gestaltung des Bühnenbilds analysiert.
Wie wird die Inszenierung im Kontext anderer Ostermeier-Inszenierungen betrachtet?
Die Arbeit vergleicht Ostermeiers Hedda Gabler-Inszenierung mit seinen vorherigen Ibsen-Adaptionen (Nora und John Gabriel Borkmann), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit dem Thema Bürgertum und der Zusammenarbeit mit Jan Pappelbaum herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf Heddas kühler Manipulation im Gegensatz zu Noras offenem Widerstand.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hedda Gabler, Thomas Ostermeier, Jan Pappelbaum, Bühnenbild, klassische Moderne, Architektur, Bürgertum, Selbstinszenierung, Ibsen, minimalistische Formensprache, offener Grundriss, fehlende Fassaden, Chiffre, Manipulation, Intrige.
- Citation du texte
- Florian Norbert Bischoff (Auteur), 2009, Die Bühnenbilder des Jan Pappelbaum. Eine Analyse der bürgerlichen Selbstinszenierung am Beispiel der Produktion »Hedda Gabler«, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192896