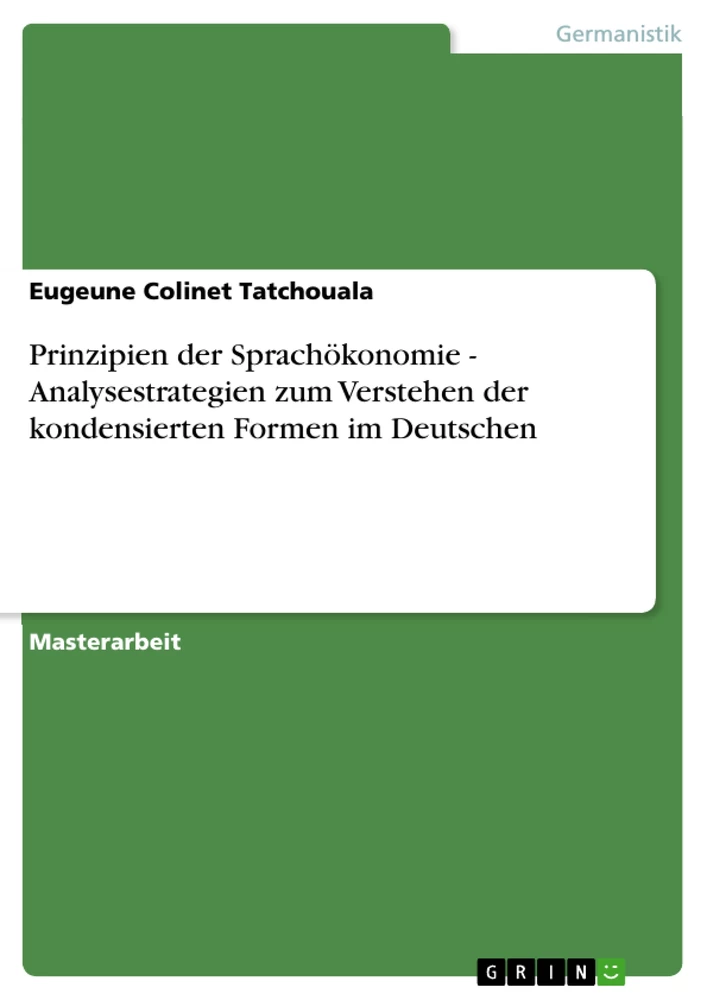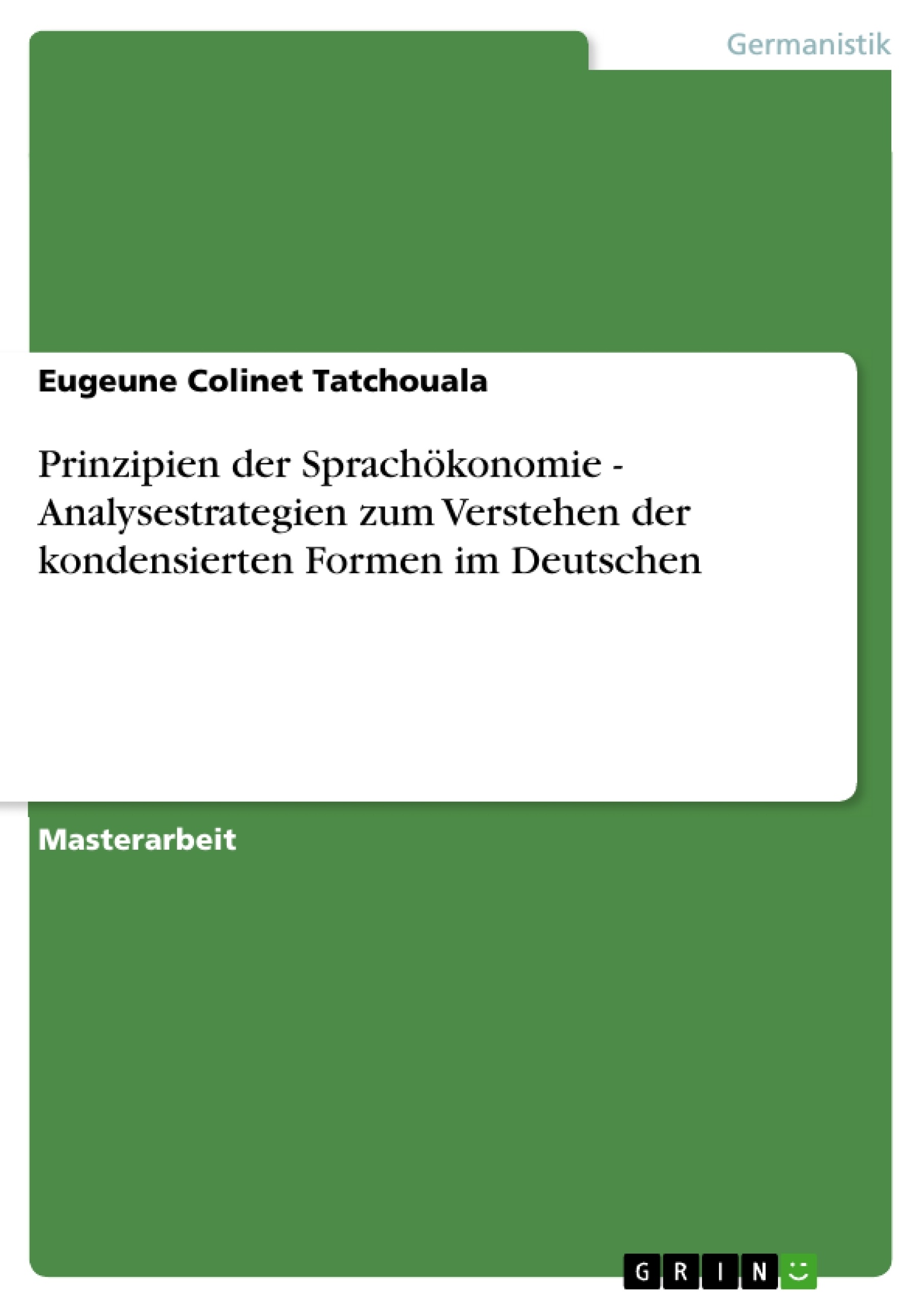"Prinzipien der Sprachökonomie" zeigt durch Veranschaulichungen aus der Literatur die Anforderungen der deutschen Schriftsprache und die Schwierigkeiten der Mutter- sowie Nichtmuttersprachler bei der Erschließung von Bedeutungen komprimierter Sprachformen. Die vorgenommenen ausführlichen Beschreibungen des kompakten Sprachstils mit einem Exkurs über die Beziehung zwischen den beiden Bereichen der Zeichentheorie Linguistik und Semiotik sind eine unentbehrliche Stütze für die DaF-Didaktik und ein offenkundiges Beispiel,wodurch die Partikularität des Sprachzeichens gezeigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- 0. EINLEITUNG
- 0.1. Motivation, Problematik und Ziel
- 0.2. Methodisches Vorgehen und Aufbau
- 1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 1.1 Zur Bedeutung der Begriffe Tiefen- und Oberflächenstruktur in der Satzanalyse
- 1.2 Zum Begriff Text in der linguistischen Forschung
- 1.3 Zum Forschungsstand: Sprachökonomie in der Linguistik
- 2. KONDENSIERTE FORMEN IM DEUTSCHEN
- 2.1 Vorbemerkung
- 2.2 Komprimierte Formen in der Wortbildung
- 2.2.1 Komposita
- 2.2.2 Einige kompakte Derivate
- 2.2.2.1 Derivate auf -chen, -lein, und -bar
- 2.2.2.2 Derivate mit den Präfixen ver- und zer-
- 2.2.2.3 Nomina propria auf –s, -sche, und -er und Appellativa auf –Innen und -and.
- 2.2.3 Abkürzungen
- 2.2.4 Umbildungen
- 2.2.5 Die Univerbierung
- 2.3 Nominalisierungsprozesse in der Phrasenbildung
- 2.3.1 Die erweiterte Nominalphrase
- 2.3.2 Satzäquivalente Präpositionalphrasen
- 2.3.2.1. Präpositionalphrase als Objekt
- 2.3.2.2. Präpositionalphrase als Adverbialbestimmung
- 2.4 Partizipialkonstruktionen als sprachökonomische Mittel
- 2.5 Verblose clauses als sprachökonomische Mittel
- 2.6 Sprachkökonomie und Modalität
- 2.6.1 Modalverben wollen und sollen als sprachökonomische Mittel
- 2.6.2 Modalwörter als sprachökonomische Mittel
- 2.6.3. Modalpartikeln als Satzäquivalente
- 2.6.3.1. Die unbetonte ja
- 2.6.3.2. Die betonte Ja
- 2.6.3.3. Die Partikel aber
- 2.6.4. Der Konjunktiv als kompakte Struktur zum Ausdruck von Wunsch, Hypothese, Aufforderung und Distanz
- 2.6.5. Komprimierte Formen des Imperativs
- 2.7. Antwortpartikeln und Interjektionen in Texten
- 2.8. Elliptische Bildungen als sprachökonomische Strategie im Sprachgebrauch
- 2.8.1 Zum Begriff der Ellipse
- 2.8.2 Ellipsenarten nach Mode und Kürschner
- 2.8.2.1 Zur Koordinationsellipse
- 2.8.2.2 Zur Adjazenzellispse
- 2.8.2.3 Zu den Textsortenellipsen
- 2.8.2.4 Zu den festen Ausdrücken
- 2.8.2.5 Zu den Aufschriften
- 2.8.2.6 Zu den lexikalischen Ellipsen
- 2.9. Implikativer Ausdruck als komprimierende Struktur
- 2.9.1. Begriffsbestimmung
- 2.9.2 Wissensbestände zum Verstehen und Interpretieren der implikativen Ausdrücke
- 2.9.3. Präsupposition als Grundlage des implikativen Ausdrucks
- Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Formen der Sprachökonomie im Deutschen.
- Sie betrachtet die Rolle der komprimierten Formen in der Wortbildung und Phrasenbildung.
- Die Arbeit analysiert verschiedene sprachökonomische Mittel wie Partizipialkonstruktionen, verblose Clauses und elliptische Bildungen.
- Sie beleuchtet die Bedeutung der Modalität und der implikativen Ausdrücke in Bezug auf die Sprachökonomie.
- Die Untersuchung zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Mechanismen der sprachlichen Verdichtung zu gewinnen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Sprachökonomie im Deutschen und analysiert die Strategien der sprachlichen Verdichtung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation, Problematik und Zielsetzung der Untersuchung darlegt. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen zur Sprachökonomie beleuchtet, wobei die Begriffe Tiefen- und Oberflächenstruktur, Text und Forschungsstand im Vordergrund stehen.
Kapitel 2 widmet sich den kondensierten Formen im Deutschen und analysiert komprimierte Formen in der Wortbildung, Nominalisierungsprozesse in der Phrasenbildung, Partizipialkonstruktionen, verblose Clauses, sowie die Rolle der Modalität und der implikativen Ausdrücke. Die Arbeit betrachtet dabei auch elliptische Bildungen als sprachökonomische Strategie im Sprachgebrauch.
Schlüsselwörter
Sprachökonomie, Kondensierte Formen, Wortbildung, Phrasenbildung, Partizipialkonstruktionen, Verblose Clauses, Modalität, Implikativer Ausdruck, Ellipse, Deutsches.
- Quote paper
- Eugeune Colinet Tatchouala (Author), 2006, Prinzipien der Sprachökonomie - Analysestrategien zum Verstehen der kondensierten Formen im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192989