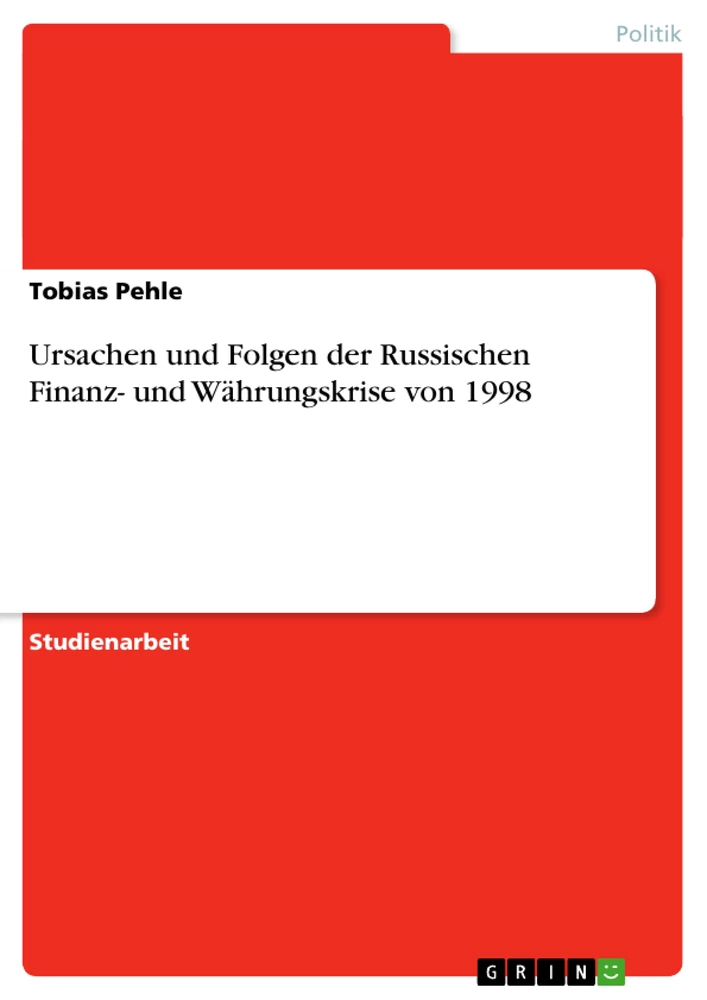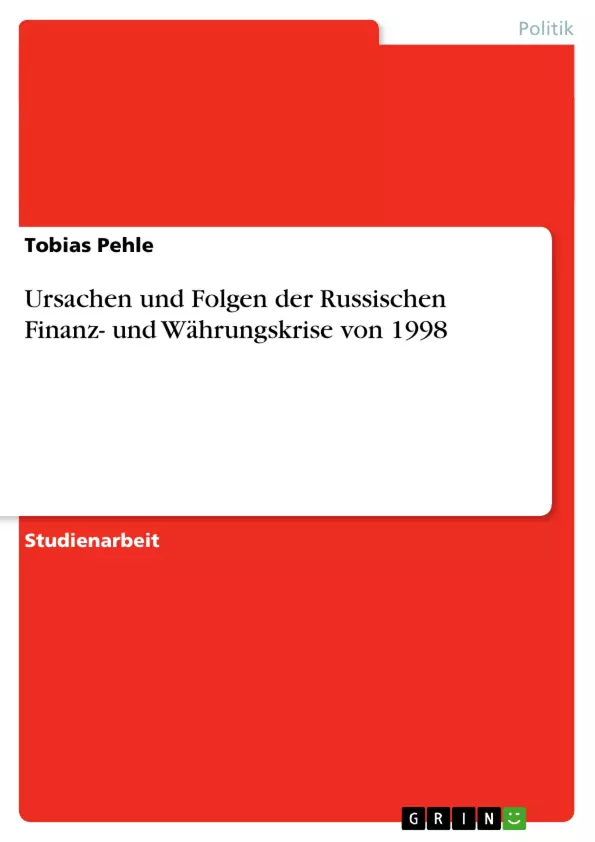Die Transformation einer ganzen Volkswirtschaft, der Wechsel von Kommunismus bzw. Zentralverwaltungswirtschaft zur Marktwirtschaft ist ein komplizierter, langwieriger Prozess. Im Vorfeld der Russlandkrise von 1998, also knapp zehn Jahre nach dem Ende des Kommunismus, befand sich das Riesenreich in einem ökonomischen Vakuum: 80% der Transaktionen der Unternehmen finden auf Basis von Tauschhandel statt, nur knapp 10% der Steuerzahlungen der Großunternehmen gehen bar oder per Überweisung ein; die Schattenwirtschaft und der illegale Kapitalexport florieren, aber die offizielle Wirtschaft schrumpft. Die Dollarisierung schreitet fort, für Rubel gibt es immer weniger, manchmal nichts zu kaufen. Russlands ökonomischer Zustand gleicht am Ende des Jahres 1998 sozialistischen Zeiten.
Vor dem offenen Ausbruch der Krise galt eine Politik mit dem Ziel der monetären Stabilisierung, die mit Hilfe eines Systems fester Wechselkurse erreicht wurde, als größter Erfolg der postsozialistischen Wirtschaftspolitik. Ende 1996 wurde zum ersten Mal ein Wechselkursziel mit einer nominalen Abwertung entsprechend der erwartetetn Inflationsrate für das nächste Jahr festgelegt. Es gelang, die Inflation von über 2500 Prozent im Jahr 1992 auf 11 Prozent in 1997 zu senken und damit das Vertrauen in den Rubel zu stärken. „Das Ziel eines nominellen Wechselkursankers besteht in der Schaffung eines Korsetts für die inländische Preisniveauentwicklung sowie im Aufbau von Vertrauen in die externe Stabilität einer Währung“. Insgesamt konnten durch diesen Wechselkurskorridor sichere monetäre Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die positiven Auswirkungen dieser Maßnahmen spiegelten sich unter anderem in dem gestiegenen Vertrauen ausländischer Investoren wieder. So nahmen die Direktinvestitionen in Russland 1997 um den Faktor 2,5 gegenüber dem Vorjahr zu. Das Konzept schien aufzugehen. Die makroökonomischen Indikatoren bescheinigten der russischen Wirtschaftspolitik 1997 erste Erfolge.
Mit dem offenen Ausbruch der Währungskrise zeigten sich jedoch Mitte August 1998 die Unzulänglichkeiten des russischen Staates, der Wirtschaft und des Finanzsystems. Der Wechselkurs konnte nicht mehr verteidigt werden und der Rubel verlor innerhalb eines Monats gut 60 Prozent seines Wertes. Das fragile russische Finanzsystem erlitt den Totalkollaps.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen der Russlandkrise
- Makroökonomische Schwächen
- Auslandsverschuldung
- Staatshaushalt
- Wachstum
- Mikroökonomische Schwächen
- Russisches Bankensystem
- Russischer Unternehmenssektor
- Rohstoffpreise
- Zwischenfazit
- Makroökonomische Schwächen
- Auswirkungen der Russlandkrise
- Russland
- Die aktuelle Situation
- Industrieländer
- Russland
- Fazit und Bewertung der Russlandkrise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Ursachen und Folgen der russischen Finanzkrise im August 1998. Dabei wird untersucht, inwiefern die Krise im Sog der Asienkrise entstand oder ob interne Probleme eine größere Rolle spielten. Die Arbeit analysiert die makroökonomischen und mikroökonomischen Schwächen, die zur Krise geführt haben, sowie die Auswirkungen auf Russland und die wichtigsten Industrienationen. Abschließend erfolgt eine Bewertung der Krise und ein Blick auf die aktuelle Situation in Russland.
- Makroökonomische Ursachen der Russlandkrise
- Mikroökonomische Ursachen der Russlandkrise
- Auswirkungen der Krise auf Russland
- Auswirkungen der Krise auf die Industrieländer
- Bewertung der Krise und die aktuelle Situation in Russland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der russischen Finanzkrise ein und beschreibt den ökonomischen Zustand Russlands vor dem Ausbruch der Krise. Es wird die Politik der monetären Stabilisierung mit Hilfe fester Wechselkurse beleuchtet, die zunächst Erfolge zeigte, aber letztendlich an den strukturellen Schwächen der russischen Wirtschaft scheiterte.
Kapitel zwei beleuchtet die Ursachen der Russlandkrise und analysiert die Rolle der makroökonomischen Schwächen wie der hohen Auslandsverschuldung, dem Staatsdefizit und dem schlechten Wirtschaftswachstum. Darüber hinaus wird die Bedeutung von mikroökonomischen Problemen wie Schwächen im Bankensystem und im Unternehmenssektor sowie die Abhängigkeit von Rohstoffexporten hervorgehoben.
Kapitel drei behandelt die Auswirkungen der Russlandkrise auf Russland und die wichtigsten Industrienationen. Es werden die Folgen für die russische Wirtschaft, das Finanzsystem und die politische Stabilität analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Ursachen und Folgen der russischen Finanzkrise von 1998. Dabei werden Themen wie Makroökonomie, Mikroökonomie, Auslandsverschuldung, Staatsdefizit, Wirtschaftswachstum, Bankensystem, Unternehmenssektor, Rohstoffpreise, Schattenwirtschaft, Kapitalflucht, Monetäre Stabilisierung, Feste Wechselkurse, Asienkrise, und die aktuelle Situation in Russland behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptursachen der Russlandkrise 1998?
Die Ursachen lagen in makroökonomischen Schwächen wie hoher Auslandsverschuldung, einem defizitären Staatshaushalt und mikroökonomischen Problemen im Bankensektor.
Welche Rolle spielten die Rohstoffpreise?
Der Verfall der Öl- und Gaspreise auf dem Weltmarkt entzog dem russischen Staatshaushalt wichtige Einnahmen und beschleunigte den wirtschaftlichen Kollaps.
Wie wirkte sich die Krise auf den Rubel aus?
Der feste Wechselkurs konnte nicht mehr gehalten werden; der Rubel verlor innerhalb eines Monats rund 60 Prozent seines Wertes gegenüber dem Dollar.
Was versteht man unter der „Dollarisierung“ der russischen Wirtschaft?
Aufgrund des Misstrauens in den Rubel wurden Transaktionen zunehmend in US-Dollar abgewickelt oder Ersparnisse in Fremdwährung gehalten.
Hatte die Krise Auswirkungen auf die Industrieländer?
Ja, die Krise führte zu Verunsicherungen an den globalen Finanzmärkten und zu Verlusten bei ausländischen Investoren, die massiv in russische Staatsanleihen investiert hatten.
- Arbeit zitieren
- Tobias Pehle (Autor:in), 2001, Ursachen und Folgen der Russischen Finanz- und Währungskrise von 1998, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19298