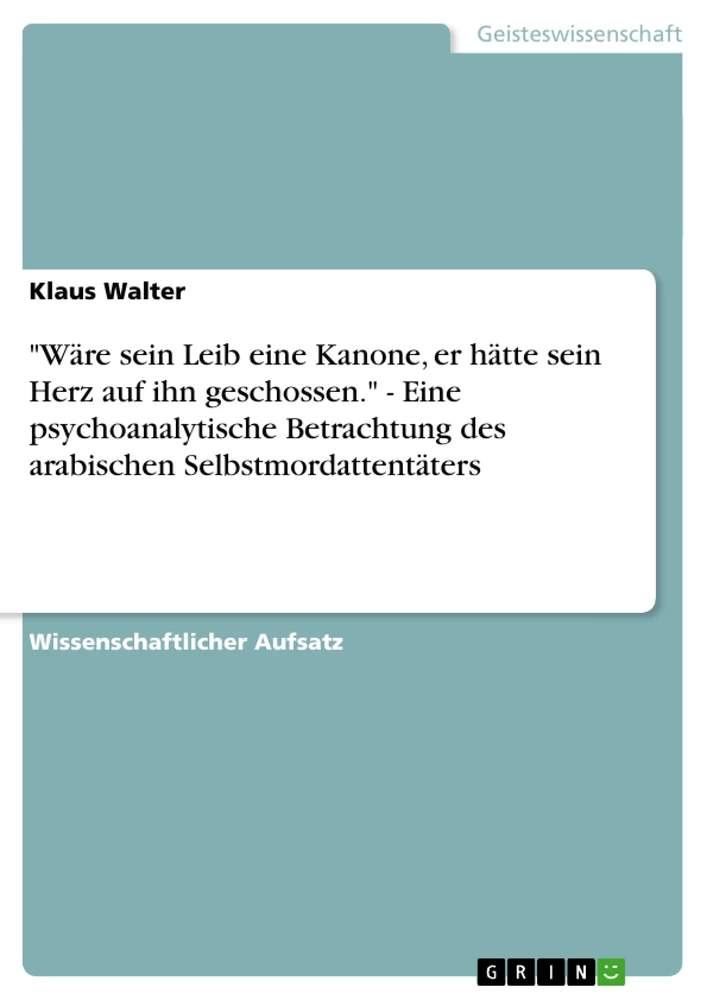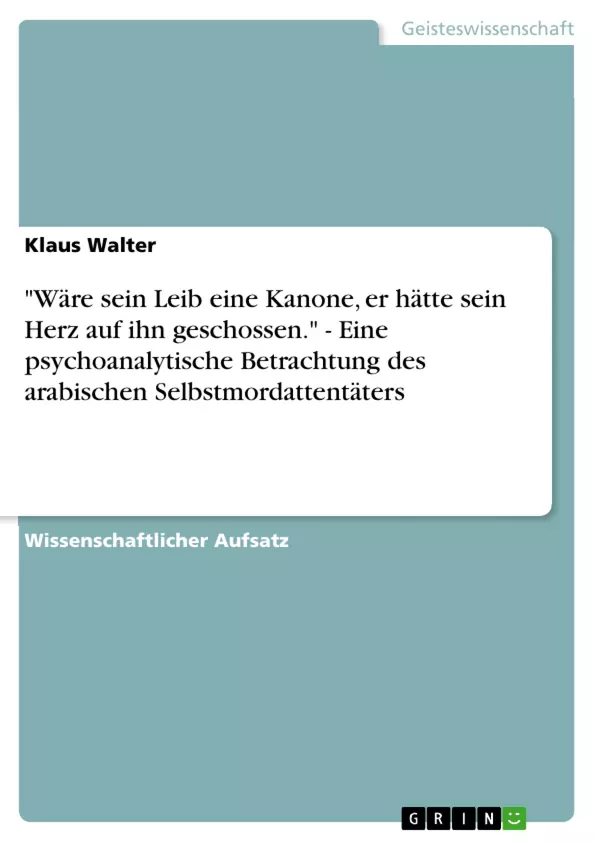Der Autor betrachtet arabische Selbstmordattentäter aus psychoanalytischer Perspektive. Er stellt das destruktive und selbstzerstörerische Handeln als narzisstischen Akt auf dem Hintergrund der Verleugnung von Sehnsucht nach Zuwendung und Nähe dar. Mit der Haltung, wie sie Mellville in seinem Roman „Moby Dick“ dem Kapitän Ahab zuschreibt, würden sie ihr Herz lieber verschießen, als sich ihm zuzuwenden und eine neuerliche Enttäuschung zu riskieren. Sie setzen die eigene körperliche Vernichtung ein, um wenigstens ihr tief verletztes und enttäuschtes Selbst auf einer grandiosen Ebene zu retten. Sie versuchen im vermeintlich heroischen Akt das narzisstisch verletzende Objekt oder besser, das von dieser Projektion getroffene Objekt in die Vernichtung zu reißen und sich darin letztlich doch noch mit ihm zu vereinigen.
Das Thema wird mit einer Diskussion von Theorien zu Aggression und Destruktivität eingeleitet, insbesondere der Aggressionstheorien zum Selbst-Erhaltung und der narzisstischen Wut. Sie bilden den Hintergrund, Suizidhandlungen als Lösungsversuche einer narzisstischen Krise zu begreifen. Aufbauend auf einer Betrachtung des arabisch-israelischen Konflikts, einem literarischem Bild der arabischen Demütigung, Kernbergs Ideen zur Massenpsychologie, Büttners Umsetzung von Bindungstheorien in Vorstellungen für den Terrorismus und Gruens psychoanalytisch fundierten Beschreibungen von Extremismusformen werden dann Ideen für den kulturellen und geschichtlichen Hintergrund des westlich-arabischen Konflikts und seiner Auswirkungen auf den Selbstmordterrorismus vorgestellt. Überlegungen zur Entwicklung der Persönlichkeit des Selbstmordattentäters und psychodynamische Erwägungen zu seiner Handlung liefern dann Erklärungsmodelle für seine Integration in die terroristische Gruppe. Dabei wird seine destruktive Handlung als Stabilisierungsversuch gegen seine chronische Enttäuschungserwartung und für sein labiles Selbst gedeutet. Doch der Autor versucht auch eine Lösungsperspektive zu entwickeln, die er aus Behandlungstechniken der modernen, am Selbst orientierten Psychoanalyse gewinnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Übersicht
- Definition des Untersuchungsgegenstandes
- Verhältnis von Aggression und Destruktivität
- Aggressionstrieb oder Selbst-Erhaltung
- Narzisstische Wut - Genese und Psychodynamik
- Frühe Entwicklung des Selbst und enttäuschende Selbstobjekte
- Narzisstische Wut als Abwehr
- Narzisstische Regulation
- Narzisstische Objektbeziehungen
- Aggression als Folge mangelnder metaphorischer Synchronisierung
- Selbstmord als Ausweg aus der narzisstischen Krise
- Der arabische Selbstmordattentäter
- Soziokultureller Hintergrund
- Der Islam
- Persönlichkeit des Selbstmordattentäters
- Sozialisation in arabischen Ländern
- Lebenssituation in arabischen Krisengebieten
- Frühkindlicher Defekt, Abwehr und Kompensation
- Mystifizierung und Indoktrination
- Ich-Ideal / Über-Ich-System
- Realitätskontrolle
- Schuldproblematik
- Beziehung zwischen Attentäter und Objekt des Attentats
- Thesen für eine Lösung
- Ableitung aus behandlungstechnischen Konsequenzen
- Kulturelle und politische Konsequenzen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die psychoanalytischen Aspekte des arabischen Selbstmordattentäters. Ziel ist es, die psychischen Mechanismen und den soziokulturellen Kontext dieser Handlung zu beleuchten, ohne dabei simplifizierende Erklärungen zu liefern. Die Arbeit vermeidet eine Reduktion auf einzelne Faktoren und betont die Multikausalität des Phänomens.
- Die Rolle narzisstischer Wut und frühkindlicher Entwicklung
- Der Einfluss soziokultureller Faktoren (Islam, Sozialisation, politische Konflikte)
- Die Bedeutung von Abwehrmechanismen und Kompensationsstrategien
- Selbstmord als Ausweg aus einer narzisstischen Krise
- Möglichkeiten der psychoanalytischen Betrachtung und deren Konsequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung vergleicht den Selbstmordattentäter mit Kapitän Ahab aus Melvilles "Moby Dick", der seine Sehnsucht nach Nähe verleugnet und seine Selbstzerstörung als grandiosen Akt der Selbstrettung inszeniert. Es wird die mediale Inszenierung von Selbstmordattentaten kritisiert, die zu regressiven Massenprozessen und der Verleugnung der eigenen Anfälligkeit führen kann.
Übersicht: Die Übersicht beschreibt den Rahmen der Arbeit. Es wird auf die Grenzen des gewählten Umfangs hingewiesen und die behandelten Themen – von Aggressionstheorien über narzisstische Wut bis hin zum arabisch-israelischen Konflikt – skizziert. Die Arbeit verbindet verschiedene theoretische Ansätze, um die komplexe Thematik zu beleuchten.
Definition des Untersuchungsgegenstandes / Verhältnis von Aggression und Destruktivität / Aggressionstrieb oder Selbst-Erhaltung / Narzisstische Wut - Genese und Psychodynamik: Diese Kapitel legen die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es wird die These eines angeborenen Aggressionstriebs verworfen und stattdessen die Bedeutung von Selbst-Erhaltungsstrategien im Kontext narzisstischer Wut hervorgehoben. Die Genese und Psychodynamik narzisstischer Wut werden im Detail untersucht, unter Einbezug von Theorien zur frühen Entwicklung des Selbst und enttäuschenden Selbstobjekten. Die narzisstische Wut wird als Abwehrmechanismus verstanden, der mit narzisstischer Regulation und Objektbeziehungen in Verbindung steht. Der Einfluss mangelnder metaphorischer Synchronisierung auf die Entstehung von Aggression wird ebenfalls thematisiert.
Selbstmord als Ausweg aus der narzisstischen Krise: Dieses Kapitel behandelt den Selbstmord als mögliche Lösung einer narzisstischen Krise. Es baut auf den vorherigen Kapiteln auf und integriert Überlegungen zur Selbstzerstörung im Kontext von narzisstischer Verletzung und dem Scheitern von Selbstregulation.
Der arabische Selbstmordattentäter (ohne Unterkapitel): Dieses Kapitel untersucht den soziokulturellen Hintergrund und die psychischen Prozesse, die zum Selbstmordattentat führen können. Es analysiert den Einfluss des Islams, die Sozialisation in arabischen Ländern, die Lebenssituation in Krisengebieten, sowie frühkindliche Defekte und Kompensationsmechanismen. Die Rolle von Mystifizierung und Indoktrination, das Ich-Ideal/Über-Ich-System, die Realitätskontrolle und die Schuldproblematik werden in ihren Auswirkungen auf das Handeln des Attentäters erörtert. Die Beziehung zwischen Attentäter und dem Objekt des Attentats wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Selbstmordattentäter, arabisch-israelischer Konflikt, Narzissmus, narzisstische Wut, Aggression, Destruktivität, Selbst-Erhaltung, frühe Entwicklung, Abwehrmechanismen, Islam, Sozialisation, Psychoanalyse, Psychodynamik, Kultur, Politik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychoanalytische Aspekte des arabischen Selbstmordattentäters
Was ist der Untersuchungsgegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die psychoanalytischen Aspekte des arabischen Selbstmordattentäters. Ziel ist es, die psychischen Mechanismen und den soziokulturellen Kontext dieser Handlung zu beleuchten, ohne dabei simplifizierende Erklärungen zu liefern. Die Multikausalität des Phänomens wird betont.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle narzisstischer Wut und frühkindlicher Entwicklung, den Einfluss soziokultureller Faktoren (Islam, Sozialisation, politische Konflikte), die Bedeutung von Abwehrmechanismen und Kompensationsstrategien, Selbstmord als Ausweg aus einer narzisstischen Krise und Möglichkeiten der psychoanalytischen Betrachtung und deren Konsequenzen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet psychoanalytische Theorien, insbesondere im Hinblick auf Narzissmus, narzisstische Wut, frühkindliche Entwicklung und Abwehrmechanismen. Es werden verschiedene theoretische Ansätze kombiniert, um die komplexe Thematik zu beleuchten. Die These eines angeborenen Aggressionstriebs wird verworfen; stattdessen wird die Bedeutung von Selbst-Erhaltungsstrategien hervorgehoben.
Wie wird der Selbstmordattentat im Kontext narzisstischer Wut betrachtet?
Der Selbstmordattentat wird als mögliche Lösung einer narzisstischen Krise verstanden, die durch frühkindliche Entwicklungsstörungen, enttäuschende Selbstobjekte und mangelnde metaphorische Synchronisierung entstehen kann. Narzisstische Wut wird als Abwehrmechanismus gesehen, der mit narzisstischer Regulation und Objektbeziehungen in Verbindung steht.
Welche soziokulturellen Faktoren werden berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert den Einfluss des Islams, die Sozialisation in arabischen Ländern, die Lebenssituation in Krisengebieten, Mystifizierung und Indoktrination, das Ich-Ideal/Über-Ich-System, Realitätskontrolle und die Schuldproblematik auf das Handeln des Attentäters. Die Beziehung zwischen Attentäter und dem Objekt des Attentats wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den behandelten psychoanalytischen und soziokulturellen Aspekten, um mögliche Lösungsansätze sowohl auf behandlungstechnischer als auch auf kultureller und politischer Ebene zu diskutieren. Es wird eine multikausale Perspektive eingenommen und eine Vereinfachung des komplexen Phänomens vermieden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstmordattentäter, arabisch-israelischer Konflikt, Narzissmus, narzisstische Wut, Aggression, Destruktivität, Selbst-Erhaltung, frühe Entwicklung, Abwehrmechanismen, Islam, Sozialisation, Psychoanalyse, Psychodynamik, Kultur, Politik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung und einer Übersicht, gefolgt von Kapiteln zur Definition des Untersuchungsgegenstandes, Aggressionstheorien, narzisstischer Wut, Selbstmord als Ausweg aus der narzisstischen Krise und einer detaillierten Analyse des arabischen Selbstmordattentäters. Sie schließt mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.
- Quote paper
- Klaus Walter (Author), 2003, "Wäre sein Leib eine Kanone, er hätte sein Herz auf ihn geschossen." - Eine psychoanalytische Betrachtung des arabischen Selbstmordattentäters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19307