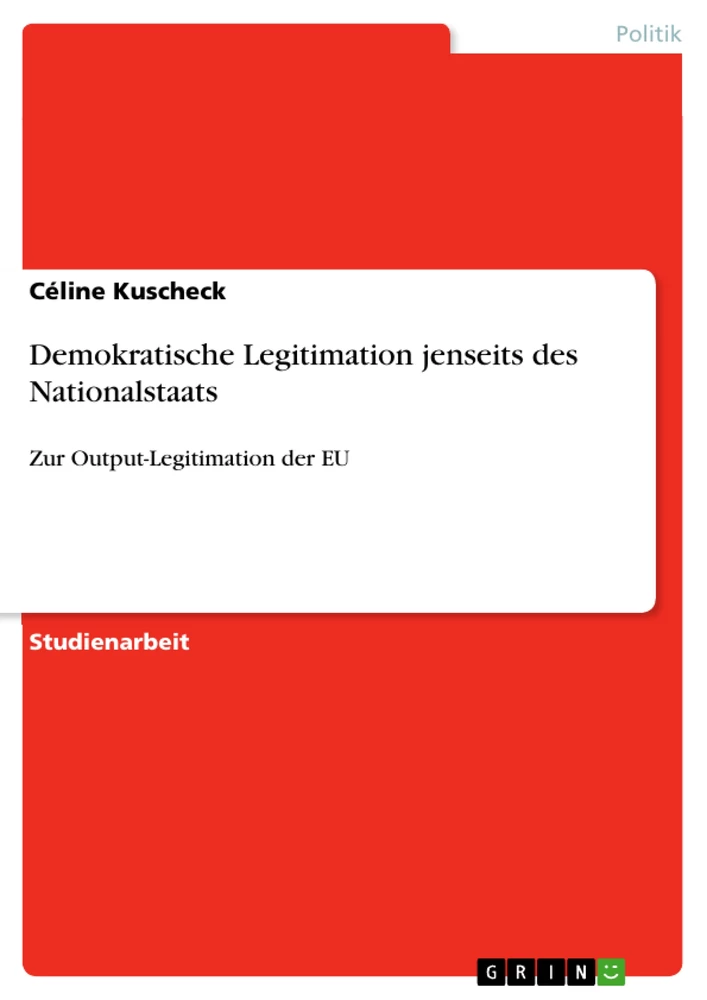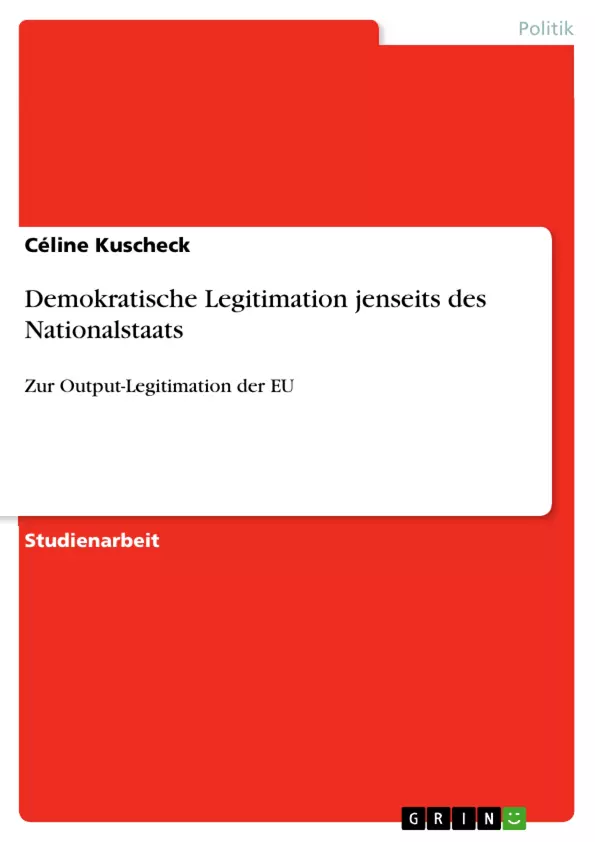Die Europäische Staatengemeinschaft1 stellt Moravcsik zufolge das bisher anspruchsvollste Unternehmen dar, Souveränität unter dem Dach einer supranationalen Institution zu bündeln (Moravcsik 2004: 336f.). War man sich in den 50-er Jahren noch darüber einig, dass die heutige EU in erster Linie als Kind der Krise vor dem Hintergrund einer Friedensidee entstanden ist, so zeigt sich seit den 90-er Jahren verstärkt der Gedanke der Wohlstandsmehrung als Motivation einer fortschreitenden Integration. Für die europäischen Wohlfahrts- und Sozialstaaten entstand als Konsequenz dessen und unter den Bedingungen einer wirtschaftlichen Globalisierung immer stärkerer Druck den an sie herangetragenen Anforderungen gerecht zu werden.
Zur Beibehaltung ihrer Handlungsfähigkeit gaben die Mitgliedstaaten nach und nach Teile ihrer Souveränität an die Europäische Staatengemeinschaft ab. Damit gelang über die Jahre hinweg zwar die wirtschaftliche und rechtliche Integration, die politische jedoch kam nur langsam voran. Obwohl die Diskussion über die Legitimation der Europäischen Union lange nicht wichtig erschien, treten im Rahmen politikwissenschaftlicher Betrachtungen seit langem immer mehr Überlegungen zutage, wie regieren jenseits des Nationalstaats – speziell auf der europäischen Ebene – demokratisch legitimiert werden kann.
Mittlerweile scheint sich die Debatte jedoch „totzulaufen und droht in allgemeiner Resignation zu versanden, weil die verschiedenen Versuche, eine Lösung des Problems zu finden, an immer dieselben theoretischen Grenzen stoßen“ (Abromeit 2002: 9). Gehen wir jetzt davon aus, dass die Europäische Union nach derzeitigem Forschungsstand nicht den Maßgaben der Input-Legitimation (Scharpf 1970, 1999, 2004) genügt, wird angenommen, dass die einzig mögliche Legitimationsquelle die ihrer Output-Legitimation (Scharpf 1970, 1999, 2004) ist (Höreth 1999: 251).
Durch diese Überlegungen angeregt möchte die vorliegende Arbeit der Frage „Kann die Output-Legitimation der Europäischen Union ihre Legitimation herstellen?“ systematisch nachgehen. Ziel der Arbeit ist es, mithilfe der Kriterien der In- und Output-Legitimation (Scharpf 1970, 1999, 2004) das Ausmaß demokratischer Legitimation der EU zu beurteilen.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einführung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- 2.1 Konzept A
- 2.2 Konzept B
- Kapitel 3: Empirische Untersuchung
- 3.1 Methodik
- 3.2 Ergebnisse
- 3.3 Diskussion
- Kapitel 4: Fallstudie X
- Kapitel 5: Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, [eingefügte Beschreibung der Ziele der Arbeit]. Die Arbeit untersucht dabei insbesondere folgende Themen:
- Thema 1: [eingefügtes Thema 1]
- Thema 2: [eingefügtes Thema 2]
- Thema 3: [eingefügtes Thema 3]
- Thema 4: [eingefügtes Thema 4]
- Thema 5: [eingefügtes Thema 5]
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Forschungsfrage. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen kurzen Überblick über die verwendeten Methoden und die erwarteten Ergebnisse. Die Einführung dient als Orientierungshilfe für den Leser und fasst die wichtigsten Aspekte der gesamten Arbeit zusammen, um einen kontextuellen Rahmen zu schaffen.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es präsentiert und diskutiert relevante Theorien und Konzepte, die für das Verständnis der empirischen Untersuchung im darauffolgenden Kapitel unerlässlich sind. Die Diskussion der verschiedenen Konzepte und Theorien wird differenziert und vertieft dargestellt, wobei ihre Stärken und Schwächen kritisch hinterfragt werden. Die Auswahl der Theorien und Konzepte begründet sich in ihrem Bezug zum Hauptforschungsinteresse und ihrer Eignung zur Beantwortung der Forschungsfrage.
Kapitel 3: Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die durchgeführt wurde, um die Forschungsfragen zu beantworten. Es wird detailliert auf die Methodik eingegangen, inklusive der Datenerhebung und -analyse. Die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert und interpretiert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der präzisen Darstellung der Daten, der Vermeidung von Missinterpretationen und der kritischen Reflexion der angewendeten Methode. Die Limitationen der Untersuchung werden offen und transparent diskutiert.
Kapitel 4: Fallstudie X: Kapitel 4 präsentiert eine detaillierte Fallstudie, die die theoretischen Konzepte und empirischen Ergebnisse veranschaulicht und vertieft. Die Fallstudie dient zur Illustration der komplexen Zusammenhänge und bietet eine detaillierte Analyse eines konkreten Beispiels. Durch die Betrachtung des konkreten Falls wird ein besseres Verständnis der theoretischen und empirischen Ergebnisse erreicht und die praktische Relevanz der Untersuchung verdeutlicht. Die Ergebnisse der Fallstudie werden sorgfältig mit den vorherigen Kapiteln verknüpft und im Kontext der Gesamtargumentation diskutiert.
Schlüsselwörter
Einführung, theoretische Grundlagen, empirische Untersuchung, [eingefügte Schlüsselwörter], Fallstudie, [eingefügte Schlüsselwörter], Ausblick, [eingefügte Schlüsselwörter].
Häufig gestellte Fragen zur vorliegenden Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über ein Forschungsprojekt. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Darstellung der Thematik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen), Kapitel 3 (Empirische Untersuchung), Kapitel 4 (Fallstudie X) und Kapitel 5 (Ausblick). Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit wird im Abschnitt "Zielsetzung und Themenschwerpunkte" dargelegt. Sie beschreibt das übergeordnete Forschungsziel und die spezifischen Themen, die im Rahmen der Arbeit untersucht werden. Die konkreten Ziele sind [eingefügte Beschreibung der Ziele der Arbeit].
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themenschwerpunkte: [eingefügtes Thema 1], [eingefügtes Thema 2], [eingefügtes Thema 3], [eingefügtes Thema 4] und [eingefügtes Thema 5]. Diese Themen werden in den einzelnen Kapiteln detailliert behandelt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einer logischen Struktur. Sie beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Forschungsfrage einführt. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen erläutert, bevor die empirische Untersuchung und eine detaillierte Fallstudie präsentiert werden. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Einführung, theoretische Grundlagen, empirische Untersuchung, [eingefügte Schlüsselwörter], Fallstudie, [eingefügte Schlüsselwörter], Ausblick, [eingefügte Schlüsselwörter]. Diese Begriffe repräsentieren die zentralen Konzepte und Themen der Arbeit.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Es wird jeweils der Fokus und die wichtigsten Punkte des jeweiligen Kapitels beschrieben. Diese Zusammenfassungen dienen als Orientierungshilfe für den Leser.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die verwendeten Methoden werden im Kapitel "Empirische Untersuchung" detailliert beschrieben. Es wird auf die Methodik der Datenerhebung und -analyse eingegangen. Die Auswahl der Methoden wird begründet und ihre Limitationen werden offen diskutiert.
- Arbeit zitieren
- B.A. Céline Kuscheck (Autor:in), 2012, Demokratische Legitimation jenseits des Nationalstaats, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193216