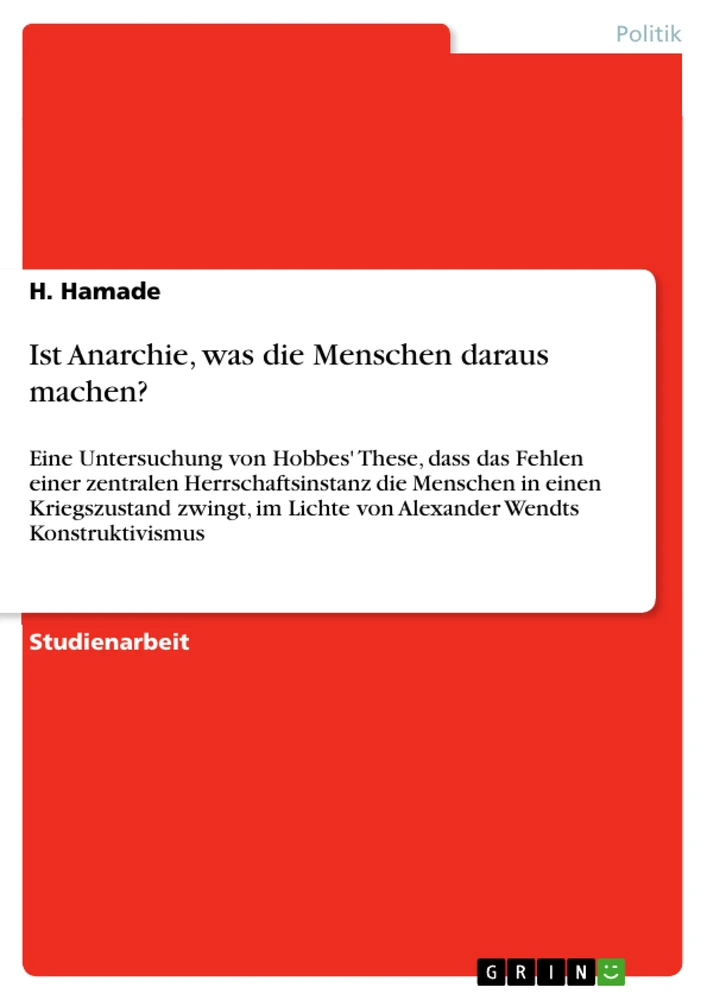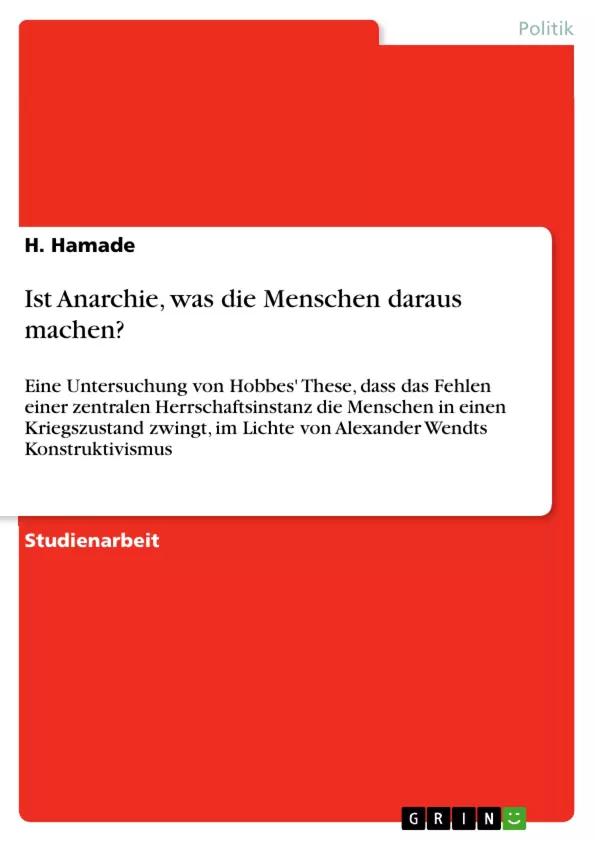Hobbes' These, dass aus dem Fehlen einer zentralen Herrschaftsinstanz notwendig der Kriegszustand unter den Menschen folgt, wird mit Hilfe von Alexander Wendts Konstruktivismus untersucht. Dessen Argumentation bezieht sich auf eine ähnliche These der "neorealistischen Schule" innerhalb der Theorien der Internationalen Beziehungen, nach der die Staatenwelt ohne Hegemon in einen Kriegszustand verfällt. Um Wendts Argumentation der Fragestellung anzupassen wird zum einen Hobbes' Theorie vorgestellt, um dann die – sich auf Hobbes stützende - neorealistische Denkschule vorzustellen. Anschließend werden Probleme der Vergleichbarkeit der Staatengemeinschaft mit der Gemeinschaft von Individuen diskutiert. Wendts Argumentation stützt sich vor allem darauf, dass Identitäten und Interessen der Akteure nicht objektiv und unveränderlich gegeben, sondern sozial konstruiert sind, dass darum ein hobbes'scher Kriegszustand zwar eintreten kann, aber nicht muss. Resultat der Arbeit ist, dass Wendt sich zwar nur mit Einschränkungen auf Hobbes anwenden lässt, insgesamt seine Argumentation aber doch erklärungskräftiger und überzeugender ist, als die von Hobbes.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Hobbes und der kriegerische Naturzustand
- 2.1 Thomas Hobbes
- 2.2 Der Krieg aller gegen alle
- 3. Alexander Wendts Konstruktivismus
- 3.1 Der Entstehungskontext des Wendtschen Konstruktivismus
- 3.2 Das Problem des Analogieschlusses Individuum - Staat
- 3.3 Wendts konstruktivistischer Lösungsansatz
- 4. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die These von Thomas Hobbes, dass das Fehlen einer zentralen Herrschaftsinstanz die Menschen in einen Kriegszustand zwingt, im Lichte des konstruktivistischen Ansatzes von Alexander Wendt. Dabei werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Naturzustand von Hobbes und dem internationalen System, das Wendt analysiert, herausgearbeitet. Die Arbeit stellt die Frage, ob und inwiefern Wendts Konstruktivismus eine Alternative zu Hobbes' pessimistischer Sicht auf die menschliche Natur bietet.
- Hobbes' Theorie des Naturzustands und seine These vom Krieg aller gegen alle
- Wendts konstruktivistischer Ansatz und seine Kritik am Realismus
- Die Anwendbarkeit von Wendts Konstruktivismus auf Hobbes' Theorie
- Die Rolle von Normen und Identitäten in der internationalen Politik
- Die Frage nach der Möglichkeit einer friedlichen Weltordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung und stellt die Ausgangsthese der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Problematik des Naturzustands und den Zusammenhang zwischen dem Fehlen einer zentralen Herrschaftsinstanz und der Entstehung von Konflikten. Kapitel 2 beschäftigt sich mit Thomas Hobbes und seiner Theorie des Naturzustands. Es werden die Lebensumstände Hobbes, seine methodischen Ansätze sowie seine zentralen Argumentationslinien erläutert. Kapitel 3 untersucht den konstruktivistischen Ansatz von Alexander Wendt. Es werden der Entstehungskontext von Wendts Theorie, seine Kritik an Hobbes' Analogieschluss und sein konstruktivistischer Lösungsansatz dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Kernbegriffe des Naturzustands, der menschlichen Natur, der Anarchie, des Konstruktivismus, der Normen, der Identitäten und der internationalen Politik. Sie befasst sich mit zentralen Theorien von Thomas Hobbes und Alexander Wendt, die in den Bereichen der politischen Philosophie und der Internationalen Beziehungen einflussreiche Beiträge geleistet haben. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob die anarchische Struktur des internationalen Systems, die auf das Fehlen einer zentralen Herrschaftsinstanz zurückzuführen ist, zwangsläufig zu Konflikten führt. Sie diskutiert die Rolle von Normen und Identitäten in der internationalen Politik und hinterfragt die traditionelle Sichtweise auf den Naturzustand.
- Citation du texte
- H. Hamade (Auteur), 2012, Ist Anarchie, was die Menschen daraus machen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193551