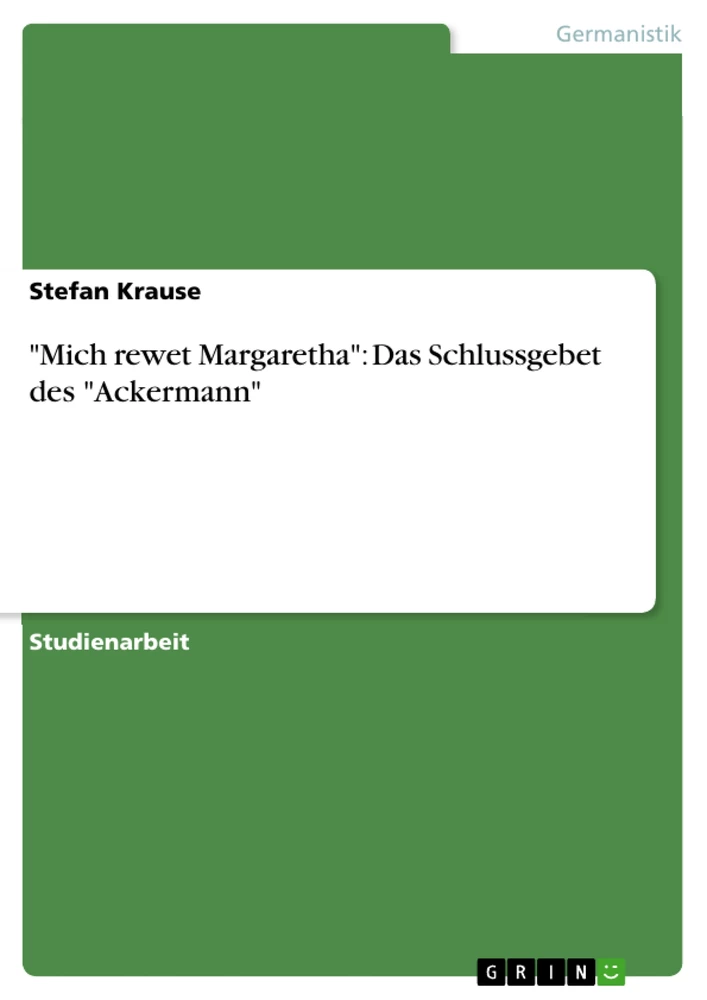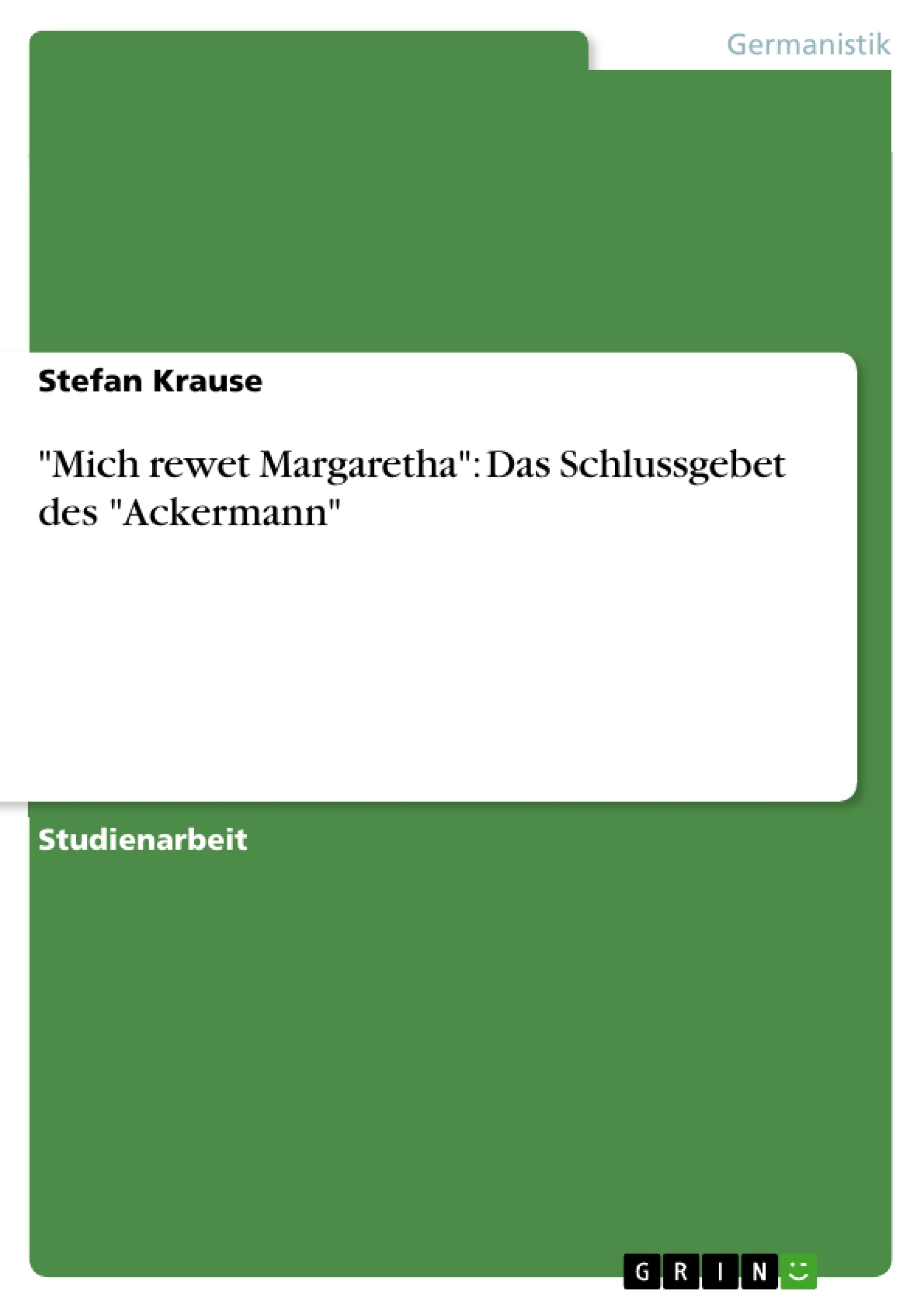„Darvmb clager, hab ere, Tot, syge!“, so lautet das ausgleichende Urteil Gottes, mit dem er dem Streitgespräch ein Ende setzt. Über 32 Kapitel hinweg hat der Kläger, den der Leser bisher nur als „ackerman“ kennen gelernt hat, seinen Widersacher wegen des Dahinscheidens seiner geliebten Frau angegriffen, während sein Gegner, der Tod selbst, jede Schuld von sich wies. Es erscheint nur konsequent, dass nun, nach dem Urteil der höchsten Macht, der Ackermann, der den Disput begann, abschließend eine Möglichkeit zu einer Reaktion erhält. Es ist kein Widerspruch, den der bisher so entschieden argumentierende Witwer äußert, sondern ein Gebet für die Verblichene. So endet das schmale Werk des Johannes von Tepl, „diese[s] eigenartige[…] und einzigartige[…] Werk“, das im Laufe der Zeit und bis in die Gegenwart eine geradezu verblüffend umfangreiche und vielseitige Rezeption und Erforschung erfahren hat.
Diese Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, jenes besondere 34. Kapitel, das Schlussgebet, welches Kiening das „von der Forschung bisher am stärksten vernachlässigte[…] Stück[…] der ‚Ackermann’-Prosa“ genannt hat, einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, um es in seiner Bedeutung für das Gesamtwerk besser einschätzen und würdigen zu können. Dabei sollen Fragen der Überlieferung ebenso Beachtung finden wie die formale und inhaltliche Gestaltung und letztlich die Einordnung in das Gesamtwerk.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anmerkungen zur Textüberlieferung
- Aufbau und Inhalt
- Die Überschrift
- Das Akrostichon
- Überlieferungsprobleme und Unklarheiten: Das Akrostichon in A und in anderen Textzeugen
- Das Akrostichon als Gliederungsmittel: Die zehngliedrige Struktur nach Bertau
- Die Gottesinvokationen
- Die Gottesinvokationen als, Absolutive'?
- Inhaltliche Strukturierung?
- Religiöse Aspekte und die Schwierigkeiten der Interpretation
- Exkurs: Quellen und Zitate
- Quellentheorien
- Johannes von Tepl und Johann von Neumarkt
- Das Schlussgebet im Gesamttext
- Wiederaufnahmen
- Das Gebet als Höhepunkt und Abschluss
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem 34. Kapitel des „Ackermann“, dem Schlussgebet, das von der Forschung bisher eher vernachlässigt wurde. Ziel ist es, dieses Kapitel eingehend zu untersuchen, um seine Bedeutung für das Gesamtwerk besser einschätzen zu können. Dabei werden Fragen der Überlieferung, der formalen und inhaltlichen Gestaltung und die Einordnung des Schlussgebets in das Gesamtwerk beleuchtet.
- Die Bedeutung des Schlussgebets für das Gesamtwerk des „Ackermann“
- Die Überlieferung des Schlussgebets und die Herausforderungen der Textkritik
- Die formale und inhaltliche Gestaltung des Schlussgebets
- Die Einordnung des Schlussgebets in das Gesamtwerk und seine Verbindung zu anderen Kapiteln
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Schlussgebets als Reaktion des Ackermanns auf das Urteil Gottes im Streitgespräch mit dem Tod. Es stellt die Zielsetzung der Arbeit dar, das 34. Kapitel eingehend zu analysieren und seine Rolle im Gesamtwerk des „Ackermann“ zu untersuchen.
- Anmerkungen zur Textüberlieferung: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen, die mit der Textüberlieferung des „Ackermann“ einhergehen, da keine autorisierte Fassung existiert und verschiedene Handschriften und Ausgaben unterschiedliche Versionen des Textes bieten. Es werden die wichtigsten Überlieferungslinien und die Herausforderungen der Textkritik erläutert.
- Aufbau und Inhalt: Dieses Kapitel untersucht die Struktur und den Inhalt des „Ackermann“, insbesondere die Überschrift, das Akrostichon, die Gottesinvokationen und die religiösen Aspekte des Werkes.
- Exkurs: Quellen und Zitate: Das Kapitel untersucht die Quellen und Zitate im „Ackermann“, beleuchtet die Quellentheorien und analysiert den Einfluss von Johannes von Neumarkt auf das Werk.
- Das Schlussgebet im Gesamttext: Dieses Kapitel analysiert das Schlussgebet als Höhepunkt und Abschluss des „Ackermann“ und untersucht die Wiederaufnahmen aus früheren Kapiteln, die den Abschluss des Werkes bilden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Schlussgebet im „Ackermann aus Böhmen“, einem Werk des Johannes von Tepl. Schwerpunkte sind die Textüberlieferung, die formale und inhaltliche Gestaltung des Schlussgebets sowie dessen Einordnung in das Gesamtwerk. Besondere Beachtung finden dabei die Gottesinvokationen, das Akrostichon, die religiösen Aspekte des Werkes und die Verbindungen zu anderen Kapiteln.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im 34. Kapitel des „Ackermann aus Böhmen“?
Es handelt sich um das Schlussgebet des Ackermanns, das als Reaktion auf das göttliche Urteil im Streitgespräch mit dem Tod fungiert.
Wer ist der Verfasser des Werkes?
Das Werk wurde von Johannes von Tepl (auch Johannes von Saaz) verfasst.
Welche Rolle spielt das Akrostichon im Schlussgebet?
Das Akrostichon dient als Gliederungsmittel und ist ein zentrales Element der formalen Gestaltung des Textes, das jedoch Überlieferungsprobleme aufweist.
Was sind „Gottesinvokationen“ im Kontext dieser Arbeit?
Dies sind feierliche Anrufungen Gottes, die die inhaltliche und religiöse Struktur des Gebets prägen.
Warum ist die Textüberlieferung des „Ackermann“ problematisch?
Es existiert keine autorisierte Fassung des Autors; der Text ist in verschiedenen Handschriften mit unterschiedlichen Varianten überliefert.
- Citation du texte
- M. A. Stefan Krause (Auteur), 2009, "Mich rewet Margaretha": Das Schlussgebet des "Ackermann", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193558