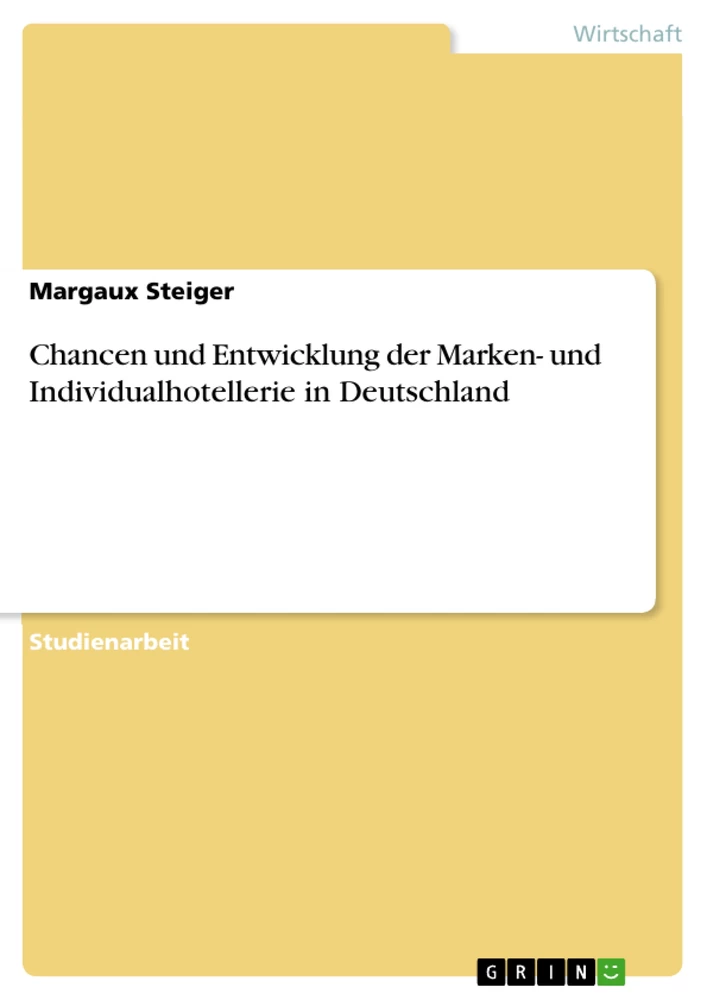„(...) Der kleine europäische Hotelier muss lernen, mit den großen, internationalen Hotelketten zusammenzuarbeiten, denn sonst kann er unter den verschärften Wettbewerbsbedingungen des Gemeinsamen Marktes nicht überleben.“ so heißt es in einer Studie der Choice Hotels International. Dieses Zitat spiegelt, obwohl schon in den 1990er Jahren veröffentlicht, auch noch heute die Situation auf dem Deutschen Hotelmarkt wieder.
Die Markenhotellerie gewinnt an Bedeutung, vergrößert ihr Produktportfolio, drängt sich in Bereiche, die bisher Steckenpferd für die Individualhotellerie waren. Diese kämpft um ihr Überleben und vor allem mit der Nachfolgeproblematik. Insgesamt ist der Deutsche Hotelmarkt mit 256.092 Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und einem Investitionsvolumen von 10,4 Mrd. Euro ein starkes Stück Wirtschaft.
In dieser Arbeit geht es nun darum, den deutschen Hotelmarkt unter dem Gliederungspunkt des Konzentrationsgrades in Marken- und Individualhotellerie zu systematisieren. Beide Formen werden definiert und Ihre Entwicklung dargestellt. Aus den prognostizierten Megatrends verschiedener Institute sollen schließlich Chancen und zukünftige Entwicklungstendenzen für die Markenhotellerie einerseits und die Individualhotellerie andererseits abgeleitet werden.
Ziel dieser Abhandlung soll eine differenzierte Betrachtung dieser beiden Konzeptionsformen von Hotels liefern, bei der aus Vor- und Nachteilen und der bisherigen Entwicklung ein Zukunftsbild gezeichnet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Markenhotellerie
- Begriffsklärung und Entstehung
- Vor- und Nachteile
- Individualhotellerie
- Begriffsklärung und Entstehung
- Vor- und Nachteile
- Markenhotellerie
- Entwicklungstendenzen in der Hotellerie
- Aktuelle Situation auf dem Deutschen Hotelmarkt
- Entwicklungen in der Markenhotellerie
- Megatrends
- Chancen der Marken- und Individualhotellerie
- Fazit
- Literatur- und Internetquellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den deutschen Hotelmarkt hinsichtlich des Konzentrationsgrades in Marken- und Individualhotellerie. Ziel ist eine differenzierte Betrachtung beider Konzepte, unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile sowie ihrer bisherigen Entwicklung, um ein Zukunftsbild zu zeichnen. Die Arbeit definiert beide Hotelformen, beschreibt ihre Entwicklung und leitet aus prognostizierten Megatrends Chancen und zukünftige Entwicklungstendenzen ab.
- Definition und Entwicklung der Markenhotellerie in Deutschland
- Definition und Entwicklung der Individualhotellerie in Deutschland
- Aktuelle Situation des deutschen Hotelmarktes
- Megatrends und ihre Auswirkungen auf die Hotellerie
- Chancen und zukünftige Entwicklungstendenzen für beide Hotelformen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Bedeutung der Markenhotellerie auf dem deutschen Hotelmarkt und deren Einfluss auf die Individualhotellerie. Sie hebt die Herausforderungen für kleine, europäische Hotels im Wettbewerb mit internationalen Ketten hervor und benennt das Ziel der Arbeit: eine systematische Betrachtung der Marken- und Individualhotellerie unter Berücksichtigung von Entwicklung, Vor- und Nachteilen, sowie zukünftiger Trends. Die Bedeutung des deutschen Hotelmarktes als Wirtschaftsfaktor wird ebenfalls hervorgehoben.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Marken- und Individualhotellerie. Es beleuchtet die Entstehung und Begriffsbestimmung beider Konzepte. Der Ursprung der Hotelketten wird in den USA verortet, mit Elsworth M. Statler und Conrad Hilton als Wegbereitern. Der Unterschied in der Etablierung von Hotelketten in den USA im Vergleich zu Deutschland wird anhand von Faktoren wie Größe des Marktes und Informationsmöglichkeiten erläutert. Der Begriff Markenhotellerie wird als Oberbegriff für Hotelketten und Kooperationen definiert, die mindestens vier Hotels umfassen, von denen sich mindestens eines in Deutschland befindet.
Schlüsselwörter
Markenhotellerie, Individualhotellerie, Deutscher Hotelmarkt, Hotelketten, Konzentrationsgrad, Entwicklungstendenzen, Megatrends, Wettbewerbsbedingungen, Nachfolgeproblematik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des deutschen Hotelmarktes hinsichtlich Marken- und Individualhotellerie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den deutschen Hotelmarkt, insbesondere den Konzentrationsgrad in der Marken- und Individualhotellerie. Sie vergleicht beide Konzepte, untersucht ihre Vor- und Nachteile, betrachtet ihre Entwicklung und zeichnet ein Zukunftsbild.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Entwicklung von Marken- und Individualhotellerie in Deutschland, die aktuelle Situation des deutschen Hotelmarktes, die Auswirkungen von Megatrends auf die Hotellerie und die Chancen sowie zukünftigen Entwicklungstendenzen für beide Hotelformen. Die theoretischen Grundlagen werden anhand der Entstehung und Begriffsbestimmung beider Konzepte erläutert, inklusive der Betrachtung von Vor- und Nachteilen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil (Marken- und Individualhotellerie), einen Abschnitt zu Entwicklungstendenzen (inkl. aktueller Marktlage und Megatrends), einen Abschnitt zu Chancen beider Hotelformen, ein Fazit, sowie Literatur- und Internetquellenverzeichnis und einen Anhang.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist eine differenzierte Betrachtung von Marken- und Individualhotellerie. Die Arbeit soll die Entwicklung beider Konzepte beschreiben und auf Basis prognostizierter Megatrends Chancen und zukünftige Entwicklungstendenzen ableiten.
Wie werden Marken- und Individualhotellerie definiert?
Markenhotellerie wird als Oberbegriff für Hotelketten und Kooperationen definiert, die mindestens vier Hotels umfassen, von denen sich mindestens eines in Deutschland befindet. Die Arbeit erläutert detailliert die Unterschiede und die Entstehung beider Hotelformen und vergleicht deren Etablierung in den USA mit der in Deutschland.
Welche Rolle spielen Megatrends?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Megatrends auf die Hotellerie und leitet daraus Chancen und zukünftige Entwicklungstendenzen für Marken- und Individualhotellerie ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Markenhotellerie, Individualhotellerie, Deutscher Hotelmarkt, Hotelketten, Konzentrationsgrad, Entwicklungstendenzen, Megatrends, Wettbewerbsbedingungen, Nachfolgeproblematik.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit enthält ein ausführliches Literatur- und Internetquellenverzeichnis.
- Quote paper
- Margaux Steiger (Author), 2012, Chancen und Entwicklung der Marken- und Individualhotellerie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193564