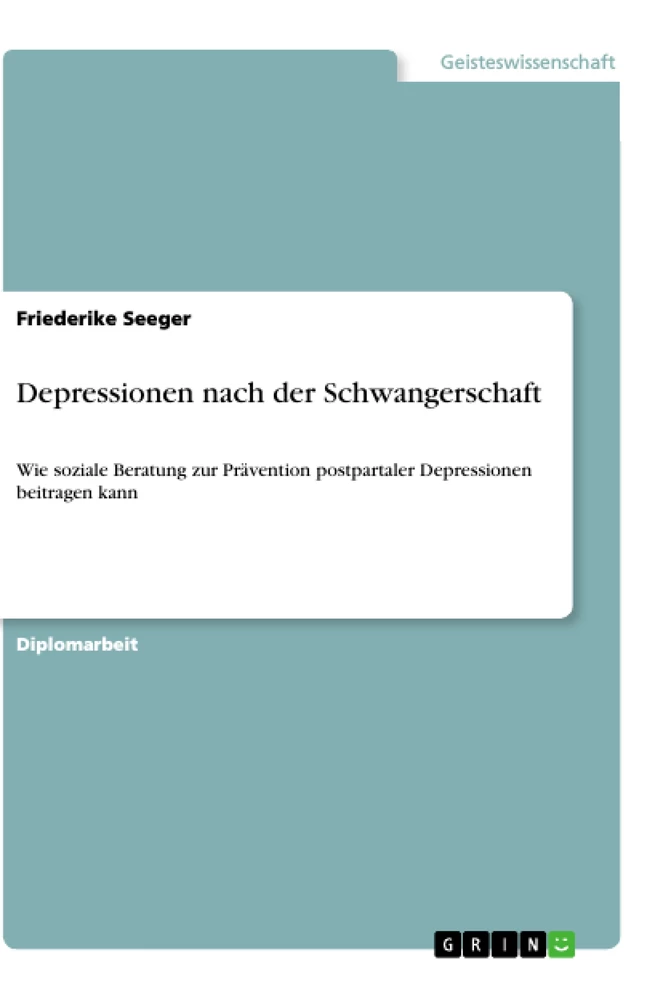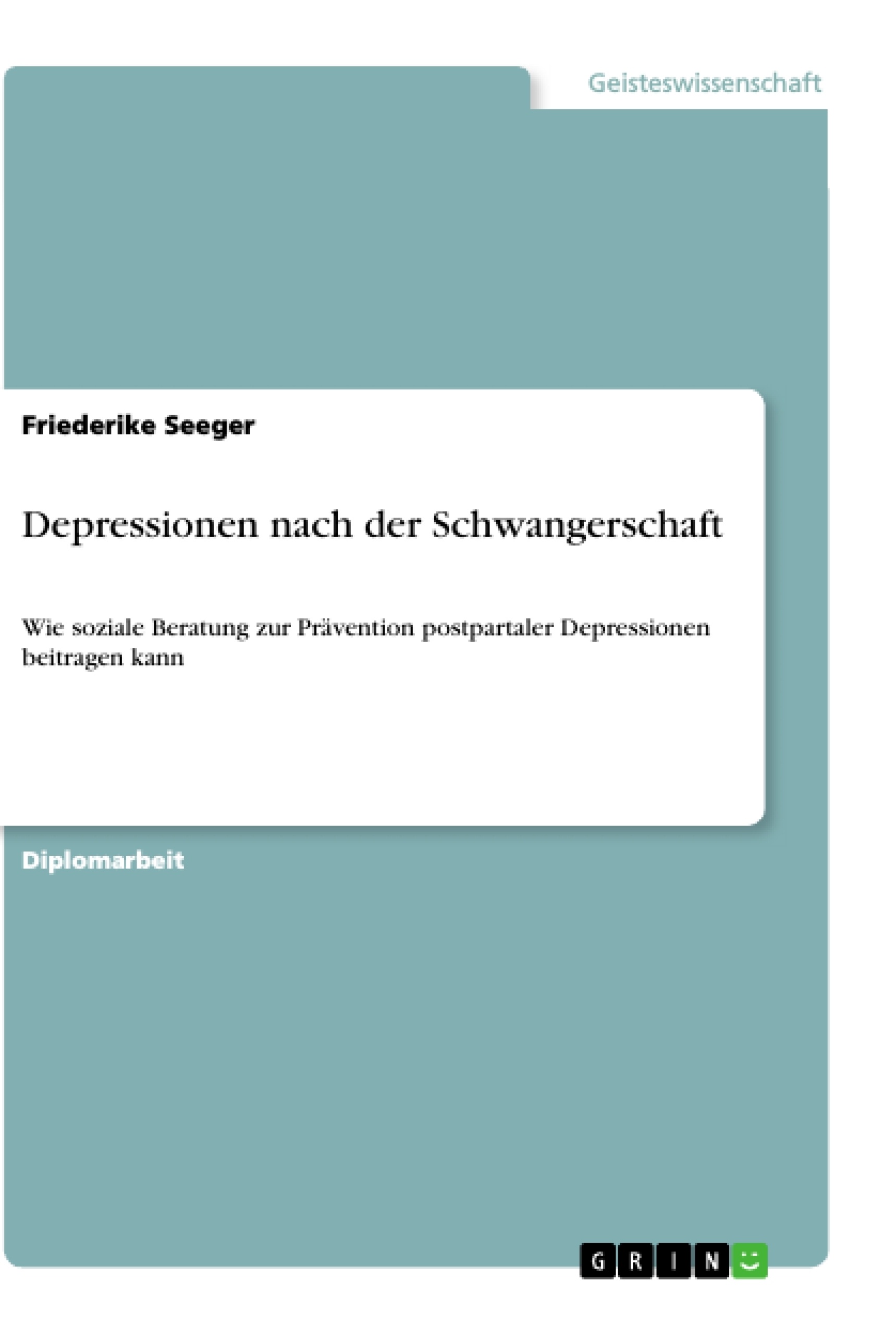Zusammenfassung
Postpartale Depressionen (PPD) sind heute die häufigsten psychischen Erkrankungen von Frauen nach der Geburt. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welchen Beitrag die Soziale Arbeit zur Prävention dieser Erkrankung leisten kann. Ziel ist es, die Grundlage für ein Beratungskonzept zu legen, das in die Praxis der Sozialen Arbeit integriert werden kann. Es sollen praktische Empfehlungen für die strukturelle, inhaltliche und methodische
Gestaltung einer sozialen Beratung erarbeitet werden. Im Mittelpunkt der theoretischen Überlegungen steht die Frage, welche Relevanz das Konstrukt des Kohärenzgefühls für die Prävention postpartaler Depressionen hat.
Die Arbeit zeigt zunächst auf, dass das Konstrukt des Kohärenzgefühls ein differenziertes Verständnis von Gesundheit in der Beratung ermöglicht. Die Betrachtung von Risiko- und Protektivfaktoren für die Entstehung einer PPD kann zu einer stärkeren Ressourcenorientierung in der Beratung beitragen. Es wird erörtert, dass eine sozialökologische Orientierung, die an den Ursachen von Problemen ansetzt und auch komplexere Problemlagen
in den Blick nimmt, den dafür notwendigen Rahmen bietet.
Die Betrachtung der strukturellen Rahmenbedingungen eines Wiener Modellprojekts zeigt, dass durch die Implementation des Beratungsangebots im Klinikkontext die notwendige
Niedrigschwelligkeit erreicht wird. Auf inhaltlicher Ebene werden vier Beratungsschwerpunkte identifiziert: Soziale Unterstützung, Partnerschaft, Auseinandersetzung mit den Veränderungen durch das Elternwerden sowie mit der Gefühlswelt. In Anlehnung an das Life Model der Sozialen Arbeit (Germain/Gitterman 1999) werden schließlich
Methoden vorgestellt, die für die Arbeit mit den drei Komponenten des Kohärenzgefühls Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit hilfreich sind.
Die Arbeit gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die Förderung der Eigenständigkeit und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten wesentliche Ziele in der präventiven Beratung
sein müssen. Offensivere methodische Elemente erscheinen angesichts der enormen Umstellungen und Neuorientierungen während einer Schwangerschaft angebracht. Die Arbeit mit dem Kohärenzgefühl in der sozialen Beratung kann eine Klientin auf den Umgang mit dem Übergang zur Elternschaft vorbereiten, indem es auch eine langfristige Perspektive bei der Bewältigung der kritischen Lebensphase eröffnet. Das Konstrukt kann somit äußerst hilfreich bei der Prävention postpartaler Depressionen sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Das Konstrukt des Kohärenzgefühls in der Salutogenese
- 2.1 Das Konstrukt des Kohärenzgefühls
- 2.1.1 Komponenten des Kohärenzgefühls
- 2.1.2 Umgang mit Stressoren durch Widerstandsressourcen
- 2.1.3 Entwicklung und Veränderung des Kohärenzgefühls
- 2.2 Einfluss des Kohärenzgefühls auf Gesundheit und Stand der Forschung
- 3.0 Schwangerschaft und postpartale Depression
- 3.1 Übergang zur Elternschaft als kritisches Lebensereignis
- 3.2 Postpartale Depression
- 3.2.1 Symptomatik
- 3.2.2 Ursachen und Risikofaktoren
- 3.2.3 Protektivfaktoren / Gesundheitserhaltende Ressourcen
- 3.3 Präventionsmöglichkeiten
- 3.3.1 Interventionen bei postpartaler Depression
- 3.3.2 Beratung als zentrale präventive Maßnahme
- 4.0 Soziale Beratung von schwangeren Frauen
- 4.1 Angebot von Schwangerenberatungsstellen
- 4.2 Soziale Beratung
- 4.2.1 Konzepte der sozialen Beratung schwangerer Frauen
- 4.2.2 Zwischenfazit
- 5.0 Praxisbeispiel: Wiener Projekt zur Prävention postpartaler Depressionen
- 5.1 Zielsetzung, Konzeption und Ergebnisse
- 5.2 Zur Rolle der Sozialen Arbeit
- 6.0 Konzeptuelle Überlegungen für eine soziale Beratung schwangerer Frauen zur Prävention postpartaler Depressionen
- 6.1 Strukturelle Rahmenbedingungen
- 6.2 Beratungsinhalte
- 6.3 Methoden für eine soziale Beratung schwangerer Frauen
- 7.0 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der Sozialen Arbeit zur Prävention postpartaler Depressionen (PPD). Sie legt die Grundlage für ein Beratungskonzept, das in die Praxis der Sozialen Arbeit integriert werden kann und liefert praktische Empfehlungen für die Gestaltung einer sozialen Beratung. Im Zentrum der theoretischen Überlegungen steht die Relevanz des Konstrukts des Kohärenzgefühls für die Prävention von PPD.
- Bedeutung des Kohärenzgefühls in der Salutogenese
- Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit
- Der Übergang zur Elternschaft als kritisches Lebensereignis
- Ursachen, Risikofaktoren und Protektivfaktoren für die Entstehung einer PPD
- Konzeptuelle Überlegungen für eine soziale Beratung schwangerer Frauen zur Prävention von PPD
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema postpartale Depressionen und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit. Anschließend wird das Konstrukt des Kohärenzgefühls in der Salutogenese vorgestellt und seine Relevanz für die psychische Gesundheit, insbesondere im Kontext von Stressoren, erörtert. Kapitel 3 beleuchtet den Übergang zur Elternschaft als kritisches Lebensereignis, betrachtet die Symptomatik, Ursachen, Risikofaktoren und Protektivfaktoren von PPD sowie die Möglichkeiten der Prävention.
Kapitel 4 analysiert die Angebote von Schwangerenberatungsstellen und stellt verschiedene Konzepte der sozialen Beratung von schwangeren Frauen vor. Das darauffolgende Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel: ein Wiener Modellprojekt zur Prävention von PPD im Klinikkontext, das die strukturellen Rahmenbedingungen, Zielsetzung, Konzeption und Ergebnisse des Projekts beleuchtet.
Im letzten Kapitel der Arbeit werden konzeptuelle Überlegungen für eine soziale Beratung von schwangeren Frauen zur Prävention von PPD dargestellt. Es werden strukturelle Rahmenbedingungen, Beratungsinhalte und Methoden für eine erfolgreiche Beratung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Postpartale Depression, Kohärenzgefühl, Salutogenese, soziale Beratung, Schwangerschaft, Elternschaft, Risikofaktoren, Protektivfaktoren, Prävention, Lebensereignis, Wiener Modellprojekt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter postpartaler Depression (PPD)?
PPD ist eine psychische Erkrankung, die Frauen nach der Geburt eines Kindes betrifft und heute zu den häufigsten Komplikationen nach einer Schwangerschaft zählt.
Was ist das „Kohärenzgefühl“?
Ein Konstrukt aus der Salutogenese, das die drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit umfasst und hilft, Stressoren gesund zu bewältigen.
Wie kann Soziale Arbeit bei der Prävention von PPD helfen?
Durch ressourcenorientierte Beratung, die Förderung der Eigenständigkeit und die Vorbereitung auf den Übergang zur Elternschaft als kritisches Lebensereignis.
Was sind Risikofaktoren für eine postpartale Depression?
Dazu gehören mangelnde soziale Unterstützung, Partnerschaftskonflikte, schwierige Lebensumstände und psychische Vorbelastungen.
Welche Beratungsschwerpunkte sind für Schwangere wichtig?
Wichtige Themen sind soziale Unterstützung, die Partnerschaft, die Auseinandersetzung mit der neuen Elternrolle und der Umgang mit der eigenen Gefühlswelt.
- Arbeit zitieren
- Friederike Seeger (Autor:in), 2008, Depressionen nach der Schwangerschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193576