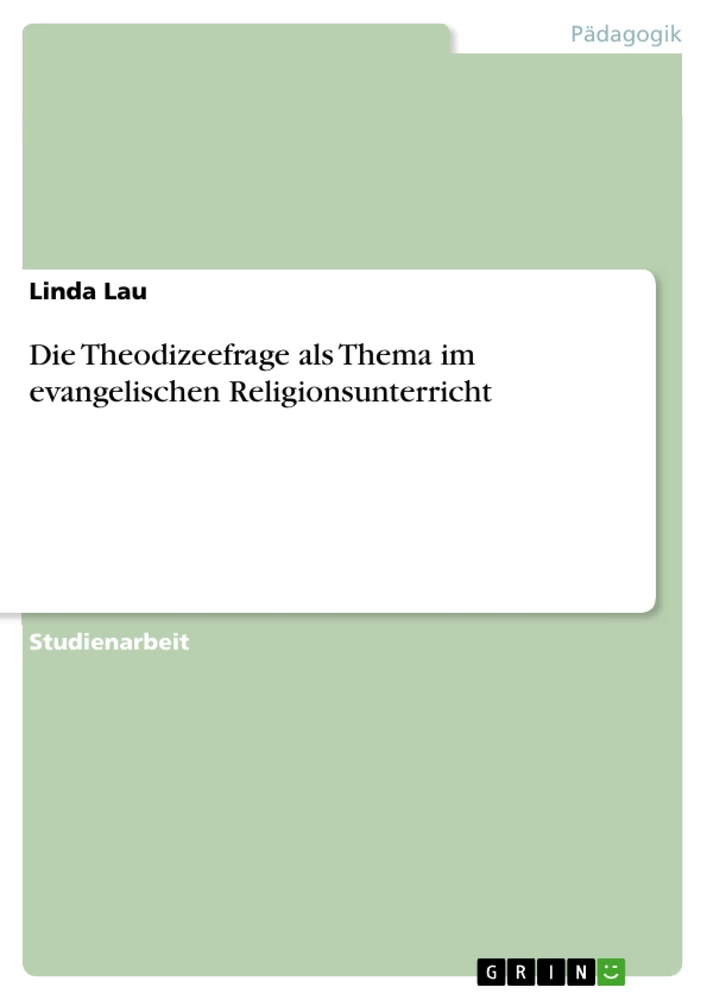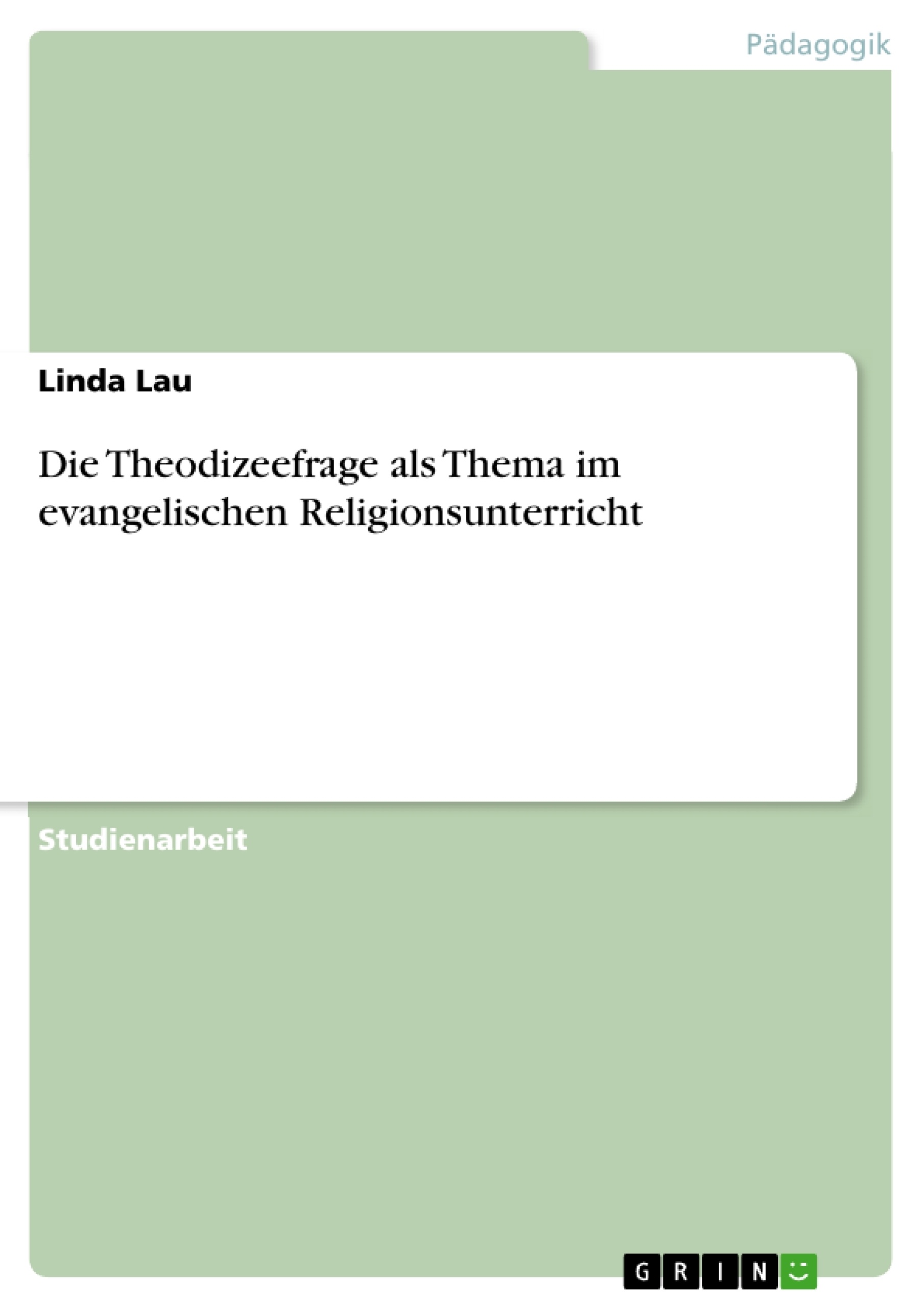„Wenn es nicht so viel Unglück gäbe, Kriege, Erdbeben, Unfälle, Krebs und so, dann könnte ich an Gott glauben. So aber frag ich mich: „Warum tut er nichts dagegen, wenn es ihn gibt?“1 Dieses Zitat stammt von einer 17jährigen Schülerin. Sie ist ein Beispiel dafür, dass auch Jugendliche die Frage nach Gott und dem Leid in der Welt stellen und diese Frage Konsequenzen auf den eigenen Gottesglauben haben kann.
Doch wenn man gegenwärtige Untersuchungen betrachtet, scheint diese Schülerin eine Ausnahme zu sein. Die meisten Untersuchungen zeigen, dass für Jugendliche Gott zwar existiert, aber keine große Rolle in ihrem eigenen Leben spielt. Werner Ritter stellt Thesen auf, die die Beschäftigung mit dem Theodizeeproblem im Unterricht als gänzlich überflüssig erscheinen lassen: Demnach habe das Thema »Theodizee« für viele Jugendliche keinerlei Relevanz, es werde meistens keine Verbindung zwischen Gott und dem Leid hergestellt und die SchülerInnen seien offensichtlich nicht an einer abstrakten philosophischen oder theologischen Auseinandersetzung mit der Theodizeefrage interessiert.2
Angesichts dieser Behauptungen stellt sich die Frage, ob man das Thema überhaupt im Unterricht behandeln kann oder bei dem Versuch direkt auf Ablehnung seitens der SchülerInnen treffen würde. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Situative Voraussetzungen
- Skizzierung einer 9. Klasse und die Vorbedingungen
- Lehr- und Lernvoraussetzungen
- Pädagogische Überlegungen
- Einordnung der Stunde in die Einheit – Die Lernausgangslage
- Fachwissenschaftliche Analyse / Sachanalyse
- Wissenschaftlicher Hintergrund: Theodizee-Argumentationen
- Materialanalyse
- Didaktische Analyse
- Didaktisch-methodische Strukturierung
- Kompetenzen/Unterrichtsziele
- Verlaufsplan
- Resümee
- Kompetenzerwartungen in Bezug auf die gesamte Einheit
- Anhang
- Textimpuls
- Tabellarische Gliederung der Einheit
- Arbeitsauftrag: Gruppenarbeit Teil 1
- Arbeitsauftrag: Gruppenarbeit Teil 2
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse ein Verständnis für das Theodizeeproblem zu vermitteln. Dies soll durch eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Argumentationen und Perspektiven geschehen, wobei der Fokus auf der Relevanz des Themas für das eigene Leben liegt. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, eigene Standpunkte zu formulieren und gleichzeitig die Vielschichtigkeit des Themas zu erkennen.
- Das Verhältnis von Gott und Leid
- Die Rolle von Gottesglauben im Leben von Jugendlichen
- Verschiedene Theodizeeargumente und deren Kritik
- Die Bedeutung von Religion und Glaube in der heutigen Gesellschaft
- Die Förderung von eigenständigem Denken und kritischer Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Theodizee im Religionsunterricht und stellt die Problematik der scheinbar sinkenden Relevanz für Jugendliche in den Vordergrund. Darüber hinaus wird das Ziel der Unterrichtseinheit definiert: Schülerinnen und Schüler sollen einen eigenen Standpunkt zum Theodizeeproblem entwickeln und gleichzeitig die Fehlbarkeit ihrer eigenen Sichtweise erkennen.
Der Abschnitt "Situative Voraussetzungen" skizziert die konkrete Lerngruppe und die spezifischen Bedingungen des Frankfurter Gymnasiums. Es werden die Altersstruktur der Schülerinnen und Schüler sowie die religiöse Sozialisation, die ihre Einstellung zu religiösen Themen beeinflusst, beschrieben. Darüber hinaus werden die relevanten Entwicklungsphasen und Glaubensstufen nach Fowler vorgestellt.
Schlüsselwörter
Theodizee, Leid, Gott, Religion, Glaube, Jugendliche, Unterricht, Didaktik, Gottesbild, Lebensführungskompetenz, Autonomie, Reflexion, kritische Auseinandersetzung, eigene Meinung, Fehlbarkeit, Standpunkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Theodizeeproblem?
Die Theodizeefrage sucht nach einer Antwort darauf, wie ein gütiger und allmächtiger Gott das Leid und Unglück in der Welt zulassen kann.
Ist das Thema für Jugendliche im Religionsunterricht relevant?
Obwohl Studien oft eine geringe Relevanz vermuten, zeigt die Arbeit, dass existenzielle Fragen nach Leid und Gott für die persönliche Glaubensentwicklung von 15- bis 17-Jährigen entscheidend sein können.
Welche Kompetenzen sollen Schüler in dieser Einheit erwerben?
Schüler sollen lernen, eigene Standpunkte zum Verhältnis von Gott und Leid zu formulieren, verschiedene Argumente kritisch zu reflektieren und die Vielschichtigkeit des Themas zu erkennen.
Welche Rolle spielen die Glaubensstufen nach Fowler?
Die Arbeit nutzt Fowlers Modell, um die religiöse Sozialisation und die kognitiven Voraussetzungen von Neuntklässlern bei der Planung des Unterrichts zu berücksichtigen.
Wie kann man das Thema didaktisch sinnvoll strukturieren?
Der Unterrichtsentwurf sieht Textimpulse, Gruppenarbeiten und eine fachwissenschaftliche Analyse klassischer Theodizee-Argumente vor, um die Schüler zur Reflexion anzuregen.
- Quote paper
- Linda Lau (Author), 2012, Die Theodizeefrage als Thema im evangelischen Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193876