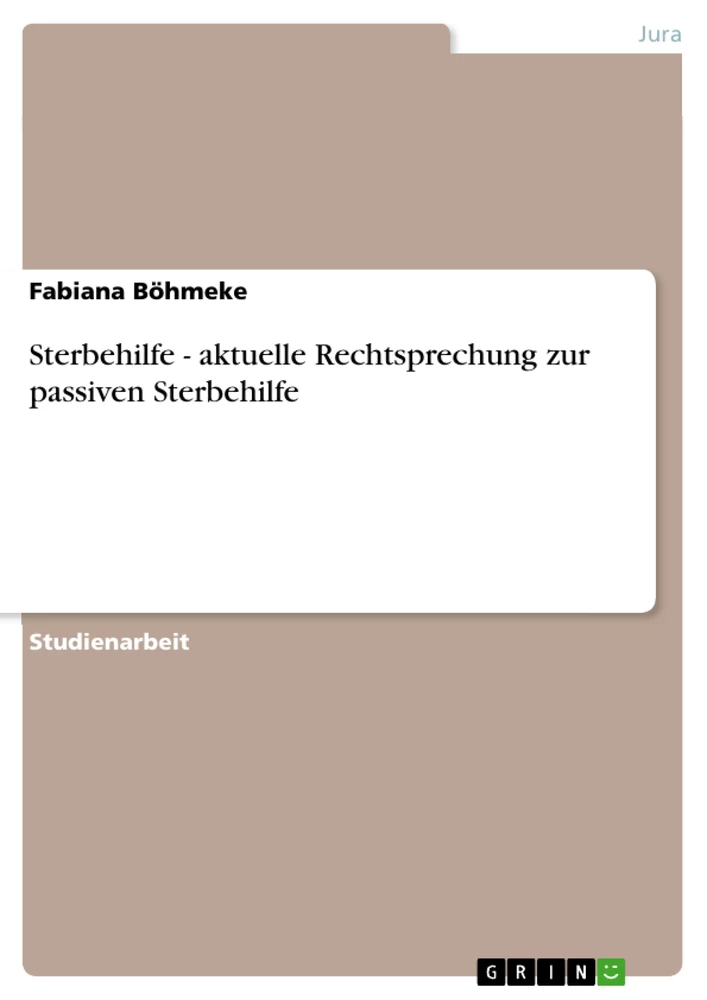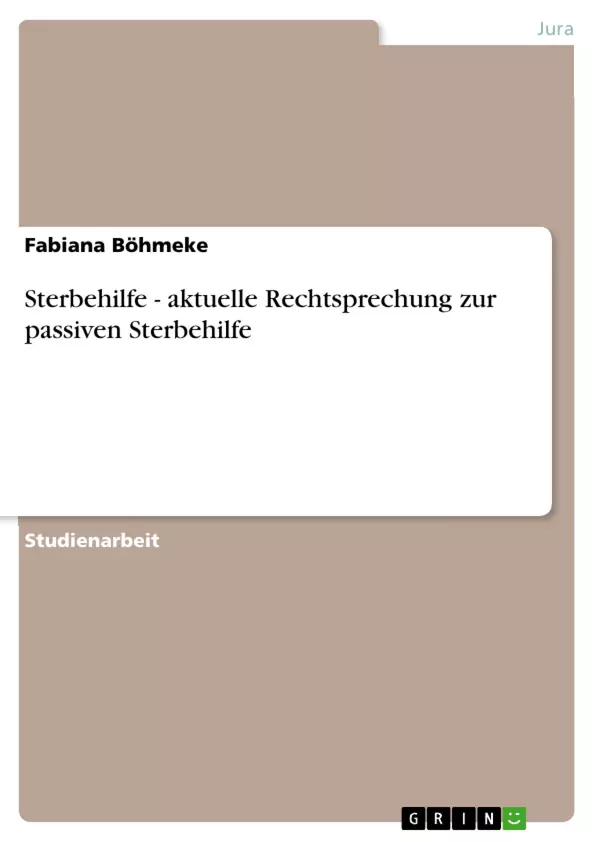Gerade in Anlehnung an den Fall ,,Mechthild Bach“ hat das Thema Sterbehilfe in Niedersachsen neue Aktualität und Brisanz gewonnen, sowie für Diskussionsstoff gesorgt.
(...Darstellung des Falles...)
Auch wenn es sich vorliegend grundsätzlich um einen Fall der aktiven Sterbehilfe handelt, bestehen weiterhin viele die Sterbehilfe allgemein betreffende Fragen:
Was muss oder darf ein Arzt tun, um quälende Schmerzen zu lindern? Wann ist eine Krankheit soweit fortgeschritten, dass der Patient sich in der Sterbephase befindet? Wo beginnt Sterbebegleitung beziehungsweise -hilfe rechtswidrig zu werden? Wann endet das Recht oder die Pflicht ein zu Ende gehendes Leben künstlich zu verlängern ? Diesen verschiedenartigen Fragestellungen durch möglichst einfache Entscheidungsprinzipien gerecht zu werden, ist zwar ein verständliches Verlangen, das jedoch wegen teils gegenläufiger Interessen nur begrenzt durchsetzbar ist . Die Sterbehilfe stellt uns vor existenzielle Fragen, deren Antworten zwischen den Polen ,,effektiver Lebensschutz“ und ,,tatsächliche Achtung der menschlichen Selbstbestimmung am Lebensende“ liegen . Der strafrechtliche Schutz des Lebens dauert bis zum Tode und kommt auch den unheilbar Kranken zu Gute , während der Gedanke der autonomen Selbstbestimmung nicht nur die allgemeine Ausgestaltung des Lebens, sondern auch den Sterbevorgang als letzte Lebensphase erfasst .
Angesichts einer alternden Gesellschaft und der Fortschritte in der Medizin stellt sich bei rund 850.000 Todesfällen im Jahr bei mehr als einem Drittel die Frage nach behandlungsbegrenzenden Entscheidungen am Lebensende . Anhand des Stichwortes Sterbehilfe wird dieser Problemkreis seit längerem eingehend diskutiert . Mit wachsender Manipulierbarkeit des Todes durch die moderne Medizin und mit dementsprechend steigendem Selbstbestimmungsinteresse über das eigene Leben und Sterben stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Sterbehilfe .
Die folgende Arbeit soll zunächst die rechtlich verschieden zu beurteilenden Arten der Sterbehilfe darstellen, sowie deren verfassungsrechtliche Problematik und die aktuelle Rechtsprechung zur passiven Sterbehilfe darstellen und kritisch bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriff der Sterbehilfe und Strafbarkeit
- 1. Die echte und die indirekte Sterbehilfe
- 2. Die unechte Sterbehilfe
- a. Die aktive Sterbehilfe
- b. Die passive Sterbehilfe
- III. Verfassungsrechtliche Problematik
- IV. Aktuelle Rechtsprechung zur passiven Sterbehilfe: Urteil des BGH vom 25.6.2010 (2 StR 454/09)
- 1. Leitsätze
- 2. Sachverhalt
- 3. Entscheidungsgründe
- 4. Stellungnahme
- V. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte zur Sterbehilfe
- VI. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe in Deutschland. Sie analysiert den Begriff der Sterbehilfe, differenziert zwischen verschiedenen Formen und beleuchtet die aktuelle Rechtsprechung, insbesondere das Urteil des Bundesgerichtshofs von 2010. Darüber hinaus wird die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Bezug auf Sterbehilfe thematisiert.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe
- Strafbarkeit der Sterbehilfe nach deutschem Recht
- Verfassungsrechtliche Aspekte und Grundrechte
- Analyse der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
- Europäische Rechtsprechung zur Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Sterbehilfe ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Es legt den Fokus auf die komplexen rechtlichen und ethischen Herausforderungen, die mit der Thematik verbunden sind, und gibt einen Überblick über den Aufbau der Untersuchung.
II. Begriff der Sterbehilfe und Strafbarkeit: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe. Er unterscheidet zwischen echter und indirekter Sterbehilfe sowie aktiver und passiver Sterbehilfe. Die jeweilige strafrechtliche Relevanz wird eingehend analysiert, wobei die unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen je nach Handlungsweise hervorgehoben werden. Es wird die gesetzliche Grundlage und die Interpretationsspielräume der jeweiligen Paragraphen diskutiert.
III. Verfassungsrechtliche Problematik: Dieses Kapitel untersucht die verfassungsrechtlichen Implikationen der Sterbehilfe. Es analysiert die potenziellen Konflikte zwischen dem Recht auf Leben und der Selbstbestimmung am Lebensende, beleuchtet die Rolle von Grundrechten wie der Menschenwürde und der körperlichen Unversehrtheit und untersucht, wie diese in Bezug auf Sterbehilfe juristisch gewichtet werden. Die relevanten Artikel des Grundgesetzes werden im Detail betrachtet.
IV. Aktuelle Rechtsprechung zur passiven Sterbehilfe: Urteil des BGH vom 25.6.2010 (2 StR 454/09): Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der detaillierten Analyse des BGH-Urteils von 2010 zur passiven Sterbehilfe. Die Leitsätze des Urteils werden erläutert, der Sachverhalt dargestellt und die Entscheidungsgründe kritisch gewürdigt. Es wird eine eigene Stellungnahme zu dem Urteil abgegeben, die die Argumentation des BGH bewertet und diskutiert.
V. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte zur Sterbehilfe: Dieser Abschnitt beleuchtet die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zur Sterbehilfe. Die relevanten Urteile werden vorgestellt und analysiert, wobei insbesondere die Frage der Vereinbarkeit nationaler Sterbehilfe-Gesetzgebung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention im Vordergrund steht. Der Einfluss europäischer Rechtsprechung auf die nationale Diskussion wird hier eingeordnet.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Strafbarkeit, Recht auf Leben, Selbstbestimmung, Bundesgerichtshof, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Verfassungsrecht, Grundrechte, Menschenwürde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Sterbehilfe
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe in Deutschland. Sie analysiert den Begriff der Sterbehilfe, differenziert zwischen verschiedenen Formen (aktive, passive, indirekte Sterbehilfe), beleuchtet die aktuelle Rechtsprechung (insbesondere ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2010) und thematisiert die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Welche Arten von Sterbehilfe werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen echter und indirekter Sterbehilfe sowie aktiver und passiver Sterbehilfe. Die jeweiligen strafrechtlichen Konsequenzen werden eingehend analysiert.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Die Arbeit untersucht die verfassungsrechtlichen Implikationen der Sterbehilfe, analysiert potenzielle Konflikte zwischen dem Recht auf Leben und der Selbstbestimmung am Lebensende und beleuchtet die Rolle von Grundrechten wie der Menschenwürde und der körperlichen Unversehrtheit. Relevante Artikel des Grundgesetzes werden betrachtet.
Wie wird das BGH-Urteil vom 25.6.2010 (2 StR 454/09) behandelt?
Das BGH-Urteil von 2010 zur passiven Sterbehilfe wird detailliert analysiert. Die Leitsätze des Urteils werden erläutert, der Sachverhalt dargestellt und die Entscheidungsgründe kritisch gewürdigt. Die Arbeit enthält eine eigene Stellungnahme zu dem Urteil.
Welche Bedeutung hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte?
Die Arbeit beleuchtet die Rechtsprechung des EGMR zur Sterbehilfe. Relevante Urteile werden vorgestellt und analysiert, wobei die Vereinbarkeit nationaler Sterbehilfe-Gesetzgebung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention im Vordergrund steht.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe umfassen Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Strafbarkeit, Recht auf Leben, Selbstbestimmung, Bundesgerichtshof, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Verfassungsrecht, Grundrechte und Menschenwürde.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Begriff der Sterbehilfe und Strafbarkeit, Verfassungsrechtliche Problematik, Aktuelle Rechtsprechung zur passiven Sterbehilfe, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte und Schlussbetrachtung), die die wichtigsten Inhalte jedes Abschnitts kurz beschreibt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die rechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe in Deutschland und analysiert die Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe. Sie analysiert die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Bezug auf Sterbehilfe.
- Citar trabajo
- Fabiana Böhmeke (Autor), 2011, Sterbehilfe - aktuelle Rechtsprechung zur passiven Sterbehilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193916