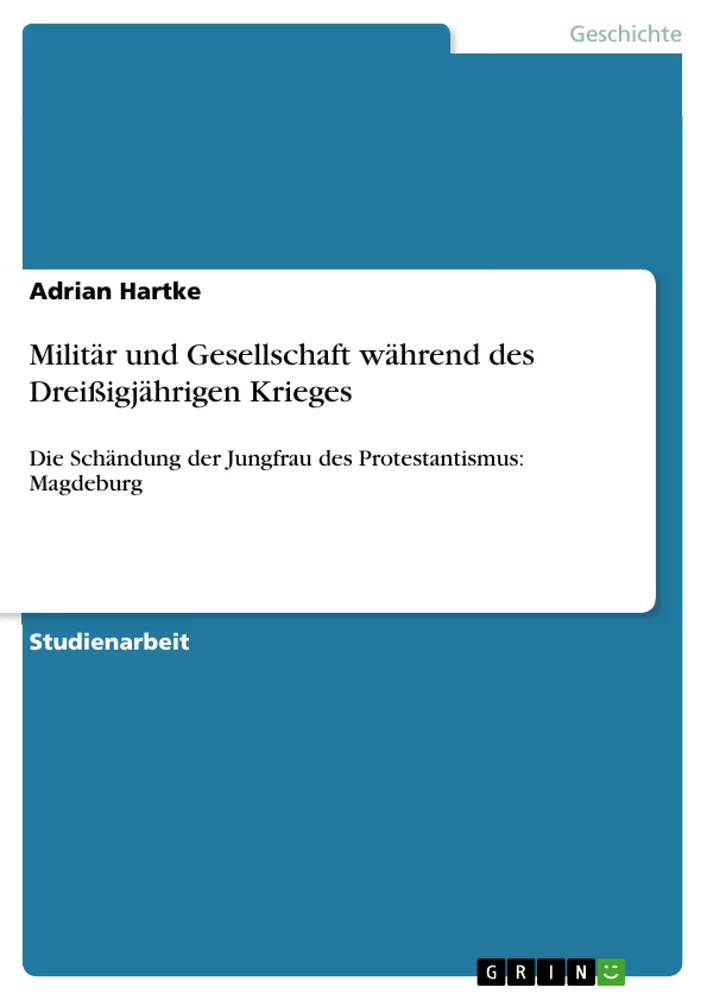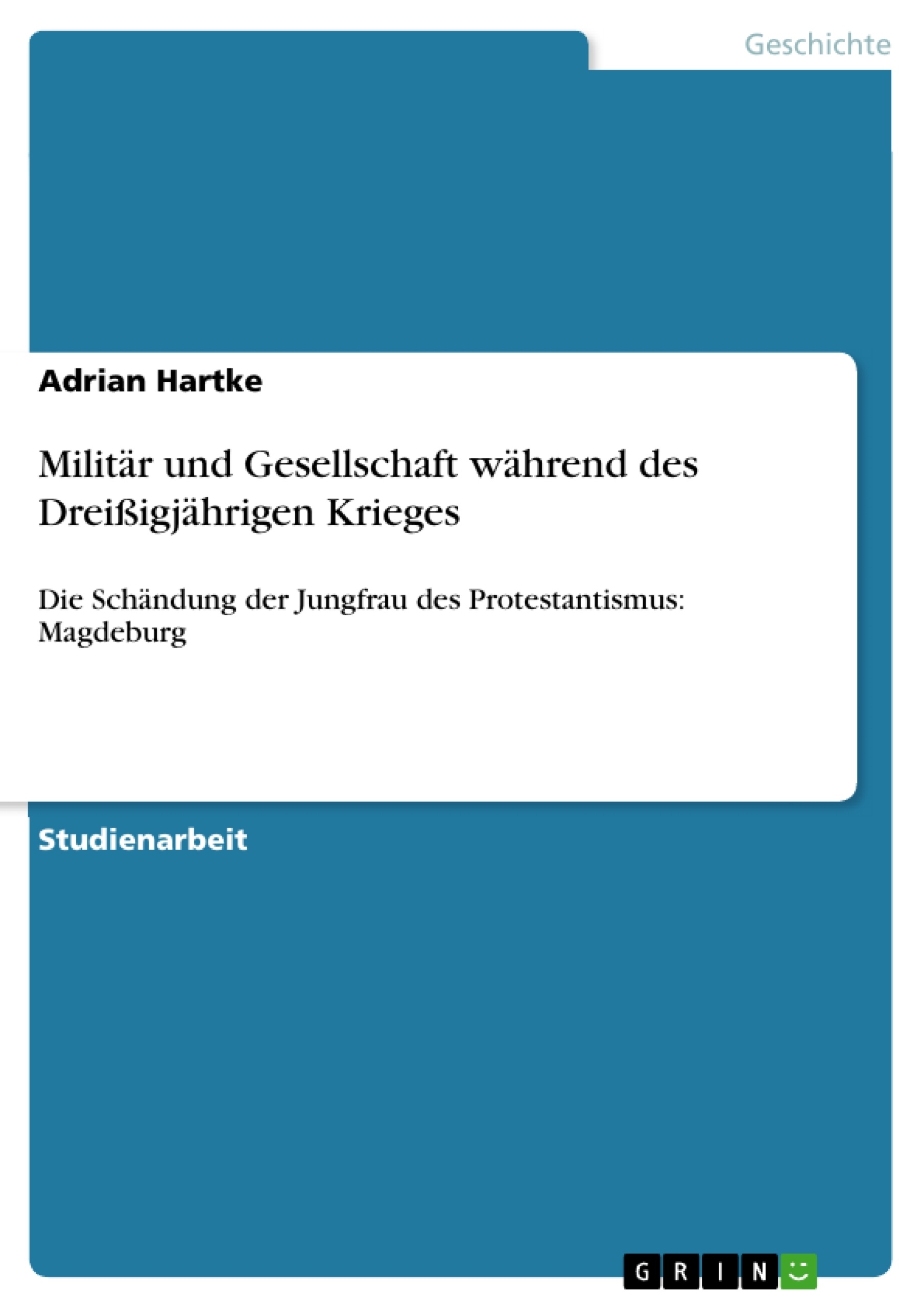Nichts war derart präsent in den Medien des Dreißigjährigen Krieges und löste derart starke Proteste aus wie die Schändung der Jungfrau des Protestantismus: Magdeburg. Nach erfolgreicher Belagerung und Einnahme der protestantischen Hochburg wurde sie von den kaiserlichen Truppen geplündert und zerstört. 20000 Menschen sollen dabei ihr Leben verloren haben. Die Zerstörung Magdeburgs sorgte sogar für eine neue Wortschöpfung zur Bezeichnung von verheerender Zerstörung: Magdeburgisierung.
Ob die Magdeburgisierung einer Stadt Alltag im Belagerungsgeschehen oder doch Ausnahme war, soll anhand von Augenzeugenberichten geklärt werden. Mit Hilfe der Quellen soll zudem die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär beantwortet werden.
Dabei müssen zunächst vor allem die Kriegsrechte des 17. Jahrhunderts analysiert werden, um letztendlich die Frage beantworten zu können, ob zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten im Kriege unterschieden wurde. Anhand verschiedener Augenzeugenberichte soll danach versucht werden eine charakteristische Belagerung einer Stadt im Dreißigjährigen Krieg zu rekonstruieren, falls die Quellen eine derartige Erstellung eines Belagerungsalltags ermöglichen.
Schließlich soll geklärt werden, ob die in mannigfachen Quellen des Dreißigjährigen Krieges immer wieder beschriebenen verheerenden Plünderungen der Zivilbevölkerung zum Kriegsalltag gehörten und das jeglicher Moral ferne Handeln der Söldner Ausnahmeerscheinung oder doch Routine im Kriegs- und Belagerungsalltag des Dreißigjährigen Krieges war.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Kodifiziertes Kriegsrecht
- 2. Die Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Stadt Magdeburg und der Begriff der Magdeburgisierung
- a) Magdeburg vor der Belagerung
- b) Belagerung von Magdeburg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg und deren Einordnung in den Kontext des damaligen Kriegsrechts und Belagerungsgeschehens. Ziel ist es, anhand von Augenzeugenberichten zu klären, ob die "Magdeburgisierung" ein Einzelfall oder ein typisches Ereignis des Krieges darstellte und welches Verhältnis zwischen Zivilbevölkerung und Militär bestand.
- Das kodifizierte Kriegsrecht des 17. Jahrhunderts und dessen Anwendung.
- Die Belagerung Magdeburgs und die Rolle der Zivilbevölkerung.
- Die Rolle der Söldner und deren Handeln.
- Der Vergleich der Zerstörung Magdeburgs mit anderen Belagerungen.
- Die Frage nach dem Kriegsalltag und der "Magdeburgisierung" als Routine oder Ausnahme.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage nach der Einordnung der Zerstörung Magdeburgs in den Kontext des Dreißigjährigen Krieges. Es wird die Bedeutung des Ereignisses hervorgehoben, die "Magdeburgisierung" als Synonym für verheerende Zerstörung etabliert wurde. Die Arbeit untersucht anhand von Augenzeugenberichten das Kriegsrecht, das Verhältnis zwischen Zivilbevölkerung und Militär und den Belagerungsalltag, um die Frage nach dem Ausmaß und der Typizität der Zerstörung Magdeburgs zu beantworten. Die Analyse soll klären, ob die Plünderungen der Zivilbevölkerung Alltag oder Ausnahme darstellten.
II. Hauptteil, 1. Kodifiziertes Kriegsrecht: Dieses Kapitel analysiert das kodifizierte Kriegsrecht des 17. Jahrhunderts, insbesondere das kaiserliche Kriegsrecht von 1570 und dessen Einfluss auf Mitteleuropa. Es zeigt, dass die Kriegsrechte zwar den Schutz der Zivilbevölkerung (Frauen, Kinder, Geistliche) betonten, jedoch eine entscheidende Ausnahmeregelung enthielten: Die Plünderung und Zerstörung wurde legitim, wenn vom kommandierenden Offizier angeordnet. Diese Paradoxie, der Schutz der Zivilbevölkerung auf der einen Seite und die Möglichkeit der Aufhebung dieses Schutzes durch einen Befehl auf der anderen Seite, wird als entscheidender Schwachpunkt des damaligen Kriegsrechts hervorgehoben. Verschiedene Artikelsbriefe werden als Beispiele für die widersprüchlichen Regelungen untersucht.
II. Hauptteil, 2. Die Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Stadt Magdeburg und der Begriff der Magdeburgisierung: Dieser Abschnitt beschreibt die Ereignisse um die Belagerung Magdeburgs. Zunächst wird die Situation Magdeburgs vor der Belagerung geschildert, einschließlich des Bündnisses mit Schweden und den damit verbundenen strategischen Implikationen. Die Belagerung selbst wird detailliert anhand von Augenzeugenberichten dargestellt, einschließlich der Beschreibung der Verteidigungsmaßnahmen, der Bombardierung und der Zerstörung der Vorstädte. Der Abschnitt beleuchtet die dramatischen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und die schrecklichen Folgen der Belagerung. Otto von Guericke’s Bericht liefert detaillierte Einblicke in die Ereignisse und die Auswirkungen des Beschusses auf die Stadtbewohner.
Schlüsselwörter
Dreißigjähriger Krieg, Magdeburg, Belagerung, Kriegsrecht, Zivilbevölkerung, Militär, Söldner, Plünderung, Brandschatzung, Magdeburgisierung, Augenzeugenberichte, Artikelsbriefe.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Zerstörung Magdeburgs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg und deren Einordnung in den Kontext des damaligen Kriegsrechts und Belagerungsgeschehens. Sie analysiert anhand von Augenzeugenberichten, ob die "Magdeburgisierung" ein Einzelfall oder ein typisches Ereignis des Krieges war und welches Verhältnis zwischen Zivilbevölkerung und Militär bestand.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das kodifizierte Kriegsrecht des 17. Jahrhunderts und dessen Anwendung, die Belagerung Magdeburgs und die Rolle der Zivilbevölkerung, die Rolle der Söldner, einen Vergleich der Zerstörung Magdeburgs mit anderen Belagerungen und die Frage nach dem Kriegsalltag und der "Magdeburgisierung" als Routine oder Ausnahme.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf Augenzeugenberichte, um die Ereignisse der Belagerung und Zerstörung Magdeburgs detailliert zu beschreiben und zu analysieren. Beispiele hierfür sind der Bericht von Otto von Guericke. Zusätzlich werden kodifizierte Kriegsrechtstexte (z.B. kaiserliches Kriegsrecht von 1570) und Artikelsbriefe herangezogen.
Was ist die Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die Zerstörung Magdeburgs ein Einzelfall oder ein typisches Ereignis des Dreißigjährigen Krieges war. Es wird untersucht, inwieweit die "Magdeburgisierung" (als Synonym für verheerende Zerstörung) den damaligen Kriegsgepflogenheiten entsprach und welche Rolle das Kriegsrecht dabei spielte.
Wie wird die "Magdeburgisierung" definiert?
Die "Magdeburgisierung" wird in der Arbeit als Synonym für die verheerende Zerstörung einer Stadt im Krieg verwendet. Die Arbeit untersucht, ob dieses Ereignis ein Einzelfall oder repräsentativ für die damaligen Kriegshandlungen war.
Welche Rolle spielte das Kriegsrecht?
Das Kapitel zum kodifizierten Kriegsrecht des 17. Jahrhunderts zeigt, dass die Kriegsrechte zwar den Schutz der Zivilbevölkerung betonten, aber auch eine entscheidende Ausnahmeregelung enthielten: Die Plünderung und Zerstörung wurde legitim, wenn vom kommandierenden Offizier angeordnet. Dieser Widerspruch wird als entscheidender Schwachpunkt des damaligen Kriegsrechts hervorgehoben.
Welche Rolle spielte die Zivilbevölkerung?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Zivilbevölkerung während der Belagerung und Zerstörung Magdeburgs. Anhand von Augenzeugenberichten wird das Verhältnis zwischen Zivilbevölkerung und Militär analysiert und die Auswirkungen der Ereignisse auf die Zivilbevölkerung beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit den Unterkapiteln "Kodifiziertes Kriegsrecht" und "Die Belagerung, Eroberung und Zerstörung Magdeburgs") und ein Fazit (implizit durch die Zusammenfassung der Kapitel gegeben).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dreißigjähriger Krieg, Magdeburg, Belagerung, Kriegsrecht, Zivilbevölkerung, Militär, Söldner, Plünderung, Brandschatzung, Magdeburgisierung, Augenzeugenberichte, Artikelsbriefe.
- Citation du texte
- Adrian Hartke (Auteur), 2006, Militär und Gesellschaft während des Dreißigjährigen Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193968