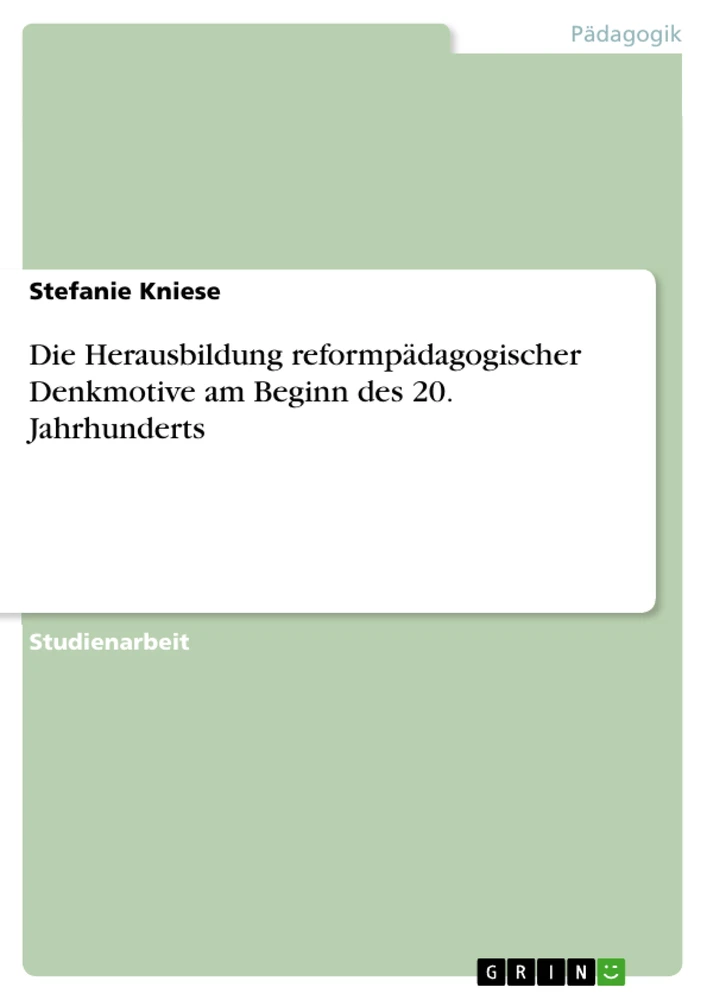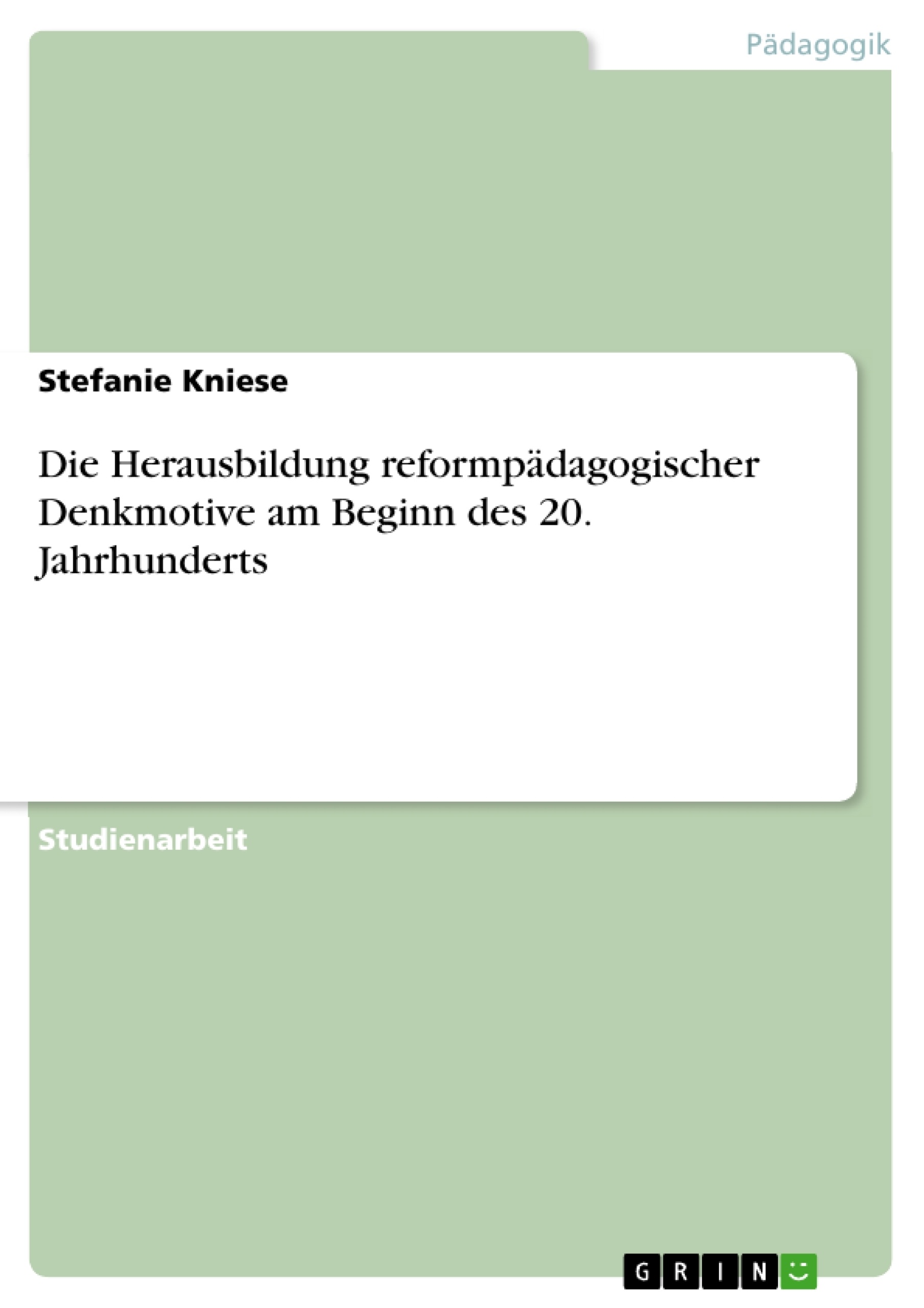Wie kam es zum Nationalsozialismus? Wie konnte der Mensch sein kritisches Denken der Gesellschaft zuliebe aufgeben? Fragen die aus der heutigen Sicht des individualisierten Menschen noch mehr Fragen aufwerfen mögen. Die Reformpädagogik versucht Licht in das Dunkel zu bringen, über die Erziehung, die Gesellschaft und den stetigen Wandel der Werte des einzelnen und seiner Mitmenschen. Den die Erziehung des Kindes ist das, was den erwachsenen Menschen und dessen Denken ausmachen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Reformpädagogik“
- Die Reformpädagogik 1900-1933
- Vertreter
- Georg Kerschensteiner (1854-1932)
- Peter Petersen
- Vertreter
- Jugendbewegung
- Wandervogel
- Die Industrialisierung
- Die Herausbildung reformpädagogischer Denkmotive am Beginn des 20. Jahrhunderts
- Die Gründe für die Herausbildung reformpädagogischer Denkmotive am Beginn des 20. Jahrhunderts
- Resümee
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die Gründe für die Entstehung reformpädagogischer Denkmotive in dieser Zeit und beleuchtet, wie diese Denkweise sich von der „Paukschule“ abhob. Die Arbeit analysiert die Ideen und Ansätze von zentralen Vertretern der Reformpädagogik sowie den Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen, wie der Industrialisierung und der Jugendbewegung.
- Definition und Charakteristika der Reformpädagogik
- Einfluss von Industrialisierung und Jugendbewegung auf die Entwicklung der Reformpädagogik
- Analyse von Reformpädagogen wie Georg Kerschensteiner und Peter Petersen
- Kritik an der „Paukschule“ und die Forderung nach einer veränderten Didaktik
- Die Bedeutung von Selbsttätigkeit, Schöpferkraft und der Ausbildung einer selbstständigen Persönlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Reformpädagogik im frühen 20. Jahrhundert dar und skizziert die Ziele der Arbeit.
- Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Reformpädagogik“ und erläutert, wie er sich von „reformare“ ableitet. Es beleuchtet die Bedeutung des Wandels und der Erneuerung in gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontexten.
- Das dritte Kapitel fokussiert auf die Reformpädagogik zwischen 1900 und 1933. Es stellt Georg Kerschensteiner und seine Arbeitsschulbewegung vor, die die Bedeutung von Arbeit und Staatsbürgerlicher Erziehung hervorhebt. Der Fokus liegt auf Kerschensteiners pädagogischen Ansätzen und seinen Bestrebungen, politische Bildung für Schüler aller Gesellschaftsschichten zu fördern.
- Das vierte Kapitel betrachtet die Jugendbewegung, insbesondere den „Wandervogel“, und untersucht dessen Einfluss auf die Reformpädagogik.
- Das fünfte Kapitel analysiert die Bedeutung der Industrialisierung als Motor für gesellschaftliche Veränderungen, die die Reformpädagogik prägten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Reformpädagogik, „Paukschule“, Industrialisierung, Jugendbewegung, Selbsttätigkeit, Schöpferkraft, Staatsbürgerliche Erziehung, Georg Kerschensteiner, Peter Petersen, Wandervogel, und Arbeitsschulbewegung. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Reformpädagogik am Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich mit einer Kritik an der traditionellen Schulform auseinandersetzt und alternative pädagogische Konzepte zur Förderung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative entwickelt.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der Reformpädagogik (1900-1933)?
Sie wollte die traditionelle „Paukschule“ ablösen und durch eine Pädagogik ersetzen, die Selbsttätigkeit, Schöpferkraft und die Entwicklung einer selbstständigen Persönlichkeit fördert.
Wer war Georg Kerschensteiner?
Ein bedeutender Vertreter der Arbeitsschulbewegung, der die Bedeutung von praktischer Arbeit und staatsbürgerlicher Erziehung betonte.
Welchen Einfluss hatte die Industrialisierung auf die Pädagogik?
Die Industrialisierung war ein Motor für gesellschaftlichen Wandel, der neue Anforderungen an die Bildung stellte und die Reformpädagogik mitprägte.
Was ist die „Wandervogel“-Bewegung?
Eine Jugendbewegung, die einen Gegenentwurf zur erstarrten Gesellschaft und Schule suchte und die Ideale der Reformpädagogik beeinflusste.
Wie grenzt sich die Reformpädagogik von der traditionellen Didaktik ab?
Statt passivem Auswendiglernen (Pauken) forderte sie die aktive Beteiligung der Schüler und eine Erziehung, die das Kind in den Mittelpunkt stellt.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Kniese (Autor:in), 2008, Die Herausbildung reformpädagogischer Denkmotive am Beginn des 20. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194035