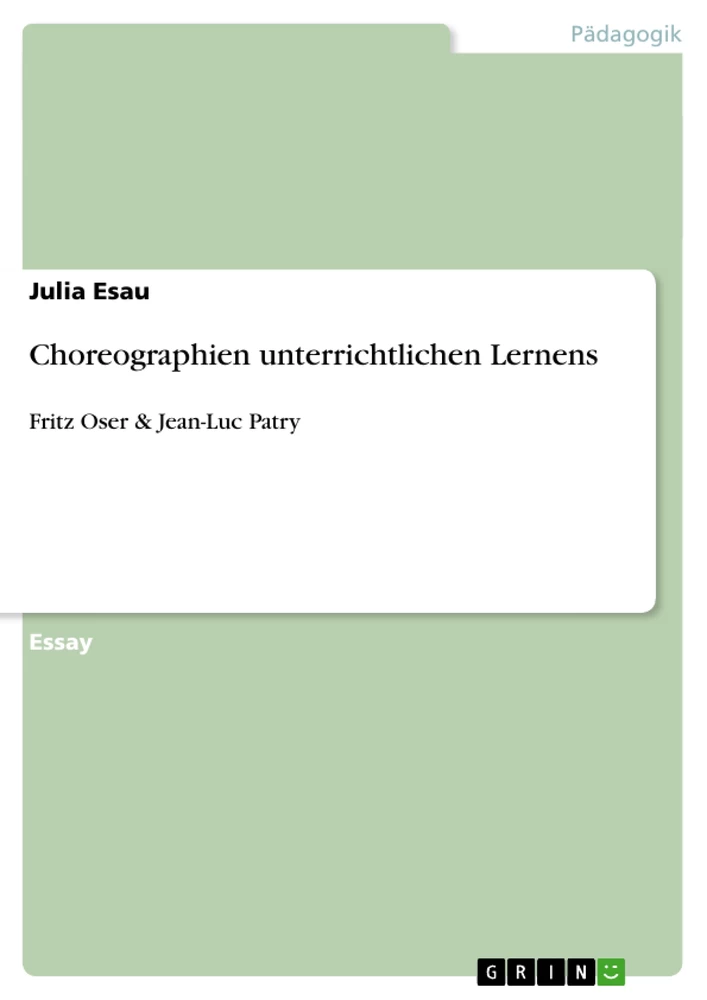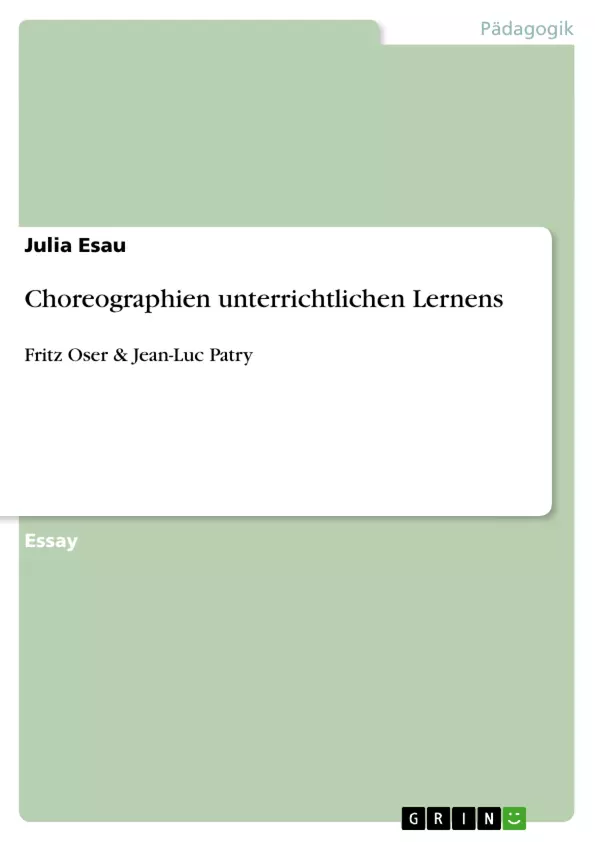I. Einleitung
Es sind viele verschiedene didaktische Theorien über Lehr-Lernhandlungen vorhan-den, und jedes dieser theoretischen Handlungsmodelle legt einen anderen Schwer-punkt. Professor Dr. Dr. h.c. Fritz Oser führte Studien über Lehr-Lernsituationen in Schulen durch und entwickelte so empirisch „Choreographien Unterrichtlichen Ler-nens“. In seinem gleichnamigen Werk erläutert er die Planung, Gestaltung und Ziel-setzung des Unterrichts im Blick auf den Schüler. Obwohl Oser sein Projekt an Schulen durchführte, kann man seine Resultate auch auf die Erwachsenenbildung übertragen. Oser spricht von Schülern oder Kindern, doch seine Hypothesen bzw. Ergebnisse finden analog in der Erwachsenenbildung statt. In dieser werden die Be-griffe der Didaktik und Methodik verwendet, und ähnlich Osers Choreographie für Schüler wird in der Erwachsenenbildung von der „Wechselwirkung von Lehren und Lernen im unterrichtlichen Interaktionsprozess“ (Arnold 2010, S. 64) gesprochen. Horst Seibert beschreibt im WÖRTERBUCH ERWACHSENENBILDUNG die Didaktik als den Mittler zwischen dem Inhalt der Sache und dem psychologischen Prozess des Lernenden (vgl. Arnold, S. 64). Wie auch Oser sieht die Erwachsenenbil-dung eine Verbindung der Didaktik und Methodik bei der Organisation von Lernpro-zessen, denn manche „inhaltliche Entscheidungen in Lehr-Lernprozessen [können] oft überhaupt nicht losgelöst von methodischen Überlegungen getroffen werden“ (Arnold 2010, S. 65). Genau diese These findet man in Osers Überlegungen von Lehr-Lernprozessen. Er unterscheidet zwei Ebenen, nämlich die der „Sichtstruktur“ und die der „Basismodelle“.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Spannungsfeld zwischen Lehren und Lernen
II.1. Die Weg-Metapher
II.2. Diskussion der Methodenfreiheit
III. Die Choreographie
IV. Die Sichtstruktur
V. Zwölf Basismodelle
V.1. Unterschiedliche Basismodelle
V.2. Verknüpfung der Elemente
V.3. Kombinationen
VI. Verhältnis Basismodelle und Sichtstruktur
VII. Fazit / Stellungnahme
Literaturangabe
I. Einleitung
Es sind viele verschiedene didaktische Theorien über Lehr-Lernhandlungen vorhan- den, und jedes dieser theoretischen Handlungsmodelle legt einen anderen Schwer- punkt. Professor Dr. Dr. h.c. Fritz Oser führte Studien über Lehr-Lernsituationen in Schulen durch und entwickelte so empirisch „Choreographien Unterrichtlichen Ler- nens“. In seinem gleichnamigen Werk erläutert er die Planung, Gestaltung und Ziel- setzung des Unterrichts im Blick auf den Schüler. Obwohl Oser sein Projekt an Schulen durchführte, kann man seine Resultate auch auf die Erwachsenenbildung übertragen. Oser spricht von Schülern oder Kindern, doch seine Hypothesen bzw. Ergebnisse finden analog in der Erwachsenenbildung statt. In dieser werden die Be- griffe der Didaktik und Methodik verwendet, und ähnlich Osers Choreographie für Schüler wird in der Erwachsenenbildung von der „Wechselwirkung von Lehren und Lernen im unterrichtlichen Interaktionsprozess“ (Arnold 2010, S. 64) gesprochen. Horst Seibert beschreibt im WÖRTERBUCH ERWACHSENENBILDUNG die Di- daktik als den Mittler zwischen dem Inhalt der Sache und dem psychologischen Pro- zess des Lernenden (vgl. Arnold, S. 64). Wie auch Oser sieht die Erwachsenenbil- dung eine Verbindung der Didaktik und Methodik bei der Organisation von Lernpro- zessen, denn manche „inhaltliche Entscheidungen in Lehr-Lernprozessen [können] oft überhaupt nicht losgelöst von methodischen Überlegungen getroffen werden“ (Arnold 2010, S. 65). Genau diese These findet man in Osers Überlegungen von Lehr-Lernprozessen. Er unterscheidet zwei Ebenen, nämlich die der „Sichtstruktur“ und die der „Basismodelle“.
II. Spannungsfeld zwischen Lehren und Lernen
Um diese beiden Ebenen zu erläutern muss man von der allgemeinen Annahme, dass „äußere Aktivitäten“ des Lernens „geistige Aktivitäten“ - die „Operationen“ - an- treiben, ausgehen (Oser/Patry 1997, S. 1). Ein Lehrer kann einem Schüler von Außen Gelegenheiten zum Lernen geben, doch ob, was und wie der Schüler lernt kann nur erahnt werden. Oser nennt dies ein „Spannungsfeld zwischen Unterricht und Lernen“ (Oser/Patry 1997, S. 1). Das Lernen ist ganz und gar vom Blickpunkt des Lernenden zu sehen, denn dieser vollführt die „geistige Tätigkeit“, das Lehren ist der „sanfte Zwang“ diese Operationen stattfinden zu lassen (Oser/Patry 1997, S. 2).
Der Erfolg eines Lehrenden ist nicht gleichzusetzen mit dem, wie der Lernende da- mit umgeht; das produziert diese „Spannungsfelder“ (vgl. Oser/Patry 1997, S. 2). Mit seiner Choreographie will Oser den Blick auf den Lernenden lenken und diesen in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen.
II. 1. Die Weg-Metapher
Oser nimmt die sogenannte „Weg-Metapher“ um diese Spannungsfelder zu beschrei- ben. Es sei also ein Weg gegeben, mit „Anhaltsund [sic!] Knotenpunkten“ (O- ser/Patry 1997, S. 2), diese stehen für die verschiedenen Operationen die im Unter- richt vollzogen werden. Der Weg ist jedoch nicht in verschiedene unterrichtliche Methoden eingeteilt, sondern das Lernen an sich ist ein „innerer Weg“ (Oser/Patry 1997, S. 3). Es gibt verschiedene Lernformen die verwendet und von „Intentionali- tät“ und „Kontextualität“ beeinflusst werden; das heißt die sogenannten „Basismo- delle“ sind davon bestimmt, was das Ziel des Lernens ist und in welchem Zusam- menhang dies gelernt wird (Oser/Patry 1997, S. 3). Diese „Weg-Metapher“ kann auch zur Erfolgskontrolle verwendet werden, denn nicht der „Inhalt sondern die Ket- te der Phasen und ihre Beziehungen untereinander“ bestimmen, wie gut oder schlecht eine Unterrichtsstunde war (Oser/Patry 1997, S. 5).
II. 2. Diskussion der Methodenfreiheit
Oser kritisiert, dass diese Freiheit der Lehrenden ihre Methoden selber zu bestim- men, dazu führt, dass didaktische Modelle „keinen handlungsweisenden Charkater“ mehr haben, und dass eine „Ablehnung von Traditionswissen“ stattfinde (Oser/Patry 1997, S. 6). Doch gerade diese Punkte sind notwendig, da experimentell und nomo- thetisch untersucht und belegt wurde, dass die Operationen in einer bestimmten Rei- henfolge stattfinden und das „Lernen […] nicht der professionellen Freiheit der Lehrperson“ überlassen werden kann (Oser/Patry 1997, S. 7). Und genau dieser Kon- flikt zwischen der freien Unterrichtsgestaltung der Lehrer und der „Gesetzmäßigkei- ten des Lernens“ versucht Oser durch seine Choreographie zu lösen (Oser/Patry 1997, S. 7).
III. Die Choreographie
Oser definiert den Begriff der Choreographie als „eine Tanzschrittfolge, die zwei Sorten von Ansprüchen gleichzeitig erfüllt. Einerseits kann der Tänzer den ihm zur Verfügung stehenden Raum frei geStalten [sic!][…], andererseits ist er an die Stren- ge des Rhythmus, an die Metrik und an die Tiefenstruktur des musikalischen Ver- laufs gehalten“ (Oser/Patry 1997, S. 8). Diese Tanzchoreographie kann man auf Lernprozesse übertragen. Die im Tanz frei zu gestaltender Raum wird von Oser als „Sichtstruktur“ definiert, der streng einzuhaltende Rhythmus steht für die „Basismodelle“. Hier finden wir zwei Ebenen, eine Oberflächen- und eine Tiefenebene.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Choreographien unterrichtlichen Lernens“?
Dieser von Fritz Oser entwickelte Begriff beschreibt eine Verbindung von didaktischer Freiheit (Sichtstruktur) und empirisch belegten Lernphasen (Basismodelle), um Unterricht effektiv auf den Lernenden auszurichten.
Was ist der Unterschied zwischen Sichtstruktur und Basismodellen?
Die Sichtstruktur umfasst die äußere Gestaltung des Unterrichts (Methodenwahl). Die Basismodelle bilden die Tiefenstruktur und definieren die notwendigen geistigen Operationen, die ein Schüler vollziehen muss, um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen.
Können diese Konzepte auf die Erwachsenenbildung übertragen werden?
Ja, obwohl Oser seine Studien an Schulen durchführte, finden die Hypothesen analog Anwendung in der Erwachsenenbildung, da die psychologischen Prozesse des Lernens ähnlich strukturiert sind.
Was besagt die „Weg-Metapher“ bei Oser?
Lernen wird als „innerer Weg“ mit festen Knotenpunkten gesehen. Nicht der Inhalt allein, sondern die Kette der Phasen und deren Beziehungen bestimmen den Erfolg einer Unterrichtsstunde.
Warum kritisiert Oser die uneingeschränkte Methodenfreiheit?
Er argumentiert, dass Lernen bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt. Wenn Lehrende Methoden ohne Rücksicht auf die notwendigen psychologischen Lernschritte wählen, gefährdet dies den Lernerfolg.
- Citar trabajo
- Julia Esau (Autor), 2011, Choreographien unterrichtlichen Lernens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194056