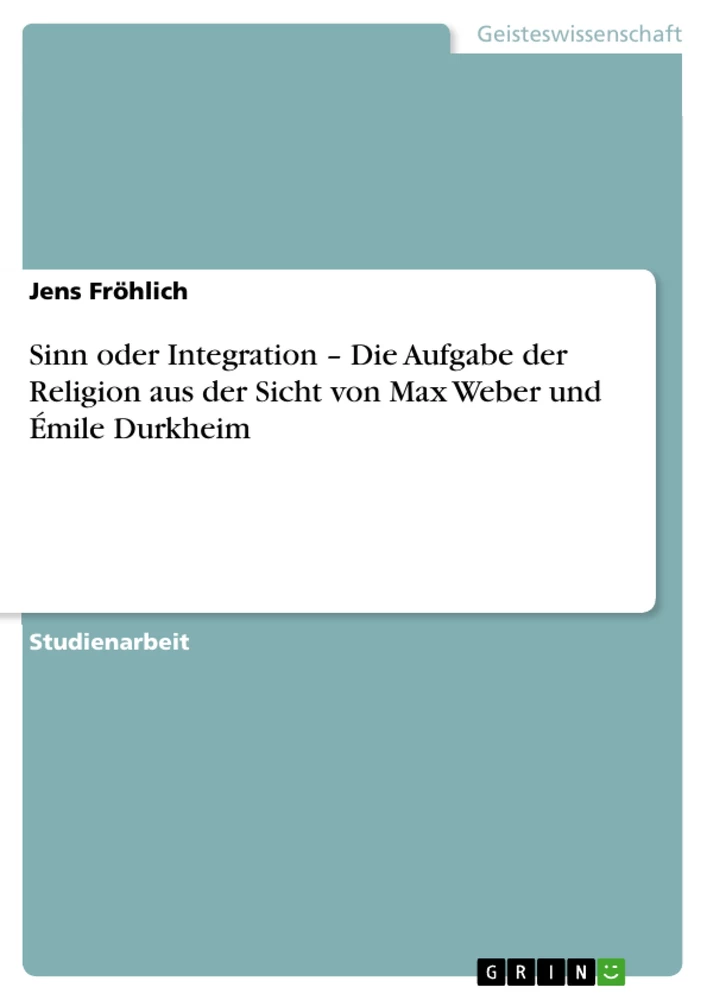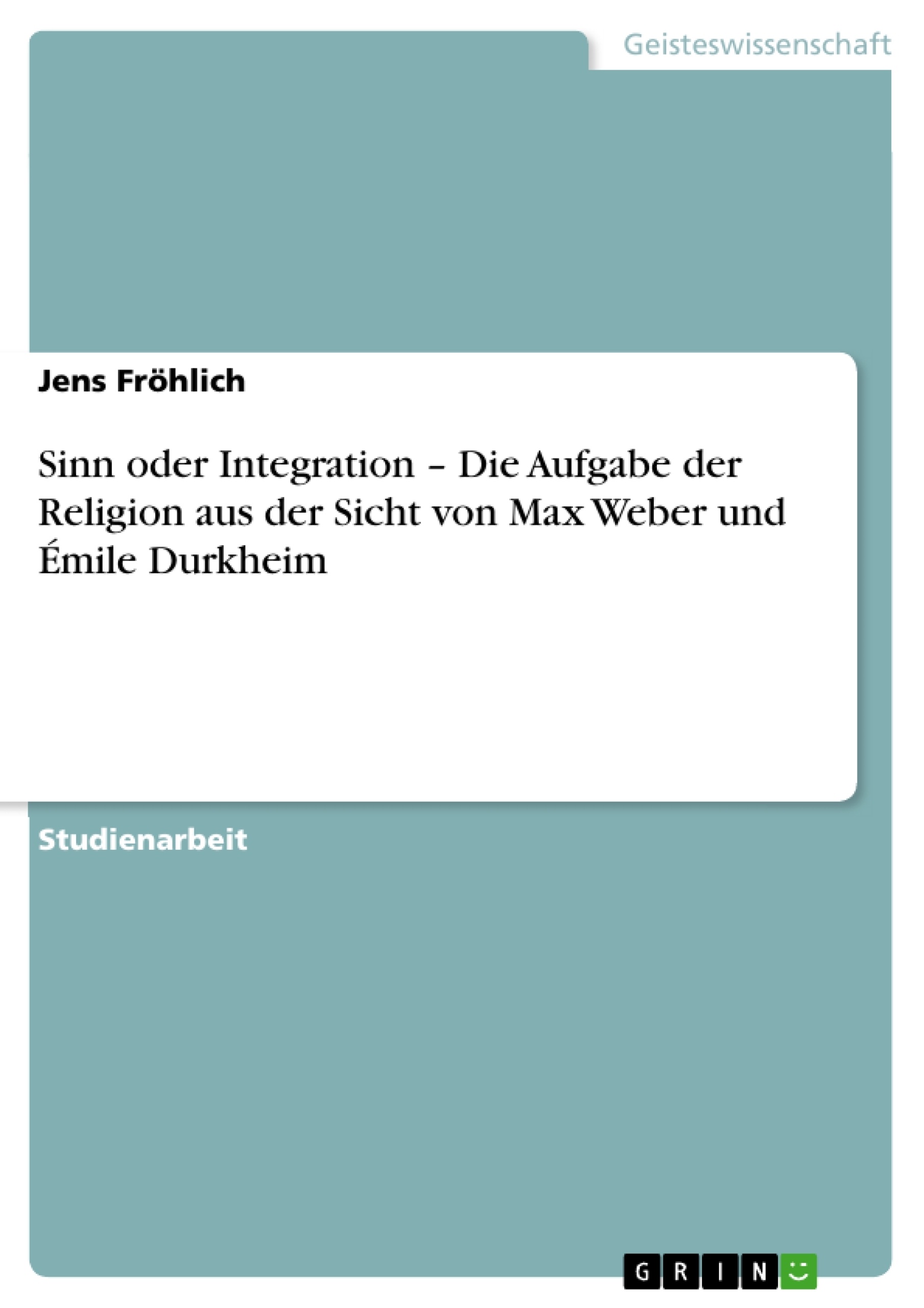Einleitung
Die religiösen Vorstellungen sind Kollektivvorstellungen, die Kollektivwirklichkeiten ausdrücken; die Riten sind Handlungen, die nur im Schoß von versammelten Gruppen entstehen können und die dazu dienen sollen, bestimmte Geisteszustände dieser Gruppen aufrechtzuerhalten oder wieder herzustellen (Durkheim, 1981, S. 28).
Natürlich können wir damit nicht jetzt schon das tiefste und wirklich erklärende Wesen der Religion erreichen; dies wird erst am Ende der Untersuchung möglich sein (Durkheim, 1981, S. 45).
Allein wir haben es überhaupt nicht mit dem „Wesen“ der Religion, sondern mit den Bedingungen und Wirkungen einer bestimmten Art von Gemeinschaftshandeln zu tun, dessen Verständnis auch hier nur von den subjektiven Erlebnissen, Vorstellungen, Zwecken der Einzelnen – vom „Sinn“ - aus gewonnen werden kann, da der äußere Ablauf ein höchst vielgestaltiger ist (Weber, 1980, S. 245).
Zwei Aussagen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Max Weber und Émile Durkheim blieben ihren soziologischen Vorstellungen auch in Fragen zur Religionssoziologie treu. Trat Durkheim vom Kollektivismus ausgehend an das Problem heran, war es für Weber klar, dass die Klärung der Aufgabe der Religion eines handlungstheoretischen Ansatzes bedürfe. Ausgangspunkt sei also das subjektive Handeln und zwar ein mindestens relativ rationales nach Erfahrungen geregeltes Handeln (Weber, 1980, S. 245). Bei Durkheim wird die Religion eher aus dem Kollektiv der Gesellschaft, die vor allem aktiv kooperiere, bzw. Gemeinschaft geboren und sie ist praktisch veranlagt, da die Tat das religiöse Leben alleine schon, weil die Gesellschaft ihre Ursache sei, beherrsche (Durkheim, 1981, S. 560).
Das legt die Vermutung nahe, dass beide auch zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Aufgabe der Religion gekommen sind. Wie sich dies tatsächlich darstellt und ob es nicht doch auch Gemeinsamkeiten bei der Erarbeitung ihrer Religionsbegriffe gibt, soll im Folgenden erläutert werden. Die Argumentation fußt hauptsächlich auf den dieses Thema betreffenden Hauptwerken der beiden Klassiker, allerdings nicht ohne unterstützende Sekundärliteratur hinzuzuziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Max Weber Sinn als Aufgabe der Religion
- Die fehlende Definition von Religion
- Religiöses Handeln als besondere Gattung sozialen Handelns
- Die Genese der Religion - über die Verlagerung von magischem zu religiösem Handeln
- Die,,Protestantische Ethik“
- Puritanismus und Prädestinationslehre
- Die innerweltliche Askese als Lebensführung
- Die Mikro- und Makroebene
- Loslösung des Kapitalismus von der Religion
- Erlösung und Theodizee - der „gemachte“ Sinn als Aufgabe der (Erlösungs)Religionen
- Am Ende steht „Die Entzauberung der Welt“
- Max Webers religionssoziologischen Prognosen bezogen auf die Gegenwart
- Émile Durkheim – Integration als Aufgabe der Religion
- Die Universalität der Religion - der funktionale Religionsbegriff
- Der Totemismus
- Die Unterscheidung des Heiligen vom Profanen
- Das Ideal der Gesellschaft als Reverenzziel
- Kollektive Erfahrungen ermöglichen Religion
- Religionsdefinition – der substantielle Religionsbegriff
- Am Ende steht eine Verlagerung innerhalb der Aufgabe der Religion
- Émile Durkheims religionssoziologischen Prognosen bezogen auf die Gegenwart
- Max Weber und Émile Durkheim – Übereinstimmungen ihrer religionssoziologischen Ansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die unterschiedlichen religionssoziologischen Ansätze von Max Weber und Émile Durkheim zu vergleichen und zu analysieren, wobei der Fokus auf der Frage nach der Aufgabe der Religion in der modernen Gesellschaft liegt.
- Die Bedeutung des subjektiven Sinns und der wertrationalen Handlung für Max Weber
- Die Rolle von Religion als integrierendes Element in Émile Durkheims Theorie
- Die Genese der Religion und die Entwicklung von magischem zu religiösem Handeln
- Der Einfluss der Religion auf den Kapitalismus und die „Entzauberung der Welt“
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den religionssoziologischen Ansätzen der beiden Denker
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Max Weber die Aufgabe der Religion in der modernen Gesellschaft sah. Er argumentierte, dass Religion einen subjektiven Sinn für die Handelnden stiftet und als Grundlage für wertrationales Handeln dient. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Entwicklung der Religion aus der Sicht von Max Weber, wobei er die Verlagerung von magischem zu religiösem Handeln untersucht. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel auch die zentralen Elemente der „Protestantischen Ethik“ und deren Einfluss auf die Entstehung des Kapitalismus behandelt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem religionssoziologischen Ansatz von Émile Durkheim. In diesem Kontext steht die Integration als Aufgabe der Religion im Vordergrund. Der Fokus liegt auf der universalen Funktion der Religion, der Bedeutung von Kollektivvorstellungen und Riten sowie der Unterscheidung des Heiligen vom Profanen.
Der vierte Abschnitt schließlich beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen von Max Weber und Émile Durkheim.
Schlüsselwörter
Religionssoziologie, Max Weber, Émile Durkheim, Sinn, Integration, Wertrationalität, Soziales Handeln, Magie, Religion, Kapitalismus, „Entzauberung der Welt“, Kollektivvorstellungen, Riten, Heiliges, Profanes.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Max Weber die Aufgabe der Religion?
Für Weber stiftet Religion subjektiven „Sinn“ und dient als Grundlage für wertrationales Handeln des Einzelnen.
Was ist die zentrale Funktion der Religion bei Émile Durkheim?
Durkheim sieht Religion als integratives Element, das durch Kollektivvorstellungen und Riten den Zusammenhalt der Gesellschaft sichert.
Was versteht Weber unter der „Entzauberung der Welt“?
Es beschreibt den Prozess der Rationalisierung, bei dem magisch-religiöse Erklärungen durch wissenschaftliche und rationale Erkenntnisse ersetzt werden.
Wie unterscheidet Durkheim das Heilige vom Profanen?
Das Heilige umfasst Dinge, die durch Riten abgesondert und geschützt werden, während das Profane den gewöhnlichen Alltag darstellt.
Welchen Zusammenhang sieht Weber zwischen Religion und Kapitalismus?
In seiner „Protestantischen Ethik“ argumentiert er, dass religiöse Askese und der Glaube an die Prädestination die Entstehung des modernen Kapitalismus begünstigt haben.
- Arbeit zitieren
- Jens Fröhlich (Autor:in), 2012, Sinn oder Integration – Die Aufgabe der Religion aus der Sicht von Max Weber und Émile Durkheim, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194174