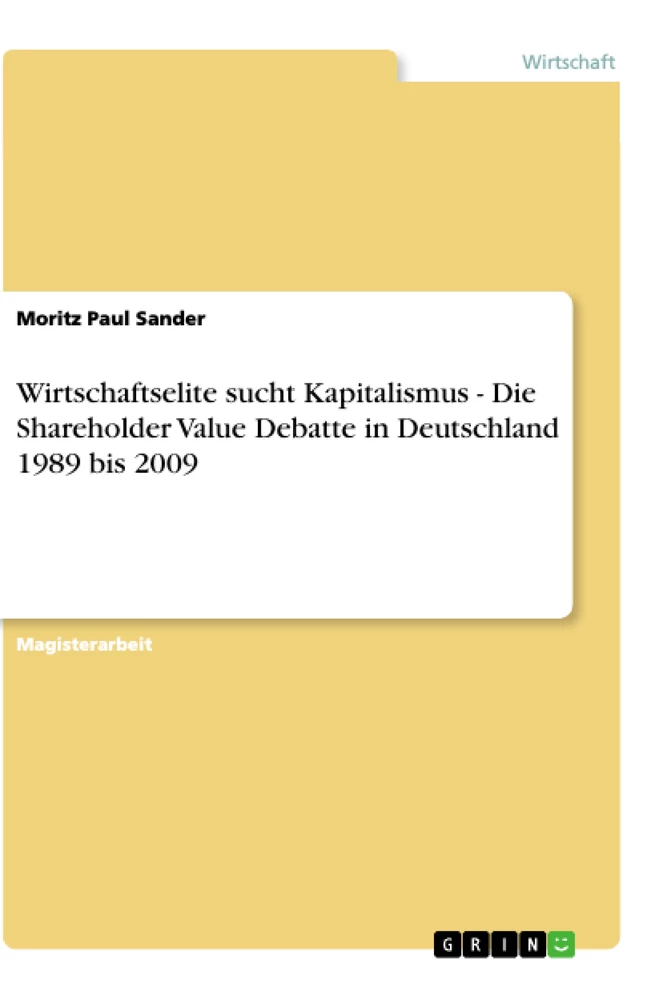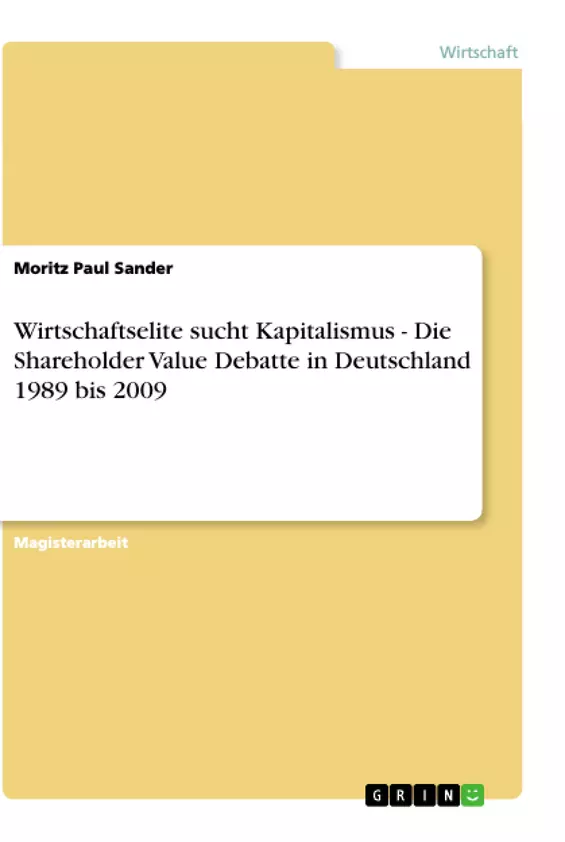Die Debatte der deutschen Wirtschaftselite um aktionärsorientierte Unternehmensführung begann 1989, erreichte den Höhepunkt Ende der 1990er Jahre und ebbte dann die Folgejahre ab. Gerade in der wirtschaftssoziologischen Literatur wird die Öffnung des deutschen Aktienmarktes für internationale Investoren häufig als Prozess der Amerikanisierung der deutschen Wirtschaftskultur betrachtet, in dem die einzelnen Akteure sich Handlungslogiken fügen müssten, wie jener der Maximierung des Aktionärsgewinnes im Kontext der Internationalisierung der Finanzmärkte. Hierfür ist Shareholder Value zum Symbol geworden.
Gestützt auf eine Analyse der Debatte um Shareholder Value in der Wirtschaftspresse argumentiert die vorliegende Arbeit hingegen, dass der Wandel der deutschen Wirtschaftsordnung in der Konzeption der deutschen Wirtschaftselite als kreativer Such- und Aushandlungsprozess verstanden werden muss, nicht als passiver Akt der Übernahme amerikanischer Vorstellungen davon, was richtige Unternehmensführung sei. Durch die Konstruktion von räumlich zuschreibbaren Wirtschaftskulturen werden konkurrierende Eigen- und Fremdbilder geschaffen, die nicht nur das jüngste Deutschland in einer sich globalisierenden Welt verorten sollen, sondern auch die Geschichte der deutschen Wirtschaftsordnung neu entwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 1.1 FRAGESTELLUNG.
- 1.2 METHODIK
- 1.3 FORSCHUNGSSTAND
- 1.4 THESE UND AUFBAU DER ARBEIT.
- 2. HISTORISCHE GENESE VON SHAREHOLDER VALUE IN DEN USA.
- 3. DIE SHAREHOLDER VALUE DEBATTE 1989 BIS 2009 IN CAPITAL, MANAGER MAGAZIN UND WIRTSCHAFTSWOCHE..
- 3.1 VERWENDUNG DES BEGRIFFS SHAREHOLDER VALUE AUS QUANTITATIVER PERSPEKTIVE
- 3.2 1989 BIS 1995: DER WUNSCH NACH VERÄNDERUNG
- 3.2.1 Revolution I: Shareholder Value erschüttert die „,Festung Deutschland\".
- 3.2.2 Reform I: Zwölf Uhr Mittags – Vorbild USA, Globalisierungsdruck und Deutschlands,,unkapitalistische Irrwege“.
- 3.2.3 Integration I: Konvergenz der Systeme? Die Debatte um Sinn und Zweck der Firma aus Sicht des Managements
- 3.3 1996 BIS 2000: SHAREHOLDER VALUE ALS POLITIKUM UND KOMMUNIKATIONSPROBLEM ….... .
- 3.3.1 Exkurs: Das,, neue deutsche Wirtschaftswunder\".
- 3.3.2 Revolution II: Shareholder Value wälzt ganz Deutschland um
- 3.3.2.1 Brüder, auf in die Frankfurter Republik! Die erhoffte Shareholdergesellschaft
- 3.3.2.2 Uncle Sam kommt – Bedeutungszunahme internationaler Investoren
- 3.3.3 Reform II: Ade Modell Deutschland?
- 3.3.4 Integration II: Shareholder Value als Verständigungsherausforderung.
- 3.3.4.1 Sell, sell, sell! Manager und die gewachsene Bedeutung ihrer Außendarstellung ...
- 3.3.4.2 Unwort, Rätsel, Modewort, Notwendigkeit, Missverständnis: Spektrum des öffentlichen Umgangs der Manager mit Shareholder Value............
- 3.4 2001-2009: HISTORISIERUNG DES BEGRIFFS .
- 3.4.1 Revolution III: Moralische Neuorientierung...
- 3.4.1.1 (Zusammen-)Bruch – Das Ende der Visionen
- 3.4.1.2 Neue Mode: Ethik als Komponente der Unternehmensstrategie
- 3.4.2 Reform III: Abkehr von Amerika und Hinwendung zu den eigenen Wurzeln
- 3.4.3 Integration III: Perversion einer Idee - Echter und falscher Shareholder Value..
- 13.5 SHAREHOlder Value UND DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFTSORDNUNG: DIE DREI ARGUMENTATIONSMOTIVE REVOLUTION, REFORM UND INTEGRATION
- 4. FAZIT..
- 4.1 DISKUSSION DER THESE
- 4.2 AUSBLICK.
- 5. LITERATURVERZEICHNIS
- 5.1 PRIMÄRQUELLEN ..
- 5.2 SEKUNDÄRQUELLEN.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Entwicklung der Shareholder Value Debatte in Deutschland von 1989 bis 2009. Sie analysiert die Verwendung des Begriffs Shareholder Value in den Medien Capital, Manager Magazin und Wirtschaftswoche und untersucht, wie sich die Debatte im Laufe der Zeit verändert hat.
- Die Auswirkungen von Globalisierung auf die deutsche Wirtschaft und das deutsche Wirtschaftsmodell
- Die Entwicklung des Shareholder Value-Konzepts in den USA und seine Übertragung auf Deutschland
- Die Medienrezeption und die öffentliche Diskussion um Shareholder Value in Deutschland
- Die Rolle von Investoren, Manager und Politik in der Shareholder Value Debatte
- Die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen des Shareholder Value Prinzips
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Forschungsfrage, die Methodik, den Forschungsstand und die These der Arbeit vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Genese des Shareholder Value Konzepts in den USA. Das dritte Kapitel analysiert die Shareholder Value Debatte in den Medien Capital, Manager Magazin und Wirtschaftswoche zwischen 1989 und 2009. Es betrachtet die Debatte in drei Phasen: 1989 bis 1995, 1996 bis 2000 und 2001 bis 2009. Dieses Kapitel untersucht, wie die Debatte über Shareholder Value in diesen drei Phasen verlief, welche Argumente für und gegen das Prinzip vorgebracht wurden und welche Folgen die Debatte für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft hatte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Shareholder Value, Globalisierung, Unternehmensführung, Medienanalyse, Deutschland, USA, Investoren, Manager, Wirtschaft, Gesellschaft, Ethik, Kapitalismus, Finanzmärkte, Medienrezeption, Debatte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Shareholder Value" in der deutschen Debatte?
Es bezeichnet ein Konzept der Unternehmensführung, das die Maximierung des Aktionärsnutzens (Aktienkurs und Dividende) in das Zentrum aller Entscheidungen stellt.
Wann erreichte die Shareholder-Value-Debatte in Deutschland ihren Höhepunkt?
Die Debatte begann Ende der 1980er Jahre und erreichte ihren Höhepunkt Ende der 1990er Jahre im Zuge der Globalisierung und der Öffnung der Finanzmärkte.
Führte Shareholder Value zu einer "Amerikanisierung" der deutschen Wirtschaft?
Die Arbeit argumentiert, dass es kein passiver Übernahmeprozess war, sondern ein kreativer Aushandlungsprozess, bei dem deutsche Unternehmen versuchten, eigene Wege zwischen Tradition und neuem Kapitalismus zu finden.
Was änderte sich nach dem Jahr 2001 in der Debatte?
Nach dem Platzen der Dotcom-Blase und Bilanzskandalen gab es eine Abkehr von extremen Shareholder-Konzepten hin zu mehr Ethik und einer Rückbesinnung auf langfristige Strategien.
Welche Rolle spielten Wirtschaftsmagazine in diesem Prozess?
Magazine wie Capital oder Manager Magazin fungierten als Plattformen für die Wirtschaftselite, um neue Konzepte zu diskutieren, zu legitimieren oder zu kritisieren.
- Citar trabajo
- Moritz Paul Sander (Autor), 2011, Wirtschaftselite sucht Kapitalismus - Die Shareholder Value Debatte in Deutschland 1989 bis 2009, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194189