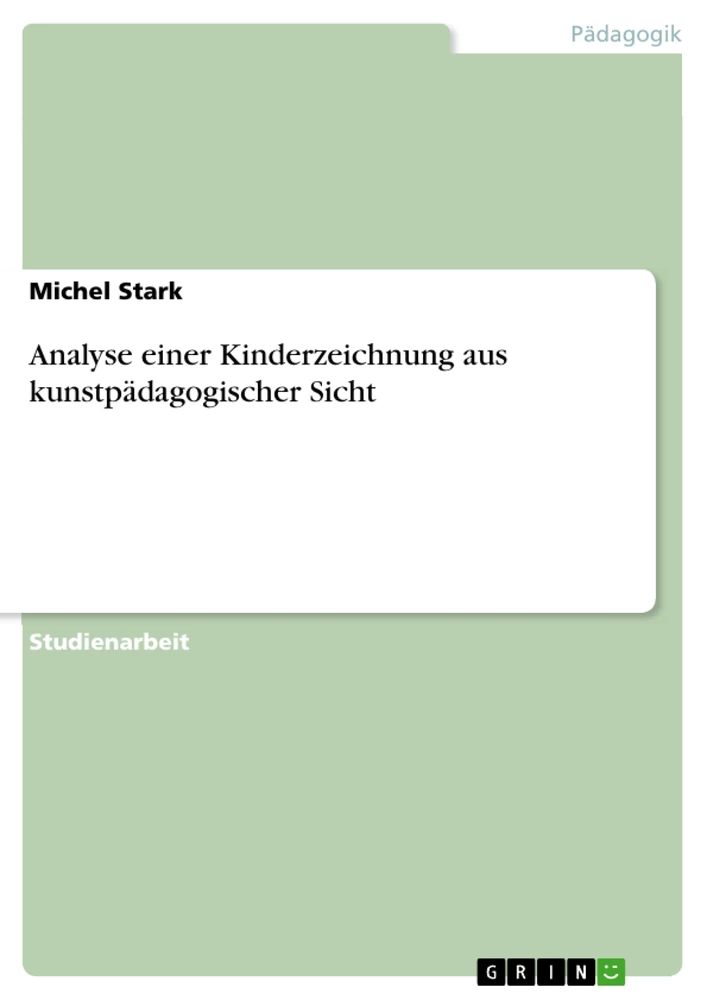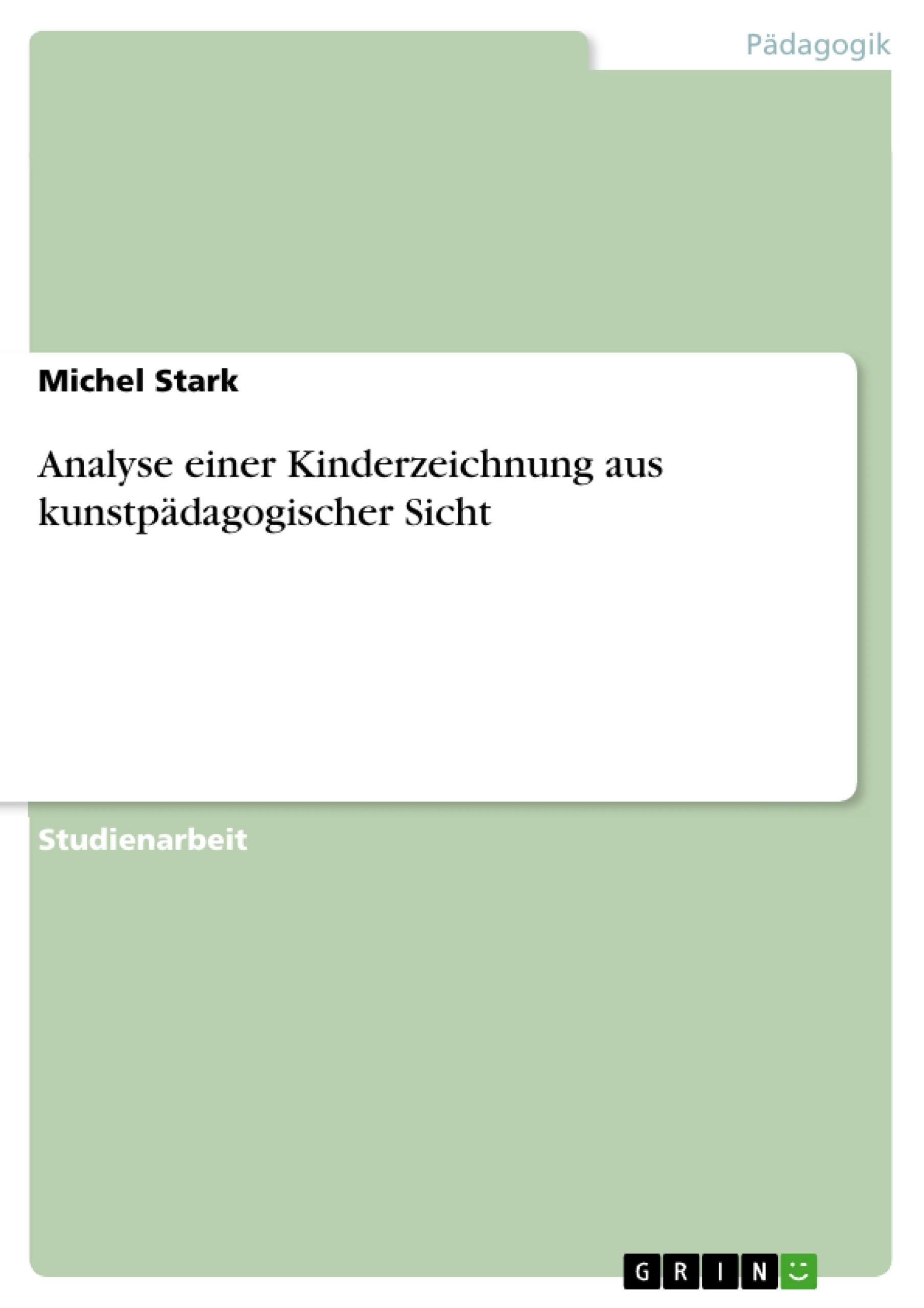Es handelt sich bei dieser Seminararbeit um eine Analyse einer Kinderzeichnung aus kunstpädagogischer Sicht. Die Arbeit beinhaltet eine Analyse der Funktion der Kinderzeichnung, die materielle Untersuchung der Zeichnung und mögliche Fördermaßnahmen.
Inhalt
1. Die Funktion der Kinderzeichnung
2. Die Rahmenbedingungen zur Entstehung der Kinderzeichnung
2.1. Die allgemeine und individuelle Situation des Kindes
2.2. Der Gestaltungsanlass
3. Die materielle Untersuchung
3.1. Das Bildmotiv
3.2. Der Entstehungsprozess
3.3. Der Soll-Stand
3.4. Der Ist-Stand
4. Notwendige Fördermaßnahmen
5. Literaturverzeichnis
1. Die Funktion der Kinderzeichnung
Dass Kinderzeichnungen nicht bloß wertlose Produkte eines kindlichen Zeitvertreibs sind, hat die mittlerweile seit über 100 Jahren bestehende Forschung in diesem Gebiet bereits bewiesen. In diesem langen Zeitraum beschäftigte man sich hauptsächlich mit der Analyse und der Interpretation von Kinderzeichnungen, um ein Entwicklungsmodell der Zeichenfähigkeit zu entwerfen oder eine psychologische Deutung der Bilder vornehmen zu können. Worin aber besteht die eigentliche Funktion von Kinderzeichnungen?
Die Funktion lässt sich aus zwei verschiedenen Perspektiven schildern: der des Kindes und der der Lehrenden oder der Eltern, die für das Kind verantwortlich sind. Hans-Günther Richter führt zu der Kinderzeichnung aus, dass es sich bei der kindlichen Bildnerei um ein eigenes Sprachsystem handelt, welches über ein eigenes Vokabular und eine eigene Grammatik verfügt, die wiederum erst erlernt werden müssen, um eine Einsicht in das Bild des Kindes zu gewinnen. Sind aber diese Kenntnisse vorhanden, so kann die Kinderzeichnung für die Lehrenden einen „echten“ Einblick in die kognitive und affektive Verfassung des Kindes vermitteln.[1]
Für das Kind hingegen kann laut Alfred Bareis die Tätigkeit des Zeichnens und Malens eine Hilfe sein, um Wirklichkeitserfahrungen und Erlebnisse aus seinem Alltag verarbeiten zu können. Dabei kann sich das Kind nicht nur mit seiner Umwelt, sondern auch mit seiner Fantasiewelt auseinandersetzen und seiner individuellen Sichtweise mithilfe des Zeichnens Ausdruck verleihen. Das Zeichnen und Malen ist in diesem Sinne ein wichtiges Ausdrucks- und Darstellungsmittel. Zudem werden durch die Kinderzeichnung die feinmotorische Entwicklung und der Differenzierungsgrad der Wahrnehmung des Kindes offen sichtbar.[2]
Constanze Kirchner hebt, ähnlich wie Bareis, besonders die Funktion der Kinderzeichnung als Ausdruck des inneren Erlebens hervor. Das Erlebte wird dabei von dem Kind während des Zeichnens zunächst organisiert und strukturisiert und dann symbolisiert.[3] Somit reflektiert das Kind seine Erlebnisse und verleiht seiner individuellen Sichtweise der Ereignisse oder Beziehungen seinen spezifischen bildnerischen Ausdruck.
2. Die Rahmenbedingungen zur Entstehung der Kinderzeichnung
2.1. Die allgemeine und individuelle Situation des Kindes
Der Zeichner des Bildes ist Moritz. Er ist 7 Jahre alt und geht in die erste Klasse einer privaten Ganztagsschule in Rostock-Kassebohm, die einen Schwerpunkt auf die Kreativitätsentwicklung legt. Moritz ist Linkshändler. Er zeichnet nicht außergewöhnlich gerne und auch nicht besonders viel, sondern spielt lieber draußen an der frischen Luft. Sein Interesse gilt mehr sportlichen und musischen als bildnerischen Tätigkeiten. Er interessiert sich außerdem für Naturwissenschaften. Zu dem Zeitpunkt der Zeichnung war es Herbst und „Leonardo da Vinci“ ein Inspirationsthema an der Schule, was bedeutet, dass versucht wurde, in jeden Unterricht einen Bezug zu dem Künstler und seinem Werk einzubauen. Themen waren unter anderem die Erfindungen da Vincis, darunter auch die Entwürfe von Fluggeräten
[...]
[1] vgl. Richter (1987) S. 13f.
[2] vgl. Bareis (2006) S. 9.
[3] vgl. Kirchner (2007) S. 15.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion haben Kinderzeichnungen laut der Forschung?
Sie dienen als eigenes Sprachsystem (Sprachersatz), als Mittel zur Verarbeitung von Erlebnissen und als Ausdruck der individuellen Fantasiewelt sowie der kognitiven Verfassung.
Was verrät eine Zeichnung über die Entwicklung eines Kindes?
Man kann den Differenzierungsgrad der Wahrnehmung, die feinmotorische Entwicklung sowie den aktuellen kognitiven und affektiven Stand des Kindes ablesen.
Wie beeinflussen äußere Inspirationen (z. B. Leonardo da Vinci) die Zeichnung?
Themen aus dem Unterricht oder dem Alltag fließen oft direkt in die Motivwahl ein, wie das Beispiel von Moritz zeigt, der durch ein Schulprojekt zu Fluggeräten inspiriert wurde.
Was ist der Unterschied zwischen "Soll-Stand" und "Ist-Stand"?
Der Soll-Stand beschreibt die altersgemäße Zeichenfähigkeit laut Entwicklungsmodellen, während der Ist-Stand die tatsächliche individuelle Leistung des Kindes in der untersuchten Zeichnung darstellt.
Welche Fördermaßnahmen gibt es in der Kunstpädagogik?
Fördermaßnahmen zielen darauf ab, die Freude am Gestalten zu wecken, die Wahrnehmung zu schärfen und dem Kind neue materielle oder motivische Impulse zu geben.
- Quote paper
- Michel Stark (Author), 2009, Analyse einer Kinderzeichnung aus kunstpädagogischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194263